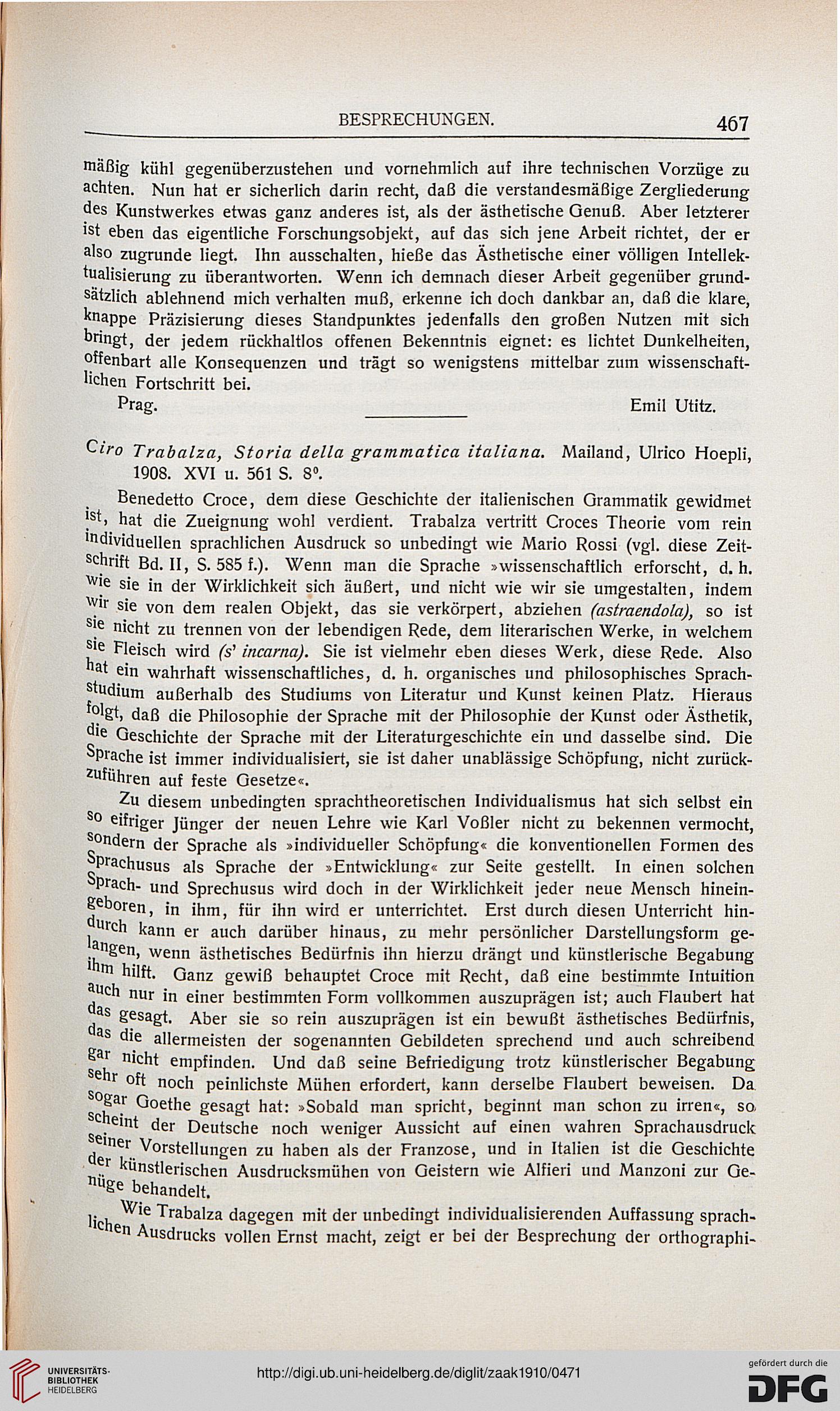BESPRECHUNGEN. 457
mäßig kühl gegenüberzustehen und vornehmlich auf ihre technischen Vorzüge zu
achten. Nun hat er sicherlich darin recht, daß die verstandesmäßige Zergliederung
des Kunstwerkes etwas ganz anderes ist, als der ästhetische Genuß. Aber letzterer
•st eben das eigentliche Forschungsobjekt, auf das sich jene Arbeit richtet, der er
also zugrunde liegt. Ihn ausschalten, hieße das Ästhetische einer völligen Intellek-
tualisierung zu überantworten. Wenn ich demnach dieser Arbeit gegenüber grund-
sätzlich ablehnend mich verhalten muß, erkenne ich doch dankbar an, daß die klare,
knappe Präzisierung dieses Standpunktes jedenfalls den großen Nutzen mit sich
°r'ngt, der jedem rückhaltlos offenen Bekenntnis eignet: es lichtet Dunkelheiten,
offenbart alle Konsequenzen und trägt so wenigstens mittelbar zum wissenschaft-
•ichen Fortschritt bei.
Prag. ____________ Emil Utitz.
Ciro Trabalza, Storia della grammatica italiana. Mailand, Ulrico Hoepli,
1908. XVI u. 561 S. 8°.
Benedetto Croce, dem diese Geschichte der italienischen Grammatik gewidmet
|st, hat die Zueignung wohl verdient. Trabalza vertritt Croces Theorie vom rein
individuellen sprachlichen Ausdruck so unbedingt wie Mario Rossi (vgl. diese Zeit-
schrift Bd. II, S. 585 f.). Wenn man die Sprache »wissenschaftlich erforscht, d.h.
w|e sie in der Wirklichkeit sich äußert, und nicht wie wir sie umgestalten, indem
Wlr sie von dem realen Objekt, das sie verkörpert, abziehen (astraendola), so ist
s|e nicht zu trennen von der lebendigen Rede, dem literarischen Werke, in welchem
^'e Fleisch wird (s' incarna). Sie ist vielmehr eben dieses Werk, diese Rede. Also
nat ein wahrhaft wissenschaftliches, d. h. organisches und philosophisches Sprach-
studium außerhalb des Studiums von Literatur und Kunst keinen Platz. Hieraus
°'gt, daß die Philosophie der Sprache mit der Philosophie der Kunst oder Ästhetik,
a'e Geschichte der Sprache mit der Literaturgeschichte ein und dasselbe sind. Die
Sprache ist immer individualisiert, sie ist daher unablässige Schöpfung, nicht zurück-
führen auf feste Gesetze«.
Zu diesem unbedingten sprachtheoretischen Individualismus hat sich selbst ein
So eifriger Jünger der neuen Lehre wie Karl Voßler nicht zu bekennen vermocht,
°ndern der Sprache als »individueller Schöpfung« die konventionellen Formen des
Prachusus als Sprache der »Entwicklung« zur Seite gestellt. In einen solchen
Prach- und Sprechusus wird doch in der Wirklichkeit jeder neue Mensch hinein-
S boren, in ihm, für ihn wird er unterrichtet. Erst durch diesen Unterricht hin-
reh kann er auch darüber hinaus, zu mehr persönlicher Darstellungsform ge-
igen, wenn ästhetisches Bedürfnis ihn hierzu drängt und künstlerische Begabung
m hilft. Ganz gewiß behauptet Croce mit Recht, daß eine bestimmte Intuition
en nur in einer bestimmten Form vollkommen auszuprägen ist; auch Flaubert hat
s gesagt. Aber sie so rein auszuprägen ist ein bewußt ästhetisches Bedürfnis,
s die allermeisten der sogenannten Gebildeten sprechend und auch schreibend
gar nicht empfinden. Und daß seine Befriedigung trotz künstlerischer Begabung
r oft noch peinlichste Mühen erfordert, kann derselbe Flaubert beweisen. Da
Sar Goethe gesagt hat: »Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren«, so
eint der Deutsche noch weniger Aussicht auf einen wahren Sprachausdruck
'"er Vorstellungen zu haben als der Franzose, und in Italien ist die Geschichte
künstlerischen Ausdrucksmühen von Geistern wie Alfieri und Manzoni zur Ge-
n"ge behandelt.
li h trabalza dagegen mit der unbedingt individualisierenden Auffassung sprach-
en Ausdrucks vollen Ernst macht, zeigt er bei der Besprechung der orthographi-
mäßig kühl gegenüberzustehen und vornehmlich auf ihre technischen Vorzüge zu
achten. Nun hat er sicherlich darin recht, daß die verstandesmäßige Zergliederung
des Kunstwerkes etwas ganz anderes ist, als der ästhetische Genuß. Aber letzterer
•st eben das eigentliche Forschungsobjekt, auf das sich jene Arbeit richtet, der er
also zugrunde liegt. Ihn ausschalten, hieße das Ästhetische einer völligen Intellek-
tualisierung zu überantworten. Wenn ich demnach dieser Arbeit gegenüber grund-
sätzlich ablehnend mich verhalten muß, erkenne ich doch dankbar an, daß die klare,
knappe Präzisierung dieses Standpunktes jedenfalls den großen Nutzen mit sich
°r'ngt, der jedem rückhaltlos offenen Bekenntnis eignet: es lichtet Dunkelheiten,
offenbart alle Konsequenzen und trägt so wenigstens mittelbar zum wissenschaft-
•ichen Fortschritt bei.
Prag. ____________ Emil Utitz.
Ciro Trabalza, Storia della grammatica italiana. Mailand, Ulrico Hoepli,
1908. XVI u. 561 S. 8°.
Benedetto Croce, dem diese Geschichte der italienischen Grammatik gewidmet
|st, hat die Zueignung wohl verdient. Trabalza vertritt Croces Theorie vom rein
individuellen sprachlichen Ausdruck so unbedingt wie Mario Rossi (vgl. diese Zeit-
schrift Bd. II, S. 585 f.). Wenn man die Sprache »wissenschaftlich erforscht, d.h.
w|e sie in der Wirklichkeit sich äußert, und nicht wie wir sie umgestalten, indem
Wlr sie von dem realen Objekt, das sie verkörpert, abziehen (astraendola), so ist
s|e nicht zu trennen von der lebendigen Rede, dem literarischen Werke, in welchem
^'e Fleisch wird (s' incarna). Sie ist vielmehr eben dieses Werk, diese Rede. Also
nat ein wahrhaft wissenschaftliches, d. h. organisches und philosophisches Sprach-
studium außerhalb des Studiums von Literatur und Kunst keinen Platz. Hieraus
°'gt, daß die Philosophie der Sprache mit der Philosophie der Kunst oder Ästhetik,
a'e Geschichte der Sprache mit der Literaturgeschichte ein und dasselbe sind. Die
Sprache ist immer individualisiert, sie ist daher unablässige Schöpfung, nicht zurück-
führen auf feste Gesetze«.
Zu diesem unbedingten sprachtheoretischen Individualismus hat sich selbst ein
So eifriger Jünger der neuen Lehre wie Karl Voßler nicht zu bekennen vermocht,
°ndern der Sprache als »individueller Schöpfung« die konventionellen Formen des
Prachusus als Sprache der »Entwicklung« zur Seite gestellt. In einen solchen
Prach- und Sprechusus wird doch in der Wirklichkeit jeder neue Mensch hinein-
S boren, in ihm, für ihn wird er unterrichtet. Erst durch diesen Unterricht hin-
reh kann er auch darüber hinaus, zu mehr persönlicher Darstellungsform ge-
igen, wenn ästhetisches Bedürfnis ihn hierzu drängt und künstlerische Begabung
m hilft. Ganz gewiß behauptet Croce mit Recht, daß eine bestimmte Intuition
en nur in einer bestimmten Form vollkommen auszuprägen ist; auch Flaubert hat
s gesagt. Aber sie so rein auszuprägen ist ein bewußt ästhetisches Bedürfnis,
s die allermeisten der sogenannten Gebildeten sprechend und auch schreibend
gar nicht empfinden. Und daß seine Befriedigung trotz künstlerischer Begabung
r oft noch peinlichste Mühen erfordert, kann derselbe Flaubert beweisen. Da
Sar Goethe gesagt hat: »Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren«, so
eint der Deutsche noch weniger Aussicht auf einen wahren Sprachausdruck
'"er Vorstellungen zu haben als der Franzose, und in Italien ist die Geschichte
künstlerischen Ausdrucksmühen von Geistern wie Alfieri und Manzoni zur Ge-
n"ge behandelt.
li h trabalza dagegen mit der unbedingt individualisierenden Auffassung sprach-
en Ausdrucks vollen Ernst macht, zeigt er bei der Besprechung der orthographi-