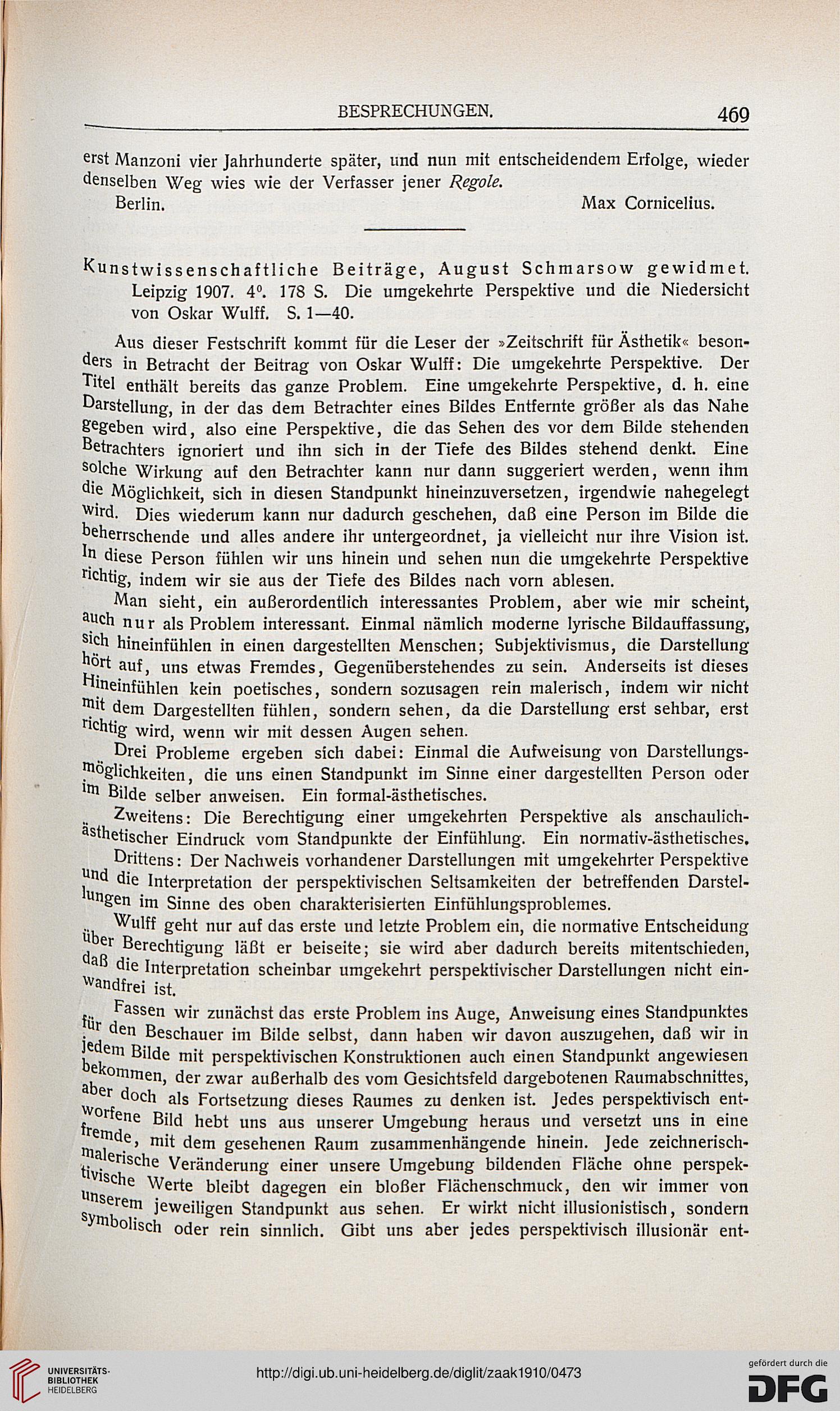BESPRECHUNGEN. 4gg
erst Manzoni vier Jahrhunderte später, und nun mit entscheidendem Erfolge, wieder
denselben Weg wies wie der Verfasser jener Regole.
Berlin. Max Cornicelius.
Kunstwissenschaftliche Beiträge, August Schmarsow gewidmet.
Leipzig 1907. 4°. 178 S. Die umgekehrte Perspektive und die Niedersicht
von Oskar Wulff. S. 1—40.
Aus dieser Festschrift kommt für die Leser der »Zeitschrift für Ästhetik« beson-
ders in Betracht der Beitrag von Oskar Wulff: Die umgekehrte Perspektive. Der
Titel enthält bereits das ganze Problem. Eine umgekehrte Perspektive, d. h. eine
Darstellung, in der das dem Betrachter eines Bildes Entfernte größer als das Nahe
Segeben wird, also eine Perspektive, die das Sehen des vor dem Bilde stehenden
Betrachters ignoriert und ihn sich in der Tiefe des Bildes stehend denkt. Eine
solche Wirkung auf den Betrachter kann nur dann suggeriert werden, wenn ihm
die Möglichkeit, sich in diesen Standpunkt hineinzuversetzen, irgendwie nahegelegt
W|rd. Dies wiederum kann nur dadurch geschehen, daß eine Person im Bilde die
beherrschende und alles andere ihr untergeordnet, ja vielleicht nur ihre Vision ist.
n diese Person fühlen wir uns hinein und sehen nun die umgekehrte Perspektive
1Cntig, indem wir sie aus der Tiefe des Bildes nach vorn ablesen.
Man sieht, ein außerordentlich interessantes Problem, aber wie mir scheint,
uch nur als Problem interessant. Einmal nämlich moderne lyrische Bildauffassung,
ch hineinfühlen in einen dargestellten Menschen; Subjektivismus, die Darstellung
°rt auf, uns etwas Fremdes, Gegenüberstehendes zu sein. Anderseits ist dieses
"jrteinfühlen kein poetisches, sondern sozusagen rein malerisch, indem wir nicht
7" dem Dargestellten fühlen, sondern sehen, da die Darstellung erst sehbar, erst
•cntig wird, wenn wir mit dessen Augen sehen.
Drei Probleme ergeben sich dabei: Einmal die Aufweisung von Darstellungs-
. °glichkeiten, die uns einen Standpunkt im Sinne einer dargestellten Person oder
m Bilde selber anweisen. Ein formal-ästhetisches.
Zweitens: Die Berechtigung einer umgekehrten Perspektive als anschaulich-
"etischer Eindruck vom Standpunkte der Einfühlung. Ein normativ-ästhetisches,
Drittens: Der Nachweis vorhandener Darstellungen mit umgekehrter Perspektive
a die Interpretation der perspektivischen Seltsamkeiten der betreffenden Darstel-
len im Sinne des oben charakterisierten Einfühlungsproblemes.
Wulff geht nur auf das erste und letzte Problem ein, die normative Entscheidung
er Berechtigung läßt er beiseite; sie wird aber dadurch bereits mitentschieden,
die Interpretation scheinbar umgekehrt perspektivischer Darstellungen nicht ein-
wandfrei ist.
j„ fassen wir zunächst das erste Problem ins Auge, Anweisung eines Standpunktes
den Beschauer im Bilde selbst, dann haben wir davon auszugehen, daß wir in
ni Bilde mit perspektivischen Konstruktionen auch einen Standpunkt angewiesen
ornmen, der zwar außerhalb des vom Gesichtsfeld dargebotenen Raumabschnittes,
doch als Fortsetzung dieses Raumes zu denken ist. Jedes perspektivisch ent-
. ene Bild hebt uns aus unserer Umgebung heraus und versetzt uns in eine
m l • m'* ^em Seserienen Raum zusammenhängende hinein. Jede zeichnerisch-
tiv" nscne Veränderung einer unsere Umgebung bildenden Fläche ohne perspek-
Un le ^Verte bleibt dagegen ein bloßer Flächenschmuck, den wir immer von
sv i^™ jeweiligen Standpunkt aus sehen. Er wirkt nicht illusionistisch, sondern
oi'sch oder rein sinnlich. Gibt uns aber jedes perspektivisch illusionär ent-
erst Manzoni vier Jahrhunderte später, und nun mit entscheidendem Erfolge, wieder
denselben Weg wies wie der Verfasser jener Regole.
Berlin. Max Cornicelius.
Kunstwissenschaftliche Beiträge, August Schmarsow gewidmet.
Leipzig 1907. 4°. 178 S. Die umgekehrte Perspektive und die Niedersicht
von Oskar Wulff. S. 1—40.
Aus dieser Festschrift kommt für die Leser der »Zeitschrift für Ästhetik« beson-
ders in Betracht der Beitrag von Oskar Wulff: Die umgekehrte Perspektive. Der
Titel enthält bereits das ganze Problem. Eine umgekehrte Perspektive, d. h. eine
Darstellung, in der das dem Betrachter eines Bildes Entfernte größer als das Nahe
Segeben wird, also eine Perspektive, die das Sehen des vor dem Bilde stehenden
Betrachters ignoriert und ihn sich in der Tiefe des Bildes stehend denkt. Eine
solche Wirkung auf den Betrachter kann nur dann suggeriert werden, wenn ihm
die Möglichkeit, sich in diesen Standpunkt hineinzuversetzen, irgendwie nahegelegt
W|rd. Dies wiederum kann nur dadurch geschehen, daß eine Person im Bilde die
beherrschende und alles andere ihr untergeordnet, ja vielleicht nur ihre Vision ist.
n diese Person fühlen wir uns hinein und sehen nun die umgekehrte Perspektive
1Cntig, indem wir sie aus der Tiefe des Bildes nach vorn ablesen.
Man sieht, ein außerordentlich interessantes Problem, aber wie mir scheint,
uch nur als Problem interessant. Einmal nämlich moderne lyrische Bildauffassung,
ch hineinfühlen in einen dargestellten Menschen; Subjektivismus, die Darstellung
°rt auf, uns etwas Fremdes, Gegenüberstehendes zu sein. Anderseits ist dieses
"jrteinfühlen kein poetisches, sondern sozusagen rein malerisch, indem wir nicht
7" dem Dargestellten fühlen, sondern sehen, da die Darstellung erst sehbar, erst
•cntig wird, wenn wir mit dessen Augen sehen.
Drei Probleme ergeben sich dabei: Einmal die Aufweisung von Darstellungs-
. °glichkeiten, die uns einen Standpunkt im Sinne einer dargestellten Person oder
m Bilde selber anweisen. Ein formal-ästhetisches.
Zweitens: Die Berechtigung einer umgekehrten Perspektive als anschaulich-
"etischer Eindruck vom Standpunkte der Einfühlung. Ein normativ-ästhetisches,
Drittens: Der Nachweis vorhandener Darstellungen mit umgekehrter Perspektive
a die Interpretation der perspektivischen Seltsamkeiten der betreffenden Darstel-
len im Sinne des oben charakterisierten Einfühlungsproblemes.
Wulff geht nur auf das erste und letzte Problem ein, die normative Entscheidung
er Berechtigung läßt er beiseite; sie wird aber dadurch bereits mitentschieden,
die Interpretation scheinbar umgekehrt perspektivischer Darstellungen nicht ein-
wandfrei ist.
j„ fassen wir zunächst das erste Problem ins Auge, Anweisung eines Standpunktes
den Beschauer im Bilde selbst, dann haben wir davon auszugehen, daß wir in
ni Bilde mit perspektivischen Konstruktionen auch einen Standpunkt angewiesen
ornmen, der zwar außerhalb des vom Gesichtsfeld dargebotenen Raumabschnittes,
doch als Fortsetzung dieses Raumes zu denken ist. Jedes perspektivisch ent-
. ene Bild hebt uns aus unserer Umgebung heraus und versetzt uns in eine
m l • m'* ^em Seserienen Raum zusammenhängende hinein. Jede zeichnerisch-
tiv" nscne Veränderung einer unsere Umgebung bildenden Fläche ohne perspek-
Un le ^Verte bleibt dagegen ein bloßer Flächenschmuck, den wir immer von
sv i^™ jeweiligen Standpunkt aus sehen. Er wirkt nicht illusionistisch, sondern
oi'sch oder rein sinnlich. Gibt uns aber jedes perspektivisch illusionär ent-