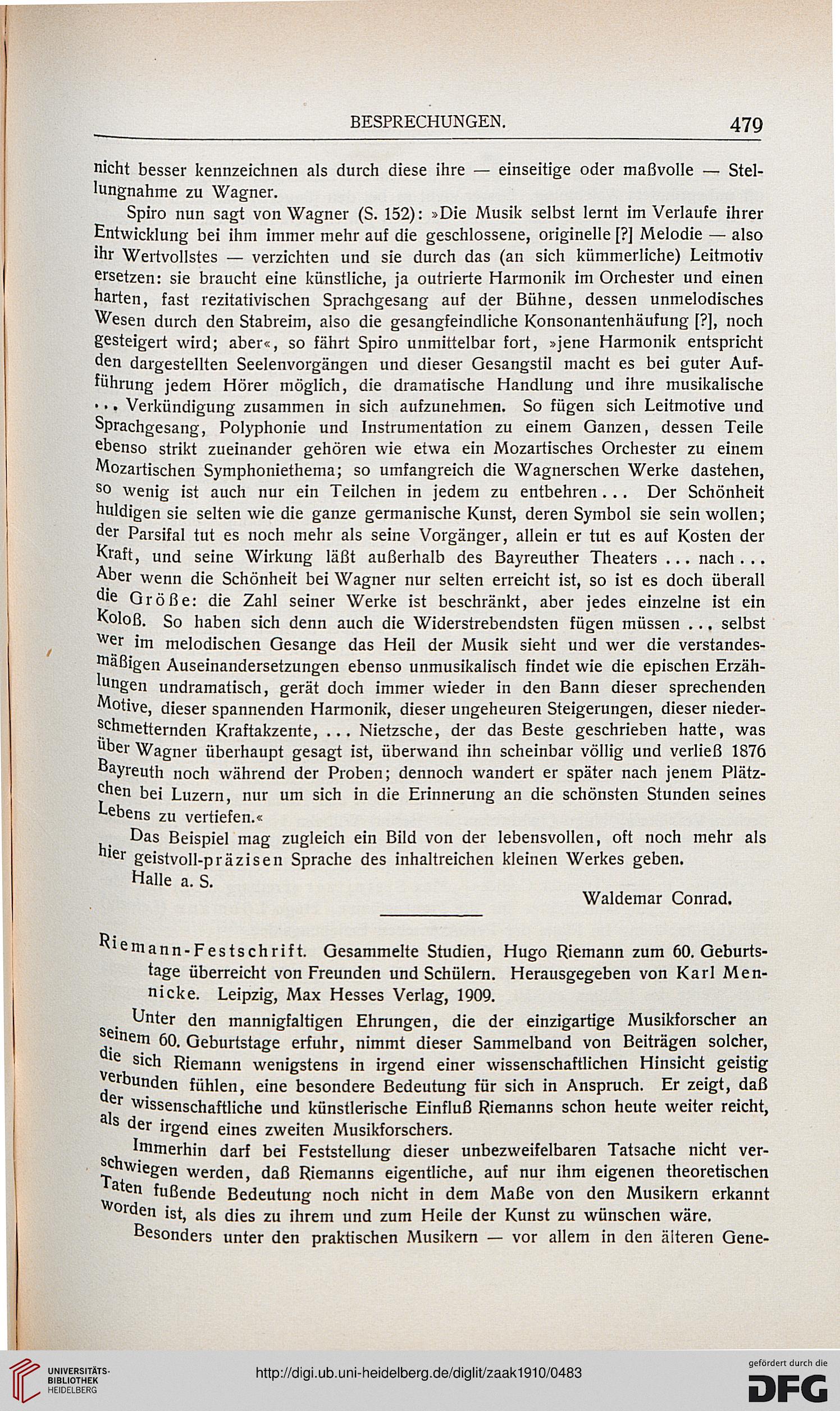BESPRECHUNGEN. 479
nicht besser kennzeichnen als durch diese ihre — einseitige oder maßvolle — Stel-
lungnahme zu Wagner.
Spiro nun sagt von Wagner (S. 152): »Die Musik selbst lernt im Verlaufe ihrer
Entwicklung bei ihm immer mehr auf die geschlossene, originelle [?] Melodie — also
ihr Wertvollstes — verzichten und sie durch das (an sich kümmerliche) Leitmotiv
ersetzen: sie braucht eine künstliche, ja outrierte Harmonik im Orchester und einen
harten, fast rezitativischen Sprachgesang auf der Bühne, dessen unmelodisches
Wesen durch den Stabreim, also die gesangfeindliche Konsonantenhäufung [?], noch
gesteigert wird; aber«, so fährt Spiro unmittelbar fort, »jene Harmonik entspricht
den dargestellten Seelenvorgängen und dieser Gesangstil macht es bei guter Auf-
führung jedem Hörer möglich, die dramatische Handlung und ihre musikalische
• •. Verkündigung zusammen in sich aufzunehmen. So fügen sich Leitmotive und
Sprachgesang, Polyphonie und Instrumentation zu einem Ganzen, dessen Teile
ebenso strikt zueinander gehören wie etwa ein Mozartisches Orchester zu einem
Mozartischen Symphoniethema; so umfangreich die Wagnerschen Werke dastehen,
so wenig ist auch nur ein Teilchen in jedem zu entbehren . . . Der Schönheit
huldigen sie selten wie die ganze germanische Kunst, deren Symbol sie sein wollen;
der Parsifal tut es noch mehr als seine Vorgänger, allein er tut es auf Kosten der
Kraft, und seine Wirkung läßt außerhalb des Bayreuther Theaters . .. nach . ..
Aber wenn die Schönheit bei Wagner nur selten erreicht ist, so ist es doch überall
°le Größe: die Zahl seiner Werke ist beschränkt, aber jedes einzelne ist ein
Koloß. So haben sich denn auch die Widerstrebendsten fügen müssen . .. selbst
wer im melodischen Gesänge das Heil der Musik sieht und wer die verstandes-
jnaßigen Auseinandersetzungen ebenso unmusikalisch findet wie die epischen Erzäh-
lungen undramatisch, gerät doch immer wieder in den Bann dieser sprechenden
Motive, dieser spannenden Harmonik, dieser ungeheuren Steigerungen, dieser nieder-
Schmetternden Kraftakzente, . . . Nietzsche, der das Beste geschrieben hatte, was
über Wagner überhaupt gesagt ist, überwand ihn scheinbar völlig und verließ 1876
Bayreuth noch während der Proben; dennoch wandert er später nach jenem Plätz-
chen bei Luzern, nur um sich in die Erinnerung an die schönsten Stunden seines
Lebens zu vertiefen.«
Das Beispiel mag zugleich ein Bild von der lebensvollen, oft noch mehr als
ler geistvoll-präzisen Sprache des inhaltreichen kleinen Werkes geben.
Halle a. S.
Waldemar Conrad.
lemann-Festschrift. Gesammelte Studien, Hugo Riemann zum 60. Geburts-
tage überreicht von Freunden und Schülern. Herausgegeben von Karl Men-
nicke. Leipzig, Max Hesses Verlag, 1909.
_ Unter den mannigfaltigen Ehrungen, die der einzigartige Musikforscher an
mem 60. Geburtstage erfuhr, nimmt dieser Sammelband von Beiträgen solcher,
e sich Riemann wenigstens in irgend einer wissenschaftlichen Hinsicht geistig
wunden fühlen, eine besondere Bedeutung für sich in Anspruch. Er zeigt, daß
er wissenschaftliche und künstlerische Einfluß Riemanns schon heute weiter reicht,
der irgend eines zweiten Musikforschers.
Immerhin darf bei Feststellung dieser unbezweifelbaren Tatsache nicht ver-
wiegen werden, daß Riemanns eigentliche, auf nur ihm eigenen theoretischen
ten fußende Bedeutung noch nicht in dem Maße von den Musikern erkannt
rden ist, als dies zu ihrem und zum Heile der Kunst zu wünschen wäre.
Besonders unter den praktischen Musikern — vor allem in den älteren Gene-
nicht besser kennzeichnen als durch diese ihre — einseitige oder maßvolle — Stel-
lungnahme zu Wagner.
Spiro nun sagt von Wagner (S. 152): »Die Musik selbst lernt im Verlaufe ihrer
Entwicklung bei ihm immer mehr auf die geschlossene, originelle [?] Melodie — also
ihr Wertvollstes — verzichten und sie durch das (an sich kümmerliche) Leitmotiv
ersetzen: sie braucht eine künstliche, ja outrierte Harmonik im Orchester und einen
harten, fast rezitativischen Sprachgesang auf der Bühne, dessen unmelodisches
Wesen durch den Stabreim, also die gesangfeindliche Konsonantenhäufung [?], noch
gesteigert wird; aber«, so fährt Spiro unmittelbar fort, »jene Harmonik entspricht
den dargestellten Seelenvorgängen und dieser Gesangstil macht es bei guter Auf-
führung jedem Hörer möglich, die dramatische Handlung und ihre musikalische
• •. Verkündigung zusammen in sich aufzunehmen. So fügen sich Leitmotive und
Sprachgesang, Polyphonie und Instrumentation zu einem Ganzen, dessen Teile
ebenso strikt zueinander gehören wie etwa ein Mozartisches Orchester zu einem
Mozartischen Symphoniethema; so umfangreich die Wagnerschen Werke dastehen,
so wenig ist auch nur ein Teilchen in jedem zu entbehren . . . Der Schönheit
huldigen sie selten wie die ganze germanische Kunst, deren Symbol sie sein wollen;
der Parsifal tut es noch mehr als seine Vorgänger, allein er tut es auf Kosten der
Kraft, und seine Wirkung läßt außerhalb des Bayreuther Theaters . .. nach . ..
Aber wenn die Schönheit bei Wagner nur selten erreicht ist, so ist es doch überall
°le Größe: die Zahl seiner Werke ist beschränkt, aber jedes einzelne ist ein
Koloß. So haben sich denn auch die Widerstrebendsten fügen müssen . .. selbst
wer im melodischen Gesänge das Heil der Musik sieht und wer die verstandes-
jnaßigen Auseinandersetzungen ebenso unmusikalisch findet wie die epischen Erzäh-
lungen undramatisch, gerät doch immer wieder in den Bann dieser sprechenden
Motive, dieser spannenden Harmonik, dieser ungeheuren Steigerungen, dieser nieder-
Schmetternden Kraftakzente, . . . Nietzsche, der das Beste geschrieben hatte, was
über Wagner überhaupt gesagt ist, überwand ihn scheinbar völlig und verließ 1876
Bayreuth noch während der Proben; dennoch wandert er später nach jenem Plätz-
chen bei Luzern, nur um sich in die Erinnerung an die schönsten Stunden seines
Lebens zu vertiefen.«
Das Beispiel mag zugleich ein Bild von der lebensvollen, oft noch mehr als
ler geistvoll-präzisen Sprache des inhaltreichen kleinen Werkes geben.
Halle a. S.
Waldemar Conrad.
lemann-Festschrift. Gesammelte Studien, Hugo Riemann zum 60. Geburts-
tage überreicht von Freunden und Schülern. Herausgegeben von Karl Men-
nicke. Leipzig, Max Hesses Verlag, 1909.
_ Unter den mannigfaltigen Ehrungen, die der einzigartige Musikforscher an
mem 60. Geburtstage erfuhr, nimmt dieser Sammelband von Beiträgen solcher,
e sich Riemann wenigstens in irgend einer wissenschaftlichen Hinsicht geistig
wunden fühlen, eine besondere Bedeutung für sich in Anspruch. Er zeigt, daß
er wissenschaftliche und künstlerische Einfluß Riemanns schon heute weiter reicht,
der irgend eines zweiten Musikforschers.
Immerhin darf bei Feststellung dieser unbezweifelbaren Tatsache nicht ver-
wiegen werden, daß Riemanns eigentliche, auf nur ihm eigenen theoretischen
ten fußende Bedeutung noch nicht in dem Maße von den Musikern erkannt
rden ist, als dies zu ihrem und zum Heile der Kunst zu wünschen wäre.
Besonders unter den praktischen Musikern — vor allem in den älteren Gene-