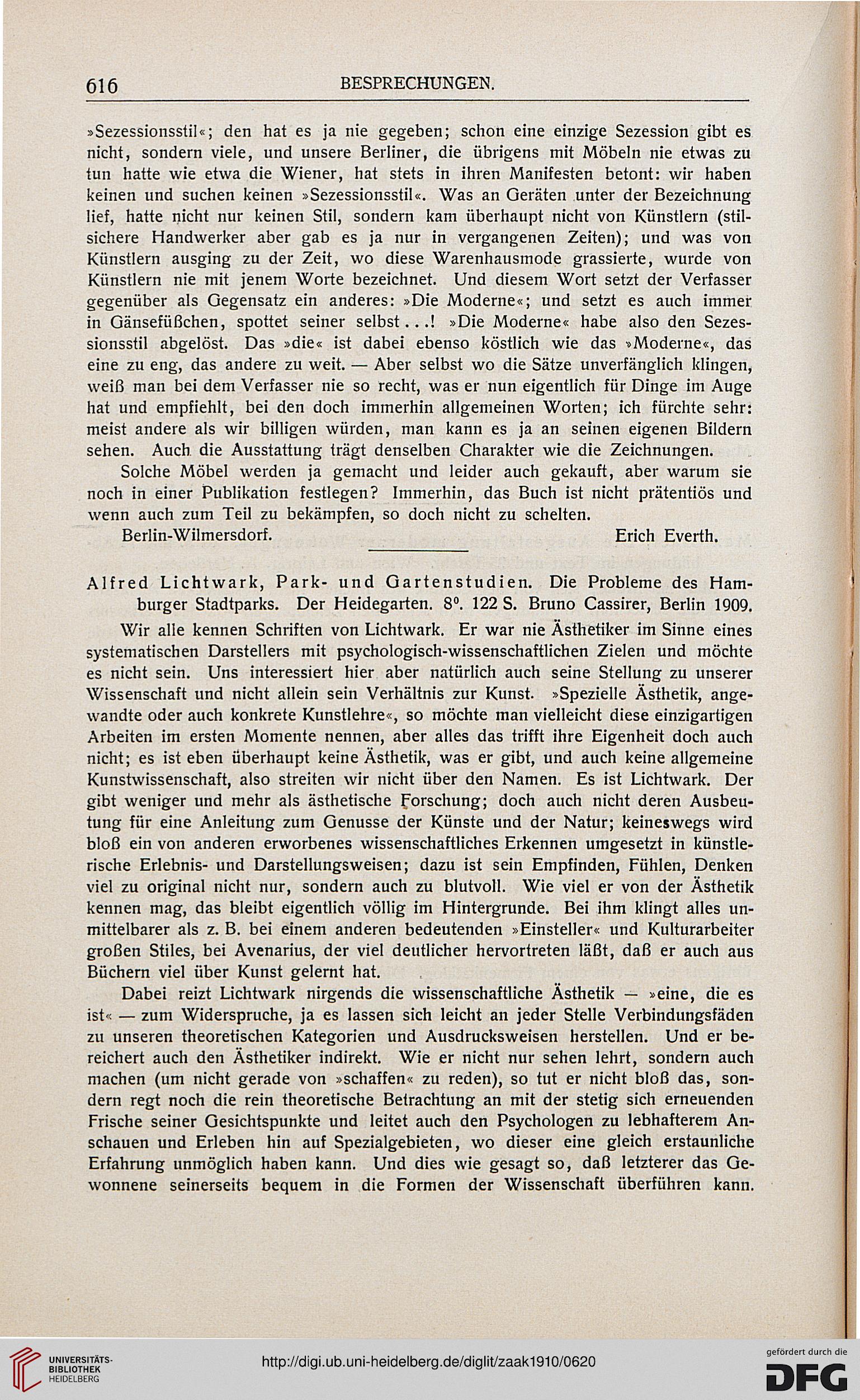616 BESPRECHUNGEN.
»Sezessionsstil«; den hat es ja nie gegeben; schon eine einzige Sezession gibt es
nicht, sondern viele, und unsere Berliner, die übrigens mit Möbeln nie etwas zu
tun hatte wie etwa die Wiener, hat stets in ihren Manifesten betont: wir haben
keinen und suchen keinen »Sezessionsstil«. Was an Geräten unter der Bezeichnung
lief, hatte nicht nur keinen Stil, sondern kam überhaupt nicht von Künstlern (stil-
sichere Handwerker aber gab es ja nur in vergangenen Zeiten); und was von
Künstlern ausging zu der Zeit, wo diese Warenhausmode grassierte, wurde von
Künstlern nie mit jenem Worte bezeichnet. Und diesem Wort setzt der Verfasser
gegenüber als Gegensatz ein anderes: »Die Moderne«; und setzt es auch immer
in Gänsefüßchen, spottet seiner selbst...! »Die Moderne« habe also den Sezes-
sionsstil abgelöst. Das »die« ist dabei ebenso köstlich wie das »Moderne«, das
eine zu eng, das andere zu weit. — Aber selbst wo die Sätze unverfänglich klingen,
weiß man bei dem Verfasser nie so recht, was er nun eigentlich für Dinge im Auge
hat und empfiehlt, bei den doch immerhin allgemeinen Worten; ich fürchte sehr:
meist andere als wir billigen würden, man kann es ja an seinen eigenen Bildern
sehen. Auch die Ausstattung trägt denselben Charakter wie die Zeichnungen.
Solche Möbel werden ja gemacht und leider auch gekauft, aber warum sie
noch in einer Publikation festlegen? Immerhin, das Buch ist nicht prätentiös und
wenn auch zum Teil zu bekämpfen, so doch nicht zu schelten.
Berlin-Wilmersdorf. Erich Everth.
Alfred Lichtwark, Park- und Gartenstudien. Die Probleme des Ham-
burger Stadtparks. Der Heidegarten. 8°. 122 S. Bruno Cassirer, Berlin 1909.
Wir alle kennen Schriften von Lichtwark. Er war nie Ästhetiker im Sinne eines
systematischen Darstellers mit psychologisch-wissenschaftlichen Zielen und möchte
es nicht sein. Uns interessiert hier aber natürlich auch seine Stellung zu unserer
Wissenschaft und nicht allein sein Verhältnis zur Kunst. »Spezielle Ästhetik, ange-
wandte oder auch konkrete Kunstlehre«, so möchte man vielleicht diese einzigartigen
Arbeiten im ersten Momente nennen, aber alles das trifft ihre Eigenheit doch auch
nicht; es ist eben überhaupt keine Ästhetik, was er gibt, und auch keine allgemeine
Kunstwissenschaft, also streiten wir nicht über den Namen. Es ist Lichtwark. Der
gibt weniger und mehr als ästhetische Forschung; doch auch nicht deren Ausbeu-
tung für eine Anleitung zum Genüsse der Künste und der Natur; keineswegs wird
bloß ein von anderen erworbenes wissenschaftliches Erkennen umgesetzt in künstle-
rische Erlebnis- und Darstellungsweisen; dazu ist sein Empfinden, Fühlen, Denken
viel zu original nicht nur, sondern auch zu blutvoll. Wie viel er von der Ästhetik
kennen mag, das bleibt eigentlich völlig im Hintergrunde. Bei ihm klingt alles un-
mittelbarer als z. B. bei einem anderen bedeutenden »Einsteller« und Kulturarbeiter
großen Stiles, bei Avenarius, der viel deutlicher hervortreten läßt, daß er auch aus
Büchern viel über Kunst gelernt hat.
Dabei reizt Lichtwark nirgends die wissenschaftliche Ästhetik — »eine, die es
ist« — zum Widerspruche, ja es lassen sich leicht an jeder Stelle Verbindungsfäden
zu unseren theoretischen Kategorien und Ausdrucksweisen herstellen. Und er be-
reichert auch den Ästhetiker indirekt. Wie er nicht nur sehen lehrt, sondern auch
machen (um nicht gerade von »schaffen« zu reden), so tut er nicht bloß das, son-
dern regt noch die rein theoretische Betrachtung an mit der stetig sich erneuenden
Frische seiner Gesichtspunkte und leitet auch den Psychologen zu lebhafterem An-
schauen und Erleben hin auf Spezialgebieten, wo dieser eine gleich erstaunliche
Erfahrung unmöglich haben kann. Und dies wie gesagt so, daß letzterer das Ge-
wonnene seinerseits bequem in die Formen der Wissenschaft überführen kann.
»Sezessionsstil«; den hat es ja nie gegeben; schon eine einzige Sezession gibt es
nicht, sondern viele, und unsere Berliner, die übrigens mit Möbeln nie etwas zu
tun hatte wie etwa die Wiener, hat stets in ihren Manifesten betont: wir haben
keinen und suchen keinen »Sezessionsstil«. Was an Geräten unter der Bezeichnung
lief, hatte nicht nur keinen Stil, sondern kam überhaupt nicht von Künstlern (stil-
sichere Handwerker aber gab es ja nur in vergangenen Zeiten); und was von
Künstlern ausging zu der Zeit, wo diese Warenhausmode grassierte, wurde von
Künstlern nie mit jenem Worte bezeichnet. Und diesem Wort setzt der Verfasser
gegenüber als Gegensatz ein anderes: »Die Moderne«; und setzt es auch immer
in Gänsefüßchen, spottet seiner selbst...! »Die Moderne« habe also den Sezes-
sionsstil abgelöst. Das »die« ist dabei ebenso köstlich wie das »Moderne«, das
eine zu eng, das andere zu weit. — Aber selbst wo die Sätze unverfänglich klingen,
weiß man bei dem Verfasser nie so recht, was er nun eigentlich für Dinge im Auge
hat und empfiehlt, bei den doch immerhin allgemeinen Worten; ich fürchte sehr:
meist andere als wir billigen würden, man kann es ja an seinen eigenen Bildern
sehen. Auch die Ausstattung trägt denselben Charakter wie die Zeichnungen.
Solche Möbel werden ja gemacht und leider auch gekauft, aber warum sie
noch in einer Publikation festlegen? Immerhin, das Buch ist nicht prätentiös und
wenn auch zum Teil zu bekämpfen, so doch nicht zu schelten.
Berlin-Wilmersdorf. Erich Everth.
Alfred Lichtwark, Park- und Gartenstudien. Die Probleme des Ham-
burger Stadtparks. Der Heidegarten. 8°. 122 S. Bruno Cassirer, Berlin 1909.
Wir alle kennen Schriften von Lichtwark. Er war nie Ästhetiker im Sinne eines
systematischen Darstellers mit psychologisch-wissenschaftlichen Zielen und möchte
es nicht sein. Uns interessiert hier aber natürlich auch seine Stellung zu unserer
Wissenschaft und nicht allein sein Verhältnis zur Kunst. »Spezielle Ästhetik, ange-
wandte oder auch konkrete Kunstlehre«, so möchte man vielleicht diese einzigartigen
Arbeiten im ersten Momente nennen, aber alles das trifft ihre Eigenheit doch auch
nicht; es ist eben überhaupt keine Ästhetik, was er gibt, und auch keine allgemeine
Kunstwissenschaft, also streiten wir nicht über den Namen. Es ist Lichtwark. Der
gibt weniger und mehr als ästhetische Forschung; doch auch nicht deren Ausbeu-
tung für eine Anleitung zum Genüsse der Künste und der Natur; keineswegs wird
bloß ein von anderen erworbenes wissenschaftliches Erkennen umgesetzt in künstle-
rische Erlebnis- und Darstellungsweisen; dazu ist sein Empfinden, Fühlen, Denken
viel zu original nicht nur, sondern auch zu blutvoll. Wie viel er von der Ästhetik
kennen mag, das bleibt eigentlich völlig im Hintergrunde. Bei ihm klingt alles un-
mittelbarer als z. B. bei einem anderen bedeutenden »Einsteller« und Kulturarbeiter
großen Stiles, bei Avenarius, der viel deutlicher hervortreten läßt, daß er auch aus
Büchern viel über Kunst gelernt hat.
Dabei reizt Lichtwark nirgends die wissenschaftliche Ästhetik — »eine, die es
ist« — zum Widerspruche, ja es lassen sich leicht an jeder Stelle Verbindungsfäden
zu unseren theoretischen Kategorien und Ausdrucksweisen herstellen. Und er be-
reichert auch den Ästhetiker indirekt. Wie er nicht nur sehen lehrt, sondern auch
machen (um nicht gerade von »schaffen« zu reden), so tut er nicht bloß das, son-
dern regt noch die rein theoretische Betrachtung an mit der stetig sich erneuenden
Frische seiner Gesichtspunkte und leitet auch den Psychologen zu lebhafterem An-
schauen und Erleben hin auf Spezialgebieten, wo dieser eine gleich erstaunliche
Erfahrung unmöglich haben kann. Und dies wie gesagt so, daß letzterer das Ge-
wonnene seinerseits bequem in die Formen der Wissenschaft überführen kann.