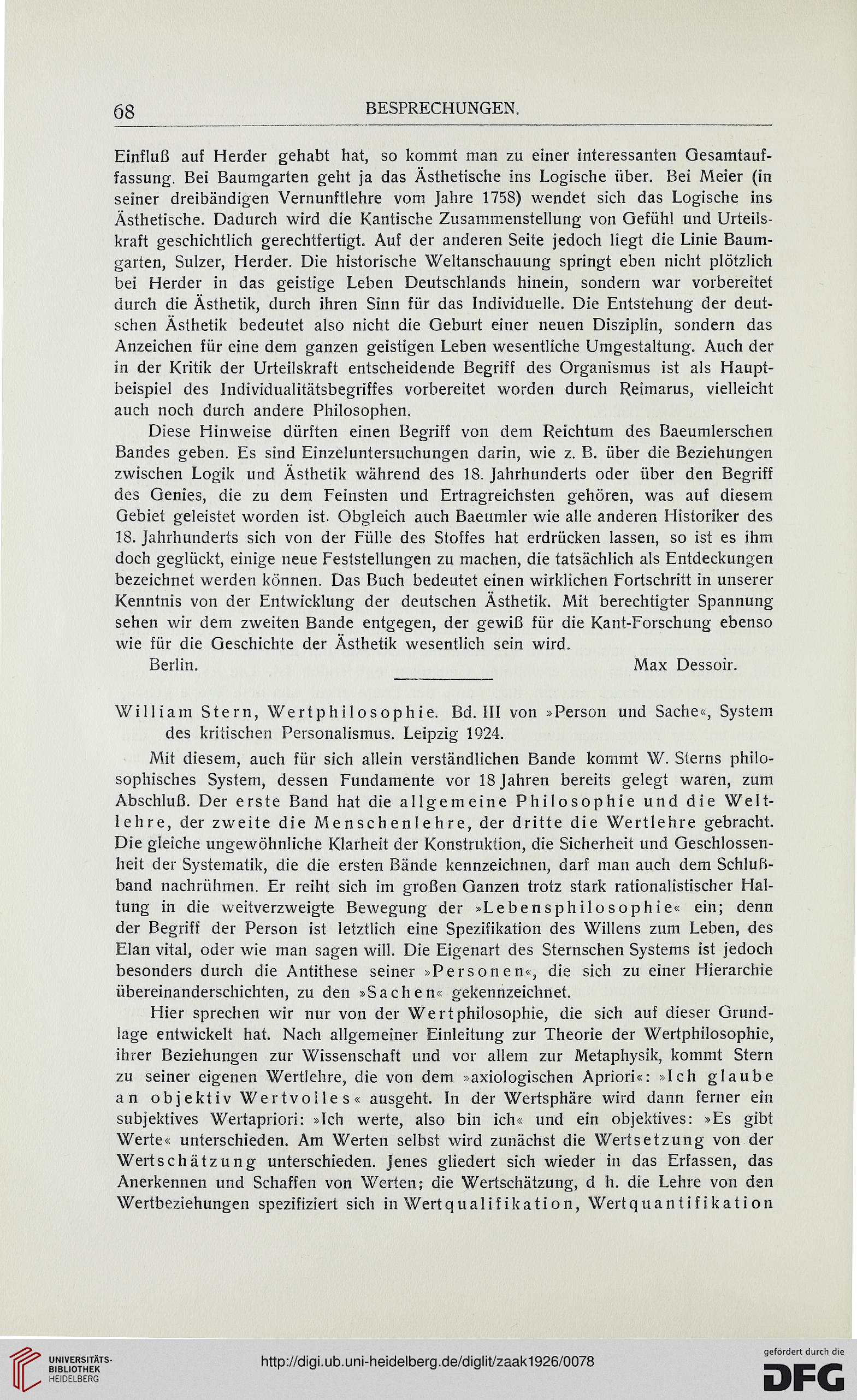68
BESPRECHUNGEN.
Einfluß auf Herder gehabt hat, so kommt man zu einer interessanten Gesamtauf-
fassung. Bei Baumgarten geht ja das Ästhetische ins Logische über. Bei Meier (in
seiner dreibändigen Vernunftlehre vom Jahre 1758) wendet sich das Logische ins
Ästhetische. Dadurch wird die Kantische Zusammenstellung von Gefühl und Urteils-
kraft geschichtlich gerechtfertigt. Auf der anderen Seite jedoch liegt die Linie Baum-
garten, Sulzer, Herder. Die historische Weltanschauung springt eben nicht plötzlich
bei Herder in das geistige Leben Deutschlands hinein, sondern war vorbereitet
durch die Ästhetik, durch ihren Sinn für das Individuelle. Die Entstehung der deut-
schen Ästhetik bedeutet also nicht die Geburt einer neuen Disziplin, sondern das
Anzeichen für eine dem ganzen geistigen Leben wesentliche Umgestaltung. Auch der
in der Kritik der Urteilskraft entscheidende Begriff des Organismus ist als Haupt-
beispiel des Individualitätsbegriffes vorbereitet worden durch Reimarus, vielleicht
auch noch durch andere Philosophen.
Diese Hinweise dürften einen Begriff von dem Reichtum des Baeumlerschen
Bandes geben. Es sind Einzeluntersuchungen darin, wie z. B. über die Beziehungen
zwischen Logik und Ästhetik während des 18. Jahrhunderts oder über den Begriff
des Genies, die zu dem Feinsten und Ertragreichsten gehören, was auf diesem
Gebiet geleistet worden ist. Obgleich auch Baeumler wie alle anderen Historiker des
18. Jahrhunderts sich von der Fülle des Stoffes hat erdrücken lassen, so ist es ihm
doch geglückt, einige neue Feststellungen zu machen, die tatsächlich als Entdeckungen
bezeichnet werden können. Das Buch bedeutet einen wirklichen Fortschritt in unserer
Kenntnis von der Entwicklung der deutschen Ästhetik. Mit berechtigter Spannung
sehen wir dem zweiten Bande entgegen, der gewiß für die Kant-Forschung ebenso
wie für die Geschichte der Ästhetik wesentlich sein wird.
Berlin. Max Dessoir.
William Stern, Wertphilosophie. Bd. III von »Person und Sache«, System
des kritischen Personalismus. Leipzig 1924.
Mit diesem, auch für sich allein verständlichen Bande kommt W. Sterns philo-
sophisches System, dessen Fundamente vor 18 Jahren bereits gelegt waren, zum
Abschluß. Der erste Band hat die allgemeine Philosophie und die Welt-
lehre, der zweite die Menschenlehre, der dritte die Wertlehre gebracht.
Die gleiche ungewöhnliche Klarheit der Konstruktion, die Sicherheit und Geschlossen-
heit der Systematik, die die ersten Bände kennzeichnen, darf man auch dem Schluß-
band nachrühmen. Er reiht sich im großen Ganzen trotz stark rationalistischer Hal-
tung in die weitverzweigte Bewegung der »Lebensphilosophie« ein; denn
der Begriff der Person ist letztlich eine Spezifikation des Willens zum Leben, des
Elan vital, oder wie man sagen will. Die Eigenart des Sternschen Systems ist jedoch
besonders durch die Antithese seiner »Personen«, die sich zu einer Hierarchie
übereinanderschichten, zu den »Sachen« gekennzeichnet.
Hier sprechen wir nur von der We rt Philosophie, die sich auf dieser Grund-
lage entwickelt hat. Nach allgemeiner Einleitung zur Theorie der Wertphilosophie,
ihrer Beziehungen zur Wissenschaft und vor allem zur Metaphysik, kommt Stern
zu seiner eigenen Wertlehre, die von dem »axiologischen Apriori«: »Ich glaube
an objektiv Wertvolles« ausgeht. In der Wertsphäre wird dann ferner ein
subjektives Wertapriori: »Ich werte, also bin ich« und ein objektives: »Es gibt
Werte« unterschieden. Am Werten selbst wird zunächst die Wertsetzung von der
Wertschätzung unterschieden. Jenes gliedert sich wieder in das Erfassen, das
Anerkennen und Schaffen von Werten; die Wertschätzung, d h. die Lehre von den
Wertbeziehungen spezifiziert sich in Wertqualif ikation, Wertquantifikation
BESPRECHUNGEN.
Einfluß auf Herder gehabt hat, so kommt man zu einer interessanten Gesamtauf-
fassung. Bei Baumgarten geht ja das Ästhetische ins Logische über. Bei Meier (in
seiner dreibändigen Vernunftlehre vom Jahre 1758) wendet sich das Logische ins
Ästhetische. Dadurch wird die Kantische Zusammenstellung von Gefühl und Urteils-
kraft geschichtlich gerechtfertigt. Auf der anderen Seite jedoch liegt die Linie Baum-
garten, Sulzer, Herder. Die historische Weltanschauung springt eben nicht plötzlich
bei Herder in das geistige Leben Deutschlands hinein, sondern war vorbereitet
durch die Ästhetik, durch ihren Sinn für das Individuelle. Die Entstehung der deut-
schen Ästhetik bedeutet also nicht die Geburt einer neuen Disziplin, sondern das
Anzeichen für eine dem ganzen geistigen Leben wesentliche Umgestaltung. Auch der
in der Kritik der Urteilskraft entscheidende Begriff des Organismus ist als Haupt-
beispiel des Individualitätsbegriffes vorbereitet worden durch Reimarus, vielleicht
auch noch durch andere Philosophen.
Diese Hinweise dürften einen Begriff von dem Reichtum des Baeumlerschen
Bandes geben. Es sind Einzeluntersuchungen darin, wie z. B. über die Beziehungen
zwischen Logik und Ästhetik während des 18. Jahrhunderts oder über den Begriff
des Genies, die zu dem Feinsten und Ertragreichsten gehören, was auf diesem
Gebiet geleistet worden ist. Obgleich auch Baeumler wie alle anderen Historiker des
18. Jahrhunderts sich von der Fülle des Stoffes hat erdrücken lassen, so ist es ihm
doch geglückt, einige neue Feststellungen zu machen, die tatsächlich als Entdeckungen
bezeichnet werden können. Das Buch bedeutet einen wirklichen Fortschritt in unserer
Kenntnis von der Entwicklung der deutschen Ästhetik. Mit berechtigter Spannung
sehen wir dem zweiten Bande entgegen, der gewiß für die Kant-Forschung ebenso
wie für die Geschichte der Ästhetik wesentlich sein wird.
Berlin. Max Dessoir.
William Stern, Wertphilosophie. Bd. III von »Person und Sache«, System
des kritischen Personalismus. Leipzig 1924.
Mit diesem, auch für sich allein verständlichen Bande kommt W. Sterns philo-
sophisches System, dessen Fundamente vor 18 Jahren bereits gelegt waren, zum
Abschluß. Der erste Band hat die allgemeine Philosophie und die Welt-
lehre, der zweite die Menschenlehre, der dritte die Wertlehre gebracht.
Die gleiche ungewöhnliche Klarheit der Konstruktion, die Sicherheit und Geschlossen-
heit der Systematik, die die ersten Bände kennzeichnen, darf man auch dem Schluß-
band nachrühmen. Er reiht sich im großen Ganzen trotz stark rationalistischer Hal-
tung in die weitverzweigte Bewegung der »Lebensphilosophie« ein; denn
der Begriff der Person ist letztlich eine Spezifikation des Willens zum Leben, des
Elan vital, oder wie man sagen will. Die Eigenart des Sternschen Systems ist jedoch
besonders durch die Antithese seiner »Personen«, die sich zu einer Hierarchie
übereinanderschichten, zu den »Sachen« gekennzeichnet.
Hier sprechen wir nur von der We rt Philosophie, die sich auf dieser Grund-
lage entwickelt hat. Nach allgemeiner Einleitung zur Theorie der Wertphilosophie,
ihrer Beziehungen zur Wissenschaft und vor allem zur Metaphysik, kommt Stern
zu seiner eigenen Wertlehre, die von dem »axiologischen Apriori«: »Ich glaube
an objektiv Wertvolles« ausgeht. In der Wertsphäre wird dann ferner ein
subjektives Wertapriori: »Ich werte, also bin ich« und ein objektives: »Es gibt
Werte« unterschieden. Am Werten selbst wird zunächst die Wertsetzung von der
Wertschätzung unterschieden. Jenes gliedert sich wieder in das Erfassen, das
Anerkennen und Schaffen von Werten; die Wertschätzung, d h. die Lehre von den
Wertbeziehungen spezifiziert sich in Wertqualif ikation, Wertquantifikation