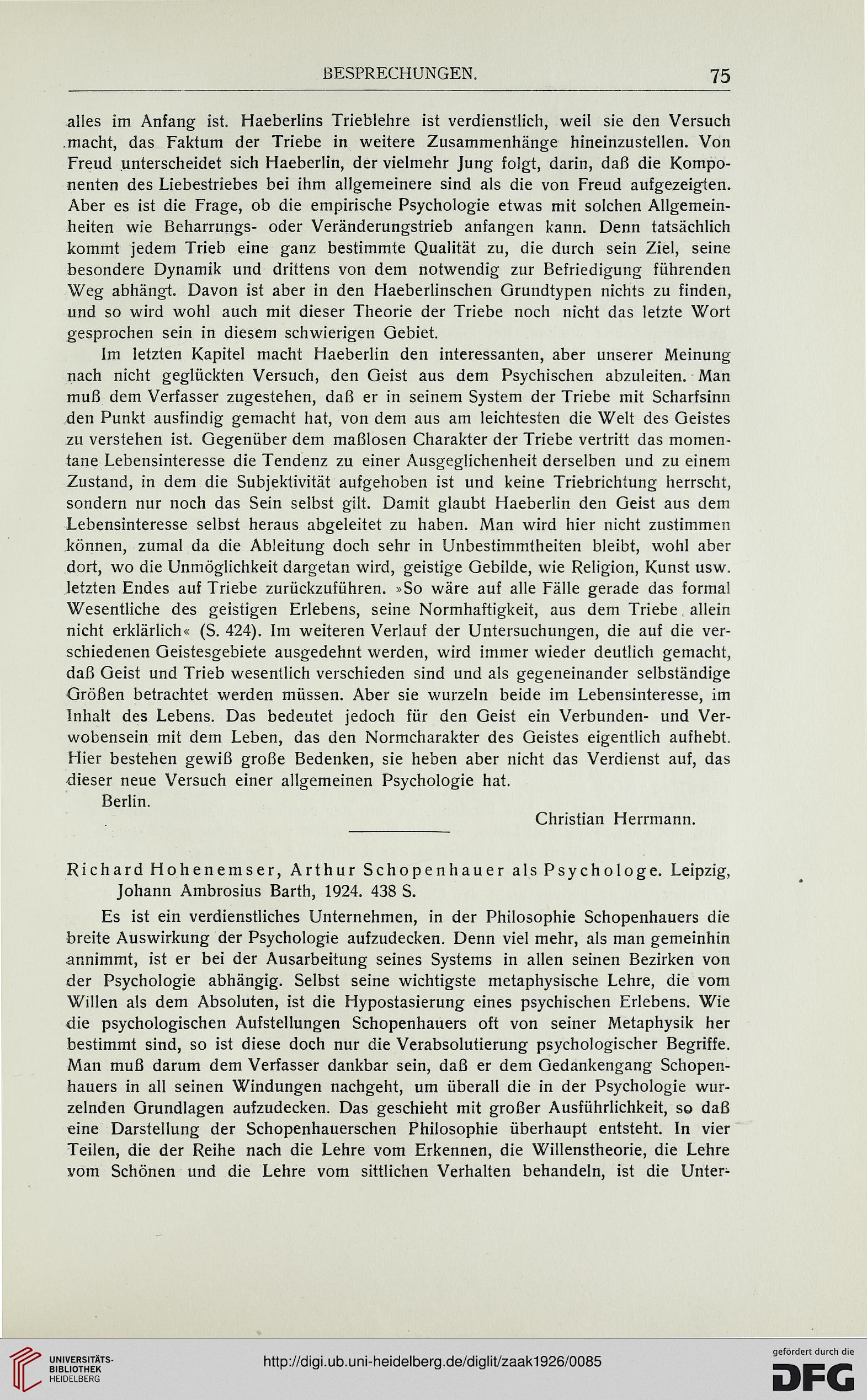BESPRECHUNGEN.
75
alles im Anfang ist. Haeberlins Trieblehre ist verdienstlich, weil sie den Versuch
macht, das Faktum der Triebe in weitere Zusammenhänge hineinzustellen. Von
Freud unterscheidet sich Haeberlin, der vielmehr Jung folgt, darin, daß die Kompo-
nenten des Liebestriebes bei ihm allgemeinere sind als die von Freud aufgezeigten.
Aber es ist die Frage, ob die empirische Psychologie etwas mit solchen Allgemein-
heiten wie Beharrungs- oder Veränderungstrieb anfangen kann. Denn tatsächlich
kommt jedem Trieb eine ganz bestimmte Qualität zu, die durch sein Ziel, seine
besondere Dynamik und drittens von dem notwendig zur Befriedigung führenden
Weg abhängt. Davon ist aber in den Haeberlinschen Grundtypen nichts zu finden,
und so wird wohl auch mit dieser Theorie der Triebe noch nicht das letzte Wort
gesprochen sein in diesem schwierigen Gebiet.
Im letzten Kapitel macht Haeberlin den interessanten, aber unserer Meinung
nach nicht geglückten Versuch, den Geist aus dem Psychischen abzuleiten. Man
muß dem Verfasser zugestehen, daß er in seinem System der Triebe mit Scharfsinn
den Punkt ausfindig gemacht hat, von dem aus am leichtesten die Welt des Geistes
zu verstehen ist. Gegenüber dem maßlosen Charakter der Triebe vertritt das momen-
tane Lebensinteresse die Tendenz zu einer Ausgeglichenheit derselben und zu einem
Zustand, in dem die Subjektivität aufgehoben ist und keine Triebrichtung herrscht,
sondern nur noch das Sein selbst gilt. Damit glaubt Haeberlin den Geist aus dem
Lebensinteresse selbst heraus abgeleitet zu haben. Man wird hier nicht zustimmen
können, zumal da die Ableitung doch sehr in Unbestimmtheiten bleibt, wohl aber
dort, wo die Unmöglichkeit dargetan wird, geistige Gebilde, wie Religion, Kunst usw.
letzten Endes auf Triebe zurückzuführen. »So wäre auf alle Fälle gerade das formal
Wesentliche des geistigen Erlebens, seine Normhaftigkeit, aus dem Triebe allein
nicht erklärlich« (S. 424). Im weiteren Verlauf der Untersuchungen, die auf die ver-
schiedenen Geistesgebiete ausgedehnt werden, wird immer wieder deutlich gemacht,
daß Geist und Trieb wesentlich verschieden sind und als gegeneinander selbständige
Größen betrachtet werden müssen. Aber sie wurzeln beide im Lebensinteresse, im
Inhalt des Lebens. Das bedeutet jedoch für den Geist ein Verbunden- und Ver-
wobensein mit dem Leben, das den Normcharakter des Geistes eigentlich aufhebt.
Hier bestehen gewiß große Bedenken, sie heben aber nicht das Verdienst auf, das
dieser neue Versuch einer allgemeinen Psychologie hat.
Berlin.
Christian Herrmann.
Richard Hohenemser, Arthur Schopenhauer als Psychologe. Leipzig,
Johann Ambrosius Barth, 1924. 438 S.
Es ist ein verdienstliches Unternehmen, in der Philosophie Schopenhauers die
breite Auswirkung der Psychologie aufzudecken. Denn viel mehr, als man gemeinhin
annimmt, ist er bei der Ausarbeitung seines Systems in allen seinen Bezirken von
der Psychologie abhängig. Selbst seine wichtigste metaphysische Lehre, die vom
Willen als dem Absoluten, ist die Hypostasierung eines psychischen Erlebens. Wie
die psychologischen Aufstellungen Schopenhauers oft von seiner Metaphysik her
bestimmt sind, so ist diese doch nur die Verabsolutierung psychologischer Begriffe.
Man muß darum dem Verfasser dankbar sein, daß er dem Gedankengang Schopen-
hauers in all seinen Windungen nachgeht, um überall die in der Psychologie wur-
zelnden Grundlagen aufzudecken. Das geschieht mit großer Ausführlichkeit, so daß
eine Darstellung der Schopenhauerschen Philosophie überhaupt entsteht. In vier
Teilen, die der Reihe nach die Lehre vom Erkennen, die Willenstheorie, die Lehre
vom Schönen und die Lehre vom sittlichen Verhalten behandeln, ist die Unter-
75
alles im Anfang ist. Haeberlins Trieblehre ist verdienstlich, weil sie den Versuch
macht, das Faktum der Triebe in weitere Zusammenhänge hineinzustellen. Von
Freud unterscheidet sich Haeberlin, der vielmehr Jung folgt, darin, daß die Kompo-
nenten des Liebestriebes bei ihm allgemeinere sind als die von Freud aufgezeigten.
Aber es ist die Frage, ob die empirische Psychologie etwas mit solchen Allgemein-
heiten wie Beharrungs- oder Veränderungstrieb anfangen kann. Denn tatsächlich
kommt jedem Trieb eine ganz bestimmte Qualität zu, die durch sein Ziel, seine
besondere Dynamik und drittens von dem notwendig zur Befriedigung führenden
Weg abhängt. Davon ist aber in den Haeberlinschen Grundtypen nichts zu finden,
und so wird wohl auch mit dieser Theorie der Triebe noch nicht das letzte Wort
gesprochen sein in diesem schwierigen Gebiet.
Im letzten Kapitel macht Haeberlin den interessanten, aber unserer Meinung
nach nicht geglückten Versuch, den Geist aus dem Psychischen abzuleiten. Man
muß dem Verfasser zugestehen, daß er in seinem System der Triebe mit Scharfsinn
den Punkt ausfindig gemacht hat, von dem aus am leichtesten die Welt des Geistes
zu verstehen ist. Gegenüber dem maßlosen Charakter der Triebe vertritt das momen-
tane Lebensinteresse die Tendenz zu einer Ausgeglichenheit derselben und zu einem
Zustand, in dem die Subjektivität aufgehoben ist und keine Triebrichtung herrscht,
sondern nur noch das Sein selbst gilt. Damit glaubt Haeberlin den Geist aus dem
Lebensinteresse selbst heraus abgeleitet zu haben. Man wird hier nicht zustimmen
können, zumal da die Ableitung doch sehr in Unbestimmtheiten bleibt, wohl aber
dort, wo die Unmöglichkeit dargetan wird, geistige Gebilde, wie Religion, Kunst usw.
letzten Endes auf Triebe zurückzuführen. »So wäre auf alle Fälle gerade das formal
Wesentliche des geistigen Erlebens, seine Normhaftigkeit, aus dem Triebe allein
nicht erklärlich« (S. 424). Im weiteren Verlauf der Untersuchungen, die auf die ver-
schiedenen Geistesgebiete ausgedehnt werden, wird immer wieder deutlich gemacht,
daß Geist und Trieb wesentlich verschieden sind und als gegeneinander selbständige
Größen betrachtet werden müssen. Aber sie wurzeln beide im Lebensinteresse, im
Inhalt des Lebens. Das bedeutet jedoch für den Geist ein Verbunden- und Ver-
wobensein mit dem Leben, das den Normcharakter des Geistes eigentlich aufhebt.
Hier bestehen gewiß große Bedenken, sie heben aber nicht das Verdienst auf, das
dieser neue Versuch einer allgemeinen Psychologie hat.
Berlin.
Christian Herrmann.
Richard Hohenemser, Arthur Schopenhauer als Psychologe. Leipzig,
Johann Ambrosius Barth, 1924. 438 S.
Es ist ein verdienstliches Unternehmen, in der Philosophie Schopenhauers die
breite Auswirkung der Psychologie aufzudecken. Denn viel mehr, als man gemeinhin
annimmt, ist er bei der Ausarbeitung seines Systems in allen seinen Bezirken von
der Psychologie abhängig. Selbst seine wichtigste metaphysische Lehre, die vom
Willen als dem Absoluten, ist die Hypostasierung eines psychischen Erlebens. Wie
die psychologischen Aufstellungen Schopenhauers oft von seiner Metaphysik her
bestimmt sind, so ist diese doch nur die Verabsolutierung psychologischer Begriffe.
Man muß darum dem Verfasser dankbar sein, daß er dem Gedankengang Schopen-
hauers in all seinen Windungen nachgeht, um überall die in der Psychologie wur-
zelnden Grundlagen aufzudecken. Das geschieht mit großer Ausführlichkeit, so daß
eine Darstellung der Schopenhauerschen Philosophie überhaupt entsteht. In vier
Teilen, die der Reihe nach die Lehre vom Erkennen, die Willenstheorie, die Lehre
vom Schönen und die Lehre vom sittlichen Verhalten behandeln, ist die Unter-