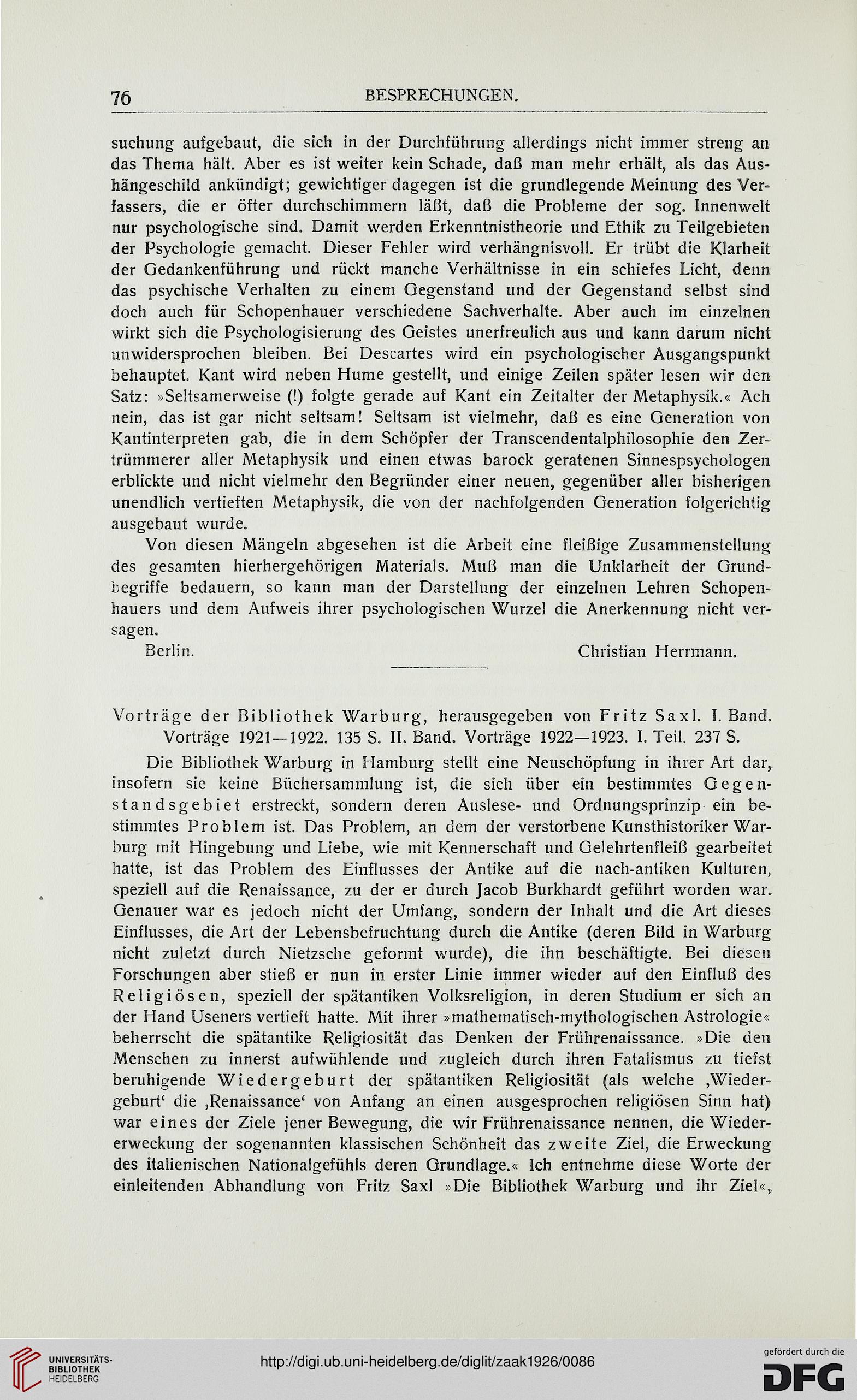76
BESPRECHUNGEN.
suchung aufgebaut, die sich in der Durchführung allerdings nicht immer streng an
das Thema hält. Aber es ist weiter kein Schade, daß man mehr erhält, als das Aus-
hängeschild ankündigt; gewichtiger dagegen ist die grundlegende Meinung des Ver-
fassers, die er öfter durchschimmern läßt, daß die Probleme der sog. Innenwelt
nur psychologische sind. Damit werden Erkenntnistheorie und Ethik zu Teilgebieten
der Psychologie gemacht. Dieser Fehler wird verhängnisvoll. Er trübt die Klarheit
der Gedankenführung und rückt manche Verhältnisse in ein schiefes Licht, denn
das psychische Verhalten zu einem Gegenstand und der Gegenstand selbst sind
doch auch für Schopenhauer verschiedene Sachverhalte. Aber auch im einzelnen
wirkt sich die Psychologisierung des Geistes unerfreulich aus und kann darum nicht
unwidersprochen bleiben. Bei Descartes wird ein psychologischer Ausgangspunkt
behauptet. Kant wird neben Hume gestellt, und einige Zeilen später lesen wir den
Satz: »Seltsamerweise (!) folgte gerade auf Kant ein Zeitalter der Metaphysik.« Ach
nein, das ist gar nicht seltsam! Seltsam ist vielmehr, daß es eine Generation von
Kantinterpreten gab, die in dem Schöpfer der Transcendentalphilosophie den Zer-
trümmerer aller Metaphysik und einen etwas barock geratenen Sinnespsychologen
erblickte und nicht vielmehr den Begründer einer neuen, gegenüber aller bisherigen
unendlich vertieften Metaphysik, die von der nachfolgenden Generation folgerichtig
ausgebaut wurde.
Von diesen Mängeln abgesehen ist die Arbeit eine fleißige Zusammenstellung
des gesamten hierhergehörigen Materials. Muß man die Unklarheit der Grund-
begriffe bedauern, so kann man der Darstellung der einzelnen Lehren Schopen-
hauers und dem Aufweis ihrer psychologischen Wurzel die Anerkennung nicht ver-
sagen.
Berlin. Christian Herrmann.
Vorträge der Bibliothek Warburg, herausgegeben von Fritz Saxl. I.Band.
Vorträge 1921-1922. 135 S. II. Band. Vorträge 1922—1923. I.Teil. 237 S.
Die Bibliothek Warburg in Hamburg stellt eine Neuschöpfung in ihrer Art dar,
insofern sie keine Büchersammlung ist, die sich über ein bestimmtes Gegen-
standsgebiet erstreckt, sondern deren Auslese- und Ordnungsprinzip ein be-
stimmtes Problem ist. Das Problem, an dem der verstorbene Kunsthistoriker War-
burg mit Hingebung und Liebe, wie mit Kennerschaft und Gelehrtenfleiß gearbeitet
hatte, ist das Problem des Einflusses der Antike auf die nach-antiken Kulturen,
speziell auf die Renaissance, zu der er durch Jacob Burkhardt geführt worden war.
Genauer war es jedoch nicht der Umfang, sondern der Inhalt und die Art dieses
Einflusses, die Art der Lebensbefruchtung durch die Antike (deren Bild in Warburg
nicht zuletzt durch Nietzsche geformt wurde), die ihn beschäftigte. Bei diesen
Forschungen aber stieß er nun in erster Linie immer wieder auf den Einfluß des
Religiösen, speziell der spätantiken Volksreligion, in deren Studium er sich an
der Hand Useners vertieft hatte. Mit ihrer »mathematisch-mythologischen Astrologie«
beherrscht die spätantike Religiosität das Denken der Frührenaissance. »Die den
Menschen zu innerst aufwühlende und zugleich durch ihren Fatalismus zu tiefst
beruhigende Wiedergeburt der spätantiken Religiosität (als welche AVieder-
geburt' die ,Renaissance' von Anfang an einen ausgesprochen religiösen Sinn hat)
war eines der Ziele jener Bewegung, die wir Frührenaissance nennen, die Wieder-
erweckung der sogenannten klassischen Schönheit das zweite Ziel, die Erweckung
des italienischen Nationalgefühls deren Grundlage.« Ich entnehme diese Worte der
einleitenden Abhandlung von Fritz Saxl »Die Bibliothek Warburg und ihr Ziel«*
BESPRECHUNGEN.
suchung aufgebaut, die sich in der Durchführung allerdings nicht immer streng an
das Thema hält. Aber es ist weiter kein Schade, daß man mehr erhält, als das Aus-
hängeschild ankündigt; gewichtiger dagegen ist die grundlegende Meinung des Ver-
fassers, die er öfter durchschimmern läßt, daß die Probleme der sog. Innenwelt
nur psychologische sind. Damit werden Erkenntnistheorie und Ethik zu Teilgebieten
der Psychologie gemacht. Dieser Fehler wird verhängnisvoll. Er trübt die Klarheit
der Gedankenführung und rückt manche Verhältnisse in ein schiefes Licht, denn
das psychische Verhalten zu einem Gegenstand und der Gegenstand selbst sind
doch auch für Schopenhauer verschiedene Sachverhalte. Aber auch im einzelnen
wirkt sich die Psychologisierung des Geistes unerfreulich aus und kann darum nicht
unwidersprochen bleiben. Bei Descartes wird ein psychologischer Ausgangspunkt
behauptet. Kant wird neben Hume gestellt, und einige Zeilen später lesen wir den
Satz: »Seltsamerweise (!) folgte gerade auf Kant ein Zeitalter der Metaphysik.« Ach
nein, das ist gar nicht seltsam! Seltsam ist vielmehr, daß es eine Generation von
Kantinterpreten gab, die in dem Schöpfer der Transcendentalphilosophie den Zer-
trümmerer aller Metaphysik und einen etwas barock geratenen Sinnespsychologen
erblickte und nicht vielmehr den Begründer einer neuen, gegenüber aller bisherigen
unendlich vertieften Metaphysik, die von der nachfolgenden Generation folgerichtig
ausgebaut wurde.
Von diesen Mängeln abgesehen ist die Arbeit eine fleißige Zusammenstellung
des gesamten hierhergehörigen Materials. Muß man die Unklarheit der Grund-
begriffe bedauern, so kann man der Darstellung der einzelnen Lehren Schopen-
hauers und dem Aufweis ihrer psychologischen Wurzel die Anerkennung nicht ver-
sagen.
Berlin. Christian Herrmann.
Vorträge der Bibliothek Warburg, herausgegeben von Fritz Saxl. I.Band.
Vorträge 1921-1922. 135 S. II. Band. Vorträge 1922—1923. I.Teil. 237 S.
Die Bibliothek Warburg in Hamburg stellt eine Neuschöpfung in ihrer Art dar,
insofern sie keine Büchersammlung ist, die sich über ein bestimmtes Gegen-
standsgebiet erstreckt, sondern deren Auslese- und Ordnungsprinzip ein be-
stimmtes Problem ist. Das Problem, an dem der verstorbene Kunsthistoriker War-
burg mit Hingebung und Liebe, wie mit Kennerschaft und Gelehrtenfleiß gearbeitet
hatte, ist das Problem des Einflusses der Antike auf die nach-antiken Kulturen,
speziell auf die Renaissance, zu der er durch Jacob Burkhardt geführt worden war.
Genauer war es jedoch nicht der Umfang, sondern der Inhalt und die Art dieses
Einflusses, die Art der Lebensbefruchtung durch die Antike (deren Bild in Warburg
nicht zuletzt durch Nietzsche geformt wurde), die ihn beschäftigte. Bei diesen
Forschungen aber stieß er nun in erster Linie immer wieder auf den Einfluß des
Religiösen, speziell der spätantiken Volksreligion, in deren Studium er sich an
der Hand Useners vertieft hatte. Mit ihrer »mathematisch-mythologischen Astrologie«
beherrscht die spätantike Religiosität das Denken der Frührenaissance. »Die den
Menschen zu innerst aufwühlende und zugleich durch ihren Fatalismus zu tiefst
beruhigende Wiedergeburt der spätantiken Religiosität (als welche AVieder-
geburt' die ,Renaissance' von Anfang an einen ausgesprochen religiösen Sinn hat)
war eines der Ziele jener Bewegung, die wir Frührenaissance nennen, die Wieder-
erweckung der sogenannten klassischen Schönheit das zweite Ziel, die Erweckung
des italienischen Nationalgefühls deren Grundlage.« Ich entnehme diese Worte der
einleitenden Abhandlung von Fritz Saxl »Die Bibliothek Warburg und ihr Ziel«*