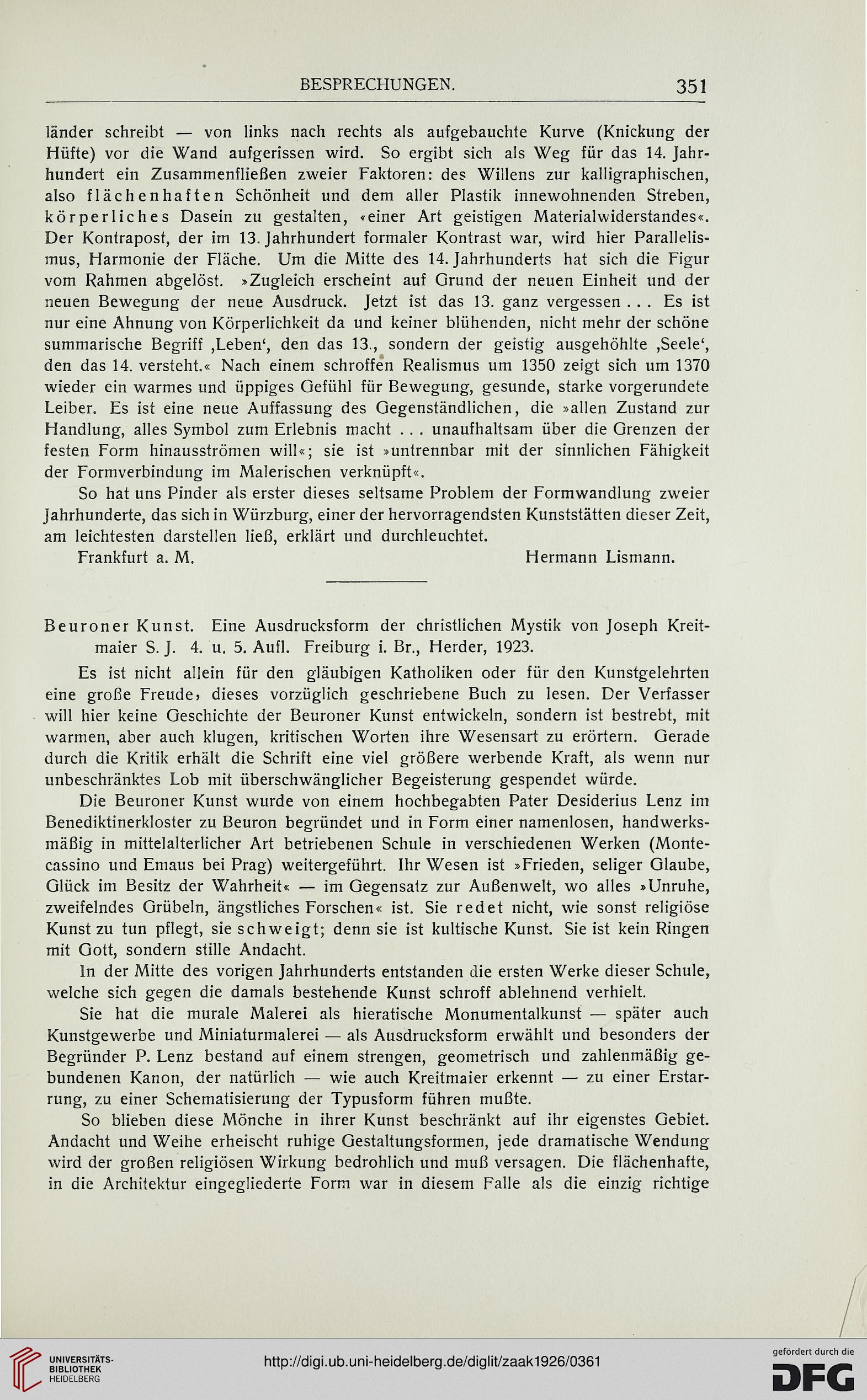BESPRECHUNGEN.
351
länder schreibt — von links nach rechts als aufgebauchte Kurve (Knickung der
Hüfte) vor die Wand aufgerissen wird. So ergibt sich als Weg für das 14. Jahr-
hundert ein Zusammenfließen zweier Faktoren: des Willens zur kalligraphischen,
also flächen haften Schönheit und dem aller Plastik innewohnenden Streben,
körperliches Dasein zu gestalten, «-einer Art geistigen Materialwiderstandes«.
Der Kontrapost, der im 13. Jahrhundert formaler Kontrast war, wird hier Parallelis-
mus, Harmonie der Fläche. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts hat sich die Figur
vom Rahmen abgelöst. »Zugleich erscheint auf Grund der neuen Einheit und der
neuen Bewegung der neue Ausdruck. Jetzt ist das 13. ganz vergessen ... Es ist
nur eine Ahnung von Körperlichkeit da und keiner blühenden, nicht mehr der schöne
summarische Begriff ,Leben', den das 13., sondern der geistig ausgehöhlte ,Seele',
den das 14. versteht.« Nach einem schroffen Realismus um 1350 zeigt sich um 1370
wieder ein warmes und üppiges Gefühl für Bewegung, gesunde, starke vorgerundete
Leiber. Es ist eine neue Auffassung des Gegenständlichen, die »allen Zustand zur
Handlung, alles Symbol zum Erlebnis macht . . . unaufhaltsam über die Grenzen der
festen Form hinausströmen will«; sie ist »untrennbar mit der sinnlichen Fähigkeit
der Formverbindung im Malerischen verknüpft«.
So hat uns Pinder als erster dieses seltsame Problem der Formwandlung zweier
Jahrhunderte, das sich in Würzburg, einer der hervorragendsten Kunststätten dieser Zeit,
am leichtesten darstellen ließ, erklärt und durchleuchtet.
Frankfurt a. M. Hermann Lismann.
Beuroner Kunst. Eine Ausdrucksform der christlichen Mystik von Joseph Kreit-
maier S. J. 4. u. 5. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1923.
Es ist nicht allein für den gläubigen Katholiken oder für den Kunstgelehrten
eine große Freude» dieses vorzüglich geschriebene Buch zu lesen. Der Verfasser
will hier keine Geschichte der Beuroner Kunst entwickeln, sondern ist bestrebt, mit
warmen, aber auch klugen, kritischen Worten ihre Wesensart zu erörtern. Gerade
durch die Kritik erhält die Schrift eine viel größere werbende Kraft, als wenn nur
unbeschränktes Lob mit überschwänglicher Begeisterung gespendet würde.
Die Beuroner Kunst wurde von einem hochbegabten Pater Desiderius Lenz im
Benediktinerkloster zu Beuron begründet und in Form einer namenlosen, handwerks-
mäßig in mittelalterlicher Art betriebenen Schule in verschiedenen Werken (Monte-
cassino und Emaus bei Prag) weitergeführt. Ihr Wesen ist »Frieden, seliger Glaube,
Glück im Besitz der Wahrheit« — im Gegensatz zur Außenwelt, wo alles »Unruhe,
zweifelndes Grübeln, ängstliches Forschen« ist. Sie redet nicht, wie sonst religiöse
Kunst zu tun pflegt, sie schweigt; denn sie ist kultische Kunst. Sie ist kein Ringen
mit Gott, sondern stille Andacht.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden die ersten Werke dieser Schule,
welche sich gegen die damals bestehende Kunst schroff ablehnend verhielt.
Sie hat die murale Malerei als hieratische Monumentalkunst — später auch
Kunstgewerbe und Miniaturmalerei — als Ausdrucksform erwählt und besonders der
Begründer P. Lenz bestand auf einem strengen, geometrisch und zahlenmäßig ge-
bundenen Kanon, der natürlich — wie auch Kreitmaier erkennt — zu einer Erstar-
rung, zu einer Schematisierung der Typusform führen mußte.
So blieben diese Mönche in ihrer Kunst beschränkt auf ihr eigenstes Gebiet.
Andacht und Weihe erheischt ruhige Gestaltungsformen, jede dramatische Wendung
wird der großen religiösen Wirkung bedrohlich und muß versagen. Die flächenhafte,
in die Architektur eingegliederte Form war in diesem Falle als die einzig richtige
351
länder schreibt — von links nach rechts als aufgebauchte Kurve (Knickung der
Hüfte) vor die Wand aufgerissen wird. So ergibt sich als Weg für das 14. Jahr-
hundert ein Zusammenfließen zweier Faktoren: des Willens zur kalligraphischen,
also flächen haften Schönheit und dem aller Plastik innewohnenden Streben,
körperliches Dasein zu gestalten, «-einer Art geistigen Materialwiderstandes«.
Der Kontrapost, der im 13. Jahrhundert formaler Kontrast war, wird hier Parallelis-
mus, Harmonie der Fläche. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts hat sich die Figur
vom Rahmen abgelöst. »Zugleich erscheint auf Grund der neuen Einheit und der
neuen Bewegung der neue Ausdruck. Jetzt ist das 13. ganz vergessen ... Es ist
nur eine Ahnung von Körperlichkeit da und keiner blühenden, nicht mehr der schöne
summarische Begriff ,Leben', den das 13., sondern der geistig ausgehöhlte ,Seele',
den das 14. versteht.« Nach einem schroffen Realismus um 1350 zeigt sich um 1370
wieder ein warmes und üppiges Gefühl für Bewegung, gesunde, starke vorgerundete
Leiber. Es ist eine neue Auffassung des Gegenständlichen, die »allen Zustand zur
Handlung, alles Symbol zum Erlebnis macht . . . unaufhaltsam über die Grenzen der
festen Form hinausströmen will«; sie ist »untrennbar mit der sinnlichen Fähigkeit
der Formverbindung im Malerischen verknüpft«.
So hat uns Pinder als erster dieses seltsame Problem der Formwandlung zweier
Jahrhunderte, das sich in Würzburg, einer der hervorragendsten Kunststätten dieser Zeit,
am leichtesten darstellen ließ, erklärt und durchleuchtet.
Frankfurt a. M. Hermann Lismann.
Beuroner Kunst. Eine Ausdrucksform der christlichen Mystik von Joseph Kreit-
maier S. J. 4. u. 5. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1923.
Es ist nicht allein für den gläubigen Katholiken oder für den Kunstgelehrten
eine große Freude» dieses vorzüglich geschriebene Buch zu lesen. Der Verfasser
will hier keine Geschichte der Beuroner Kunst entwickeln, sondern ist bestrebt, mit
warmen, aber auch klugen, kritischen Worten ihre Wesensart zu erörtern. Gerade
durch die Kritik erhält die Schrift eine viel größere werbende Kraft, als wenn nur
unbeschränktes Lob mit überschwänglicher Begeisterung gespendet würde.
Die Beuroner Kunst wurde von einem hochbegabten Pater Desiderius Lenz im
Benediktinerkloster zu Beuron begründet und in Form einer namenlosen, handwerks-
mäßig in mittelalterlicher Art betriebenen Schule in verschiedenen Werken (Monte-
cassino und Emaus bei Prag) weitergeführt. Ihr Wesen ist »Frieden, seliger Glaube,
Glück im Besitz der Wahrheit« — im Gegensatz zur Außenwelt, wo alles »Unruhe,
zweifelndes Grübeln, ängstliches Forschen« ist. Sie redet nicht, wie sonst religiöse
Kunst zu tun pflegt, sie schweigt; denn sie ist kultische Kunst. Sie ist kein Ringen
mit Gott, sondern stille Andacht.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden die ersten Werke dieser Schule,
welche sich gegen die damals bestehende Kunst schroff ablehnend verhielt.
Sie hat die murale Malerei als hieratische Monumentalkunst — später auch
Kunstgewerbe und Miniaturmalerei — als Ausdrucksform erwählt und besonders der
Begründer P. Lenz bestand auf einem strengen, geometrisch und zahlenmäßig ge-
bundenen Kanon, der natürlich — wie auch Kreitmaier erkennt — zu einer Erstar-
rung, zu einer Schematisierung der Typusform führen mußte.
So blieben diese Mönche in ihrer Kunst beschränkt auf ihr eigenstes Gebiet.
Andacht und Weihe erheischt ruhige Gestaltungsformen, jede dramatische Wendung
wird der großen religiösen Wirkung bedrohlich und muß versagen. Die flächenhafte,
in die Architektur eingegliederte Form war in diesem Falle als die einzig richtige