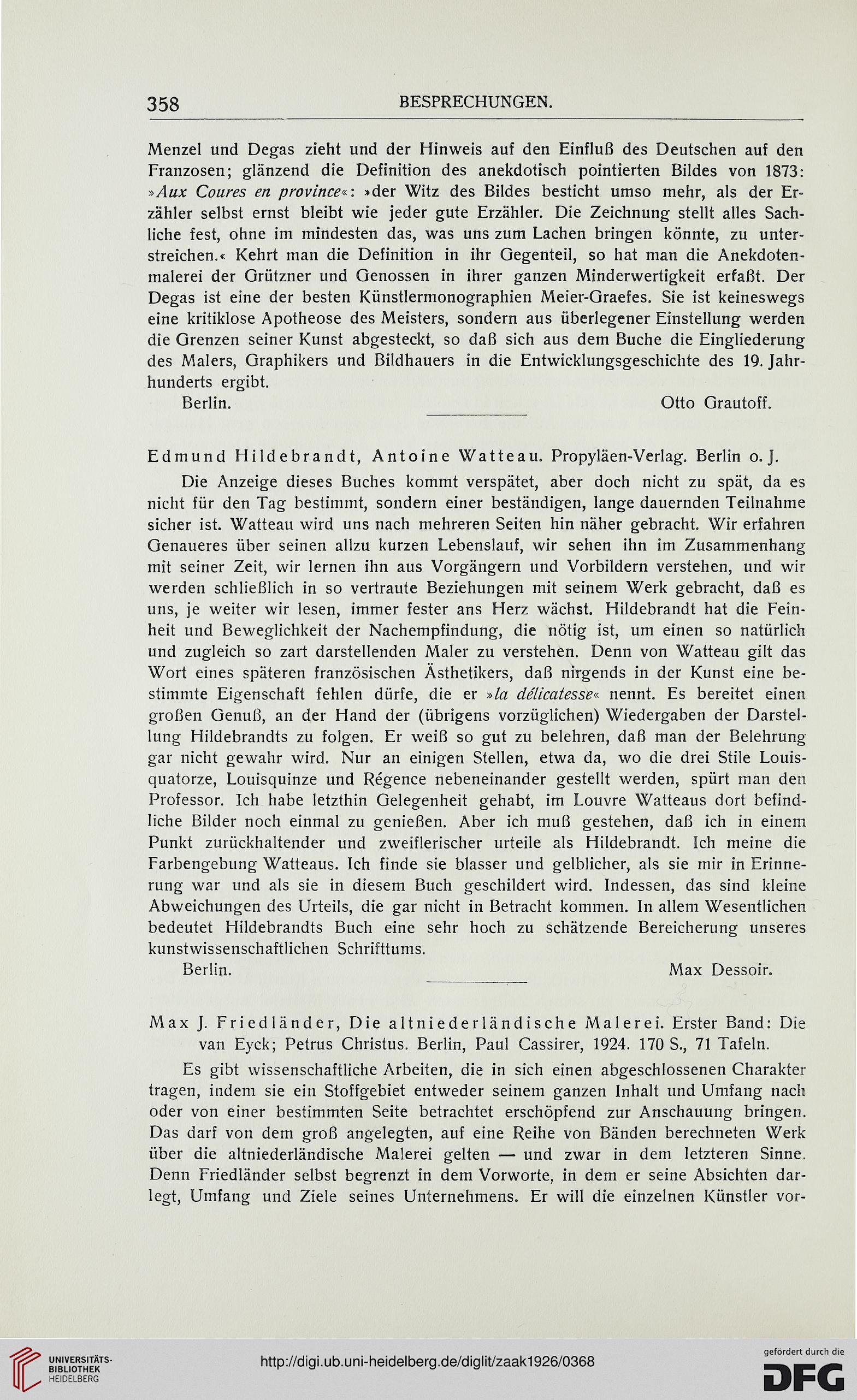358
BESPRECHUNGEN.
Menzel und Degas zieht und der Hinweis auf den Einfluß des Deutschen auf den
Franzosen; glänzend die Definition des anekdotisch pointierten Bildes von 1873:
»Aux Coures en province«: »der Witz des Bildes besticht umso mehr, als der Er-
zähler selbst ernst bleibt wie jeder gute Erzähler. Die Zeichnung stellt alles Sach-
liche fest, ohne im mindesten das, was uns zum Lachen bringen könnte, zu unter-
streichen.« Kehrt man die Definition in ihr Gegenteil, so hat man die Anekdoten-
malerei der Grützner und Genossen in ihrer ganzen Minderwertigkeit erfaßt. Der
Degas ist eine der besten Künstlermonographien Meier-Graefes. Sie ist keineswegs
eine kritiklose Apotheose des Meisters, sondern aus überlegener Einstellung werden
die Grenzen seiner Kunst abgesteckt, so daß sich aus dem Buche die Eingliederung
des Malers, Graphikers und Bildhauers in die Entwicklungsgeschichte des 19. Jahr-
hunderts ergibt.
Berlin. Otto Grautoff.
Edmund Hildebrandt, Antoine Watteau. Propyläen-Verlag. Berlin o. J.
Die Anzeige dieses Buches kommt verspätet, aber doch nicht zu spät, da es
nicht für den Tag bestimmt, sondern einer beständigen, lange dauernden Teilnahme
sicher ist. Watteau wird uns nach mehreren Seiten hin näher gebracht. Wir erfahren
Genaueres über seinen allzu kurzen Lebenslauf, wir sehen ihn im Zusammenhang
mit seiner Zeit, wir lernen ihn aus Vorgängern und Vorbildern verstehen, und wir
werden schließlich in so vertraute Beziehungen mit seinem Werk gebracht, daß es
uns, je weiter wir lesen, immer fester ans Herz wächst. Hildebrandt hat die Fein-
heit und Beweglichkeit der Nachempfindung, die nötig ist, um einen so natürlich
und zugleich so zart darstellenden Maler zu verstehen. Denn von Watteau gilt das
Wort eines späteren französischen Ästhetikers, daß nirgends in der Kunst eine be-
stimmte Eigenschaft fehlen dürfe, die er -»la de'/icatesse« nennt. Es bereitet einen
großen Genuß, an der Hand der (übrigens vorzüglichen) Wiedergaben der Darstel-
lung Hildebrandts zu folgen. Er weiß so gut zu belehren, daß man der Belehrung
gar nicht gewahr wird. Nur an einigen Stellen, etwa da, wo die drei Stile Louis-
quatorze, Louisquinze und Regence nebeneinander gestellt werden, spürt man den
Professor. Ich habe letzthin Gelegenheit gehabt, im Louvre Watteaus dort befind-
liche Bilder noch einmal zu genießen. Aber ich muß gestehen, daß ich in einem
Punkt zurückhaltender und zweiflerischer urteile als Hildebrandt. Ich meine die
Farbengebung Watteaus. Ich finde sie blasser und gelblicher, als sie mir in Erinne-
rung war und als sie in diesem Buch geschildert wird. Indessen, das sind kleine
Abweichungen des Urteils, die gar nicht in Betracht kommen. In allem Wesentlichen
bedeutet Hildebrandts Buch eine sehr hoch zu schätzende Bereicherung unseres
kunstwissenschaftlichen Schrifttums.
Berlin. Max Dessoir.
Max J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. Erster Band: Die
van Eyck; Petrus Christus. Berlin, Paul Cassirer, 1924. 170 S., 71 Tafeln.
Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die in sich einen abgeschlossenen Charakter
tragen, indem sie ein Stoffgebiet entweder seinem ganzen Inhalt und Umfang nach
oder von einer bestimmten Seite betrachtet erschöpfend zur Anschauung bringen.
Das darf von dem groß angelegten, auf eine Reihe von Bänden berechneten Werk
über die altniederländische Malerei gelten — und zwar in dem letzteren Sinne.
Denn Friedländer selbst begrenzt in dem Vorworte, in dem er seine Absichten dar-
legt, Umfang und Ziele seines Unternehmens. Er will die einzelnen Künstler vor-
BESPRECHUNGEN.
Menzel und Degas zieht und der Hinweis auf den Einfluß des Deutschen auf den
Franzosen; glänzend die Definition des anekdotisch pointierten Bildes von 1873:
»Aux Coures en province«: »der Witz des Bildes besticht umso mehr, als der Er-
zähler selbst ernst bleibt wie jeder gute Erzähler. Die Zeichnung stellt alles Sach-
liche fest, ohne im mindesten das, was uns zum Lachen bringen könnte, zu unter-
streichen.« Kehrt man die Definition in ihr Gegenteil, so hat man die Anekdoten-
malerei der Grützner und Genossen in ihrer ganzen Minderwertigkeit erfaßt. Der
Degas ist eine der besten Künstlermonographien Meier-Graefes. Sie ist keineswegs
eine kritiklose Apotheose des Meisters, sondern aus überlegener Einstellung werden
die Grenzen seiner Kunst abgesteckt, so daß sich aus dem Buche die Eingliederung
des Malers, Graphikers und Bildhauers in die Entwicklungsgeschichte des 19. Jahr-
hunderts ergibt.
Berlin. Otto Grautoff.
Edmund Hildebrandt, Antoine Watteau. Propyläen-Verlag. Berlin o. J.
Die Anzeige dieses Buches kommt verspätet, aber doch nicht zu spät, da es
nicht für den Tag bestimmt, sondern einer beständigen, lange dauernden Teilnahme
sicher ist. Watteau wird uns nach mehreren Seiten hin näher gebracht. Wir erfahren
Genaueres über seinen allzu kurzen Lebenslauf, wir sehen ihn im Zusammenhang
mit seiner Zeit, wir lernen ihn aus Vorgängern und Vorbildern verstehen, und wir
werden schließlich in so vertraute Beziehungen mit seinem Werk gebracht, daß es
uns, je weiter wir lesen, immer fester ans Herz wächst. Hildebrandt hat die Fein-
heit und Beweglichkeit der Nachempfindung, die nötig ist, um einen so natürlich
und zugleich so zart darstellenden Maler zu verstehen. Denn von Watteau gilt das
Wort eines späteren französischen Ästhetikers, daß nirgends in der Kunst eine be-
stimmte Eigenschaft fehlen dürfe, die er -»la de'/icatesse« nennt. Es bereitet einen
großen Genuß, an der Hand der (übrigens vorzüglichen) Wiedergaben der Darstel-
lung Hildebrandts zu folgen. Er weiß so gut zu belehren, daß man der Belehrung
gar nicht gewahr wird. Nur an einigen Stellen, etwa da, wo die drei Stile Louis-
quatorze, Louisquinze und Regence nebeneinander gestellt werden, spürt man den
Professor. Ich habe letzthin Gelegenheit gehabt, im Louvre Watteaus dort befind-
liche Bilder noch einmal zu genießen. Aber ich muß gestehen, daß ich in einem
Punkt zurückhaltender und zweiflerischer urteile als Hildebrandt. Ich meine die
Farbengebung Watteaus. Ich finde sie blasser und gelblicher, als sie mir in Erinne-
rung war und als sie in diesem Buch geschildert wird. Indessen, das sind kleine
Abweichungen des Urteils, die gar nicht in Betracht kommen. In allem Wesentlichen
bedeutet Hildebrandts Buch eine sehr hoch zu schätzende Bereicherung unseres
kunstwissenschaftlichen Schrifttums.
Berlin. Max Dessoir.
Max J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. Erster Band: Die
van Eyck; Petrus Christus. Berlin, Paul Cassirer, 1924. 170 S., 71 Tafeln.
Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die in sich einen abgeschlossenen Charakter
tragen, indem sie ein Stoffgebiet entweder seinem ganzen Inhalt und Umfang nach
oder von einer bestimmten Seite betrachtet erschöpfend zur Anschauung bringen.
Das darf von dem groß angelegten, auf eine Reihe von Bänden berechneten Werk
über die altniederländische Malerei gelten — und zwar in dem letzteren Sinne.
Denn Friedländer selbst begrenzt in dem Vorworte, in dem er seine Absichten dar-
legt, Umfang und Ziele seines Unternehmens. Er will die einzelnen Künstler vor-