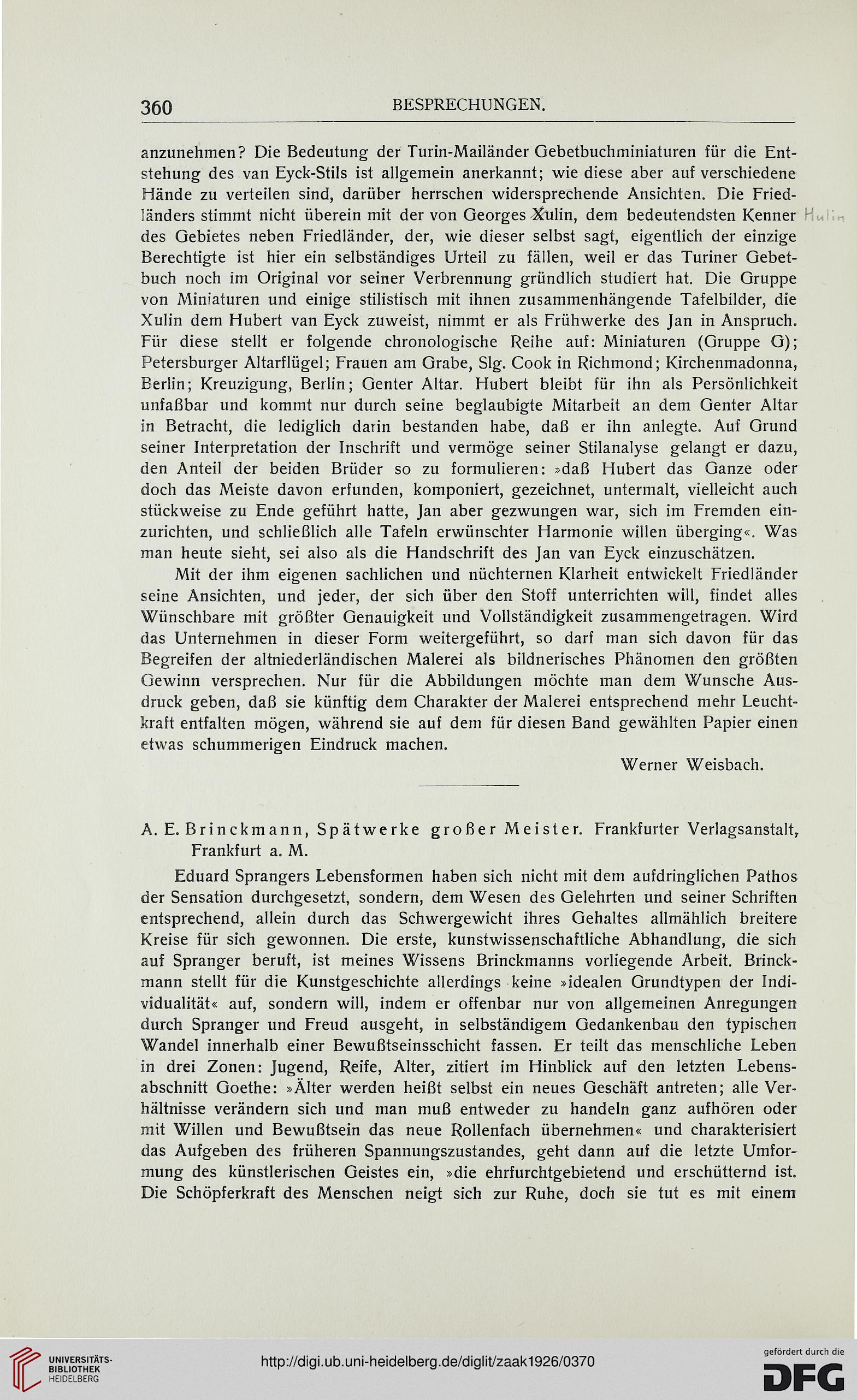360
BESPRECHUNGEN.
anzunehmen? Die Bedeutung der Turin-Mailänder Gebetbuchminiaturen für die Ent-
stehung des van Eyck-Stils ist allgemein anerkannt; wie diese aber auf verschiedene
Hände zu verteilen sind, darüber herrschen widersprechende Ansichten. Die Fried-
länders stimmt nicht überein mit der von Georges Xuhn, dem bedeutendsten Kenner Hul'l(1
des Gebietes neben Friedländer, der, wie dieser selbst sagt, eigentlich der einzige
Berechtigte ist hier ein selbständiges Urteil zu fällen, weil er das Turiner Gebet-
buch noch im Original vor seiner Verbrennung gründlich studiert hat. Die Gruppe
von Miniaturen und einige stilistisch mit ihnen zusammenhängende Tafelbilder, die
Xulin dem Hubert van Eyck zuweist, nimmt er als Frühwerke des Jan in Anspruch.
Für diese stellt er folgende chronologische Reihe auf: Miniaturen (Gruppe G);
Petersburger Altarflügel; Frauen am Grabe, Slg. Cook in Richmond; Kirchenmadonna,
Berlin; Kreuzigung, Berlin; Genter Altar. Hubert bleibt für ihn als Persönlichkeit
unfaßbar und kommt nur durch seine beglaubigte Mitarbeit an dem Genter Altar
in Betracht, die lediglich darin bestanden habe, daß er ihn anlegte. Auf Grund
seiner Interpretation der Inschrift und vermöge seiner Stilanalyse gelangt er dazu,
den Anteil der beiden Brüder so zu formulieren: »daß Hubert das Ganze oder
doch das Meiste davon erfunden, komponiert, gezeichnet, untermalt, vielleicht auch
stückweise zu Ende geführt hatte, Jan aber gezwungen war, sich im Fremden ein-
zurichten, und schließlich alle Tafeln erwünschter Harmonie willen überging«. Was
man heute sieht, sei also als die Handschrift des Jan van Eyck einzuschätzen.
Mit der ihm eigenen sachlichen und nüchternen Klarheit entwickelt Friedländer
seine Ansichten, und jeder, der sich über den Stoff unterrichten will, findet alles
Wünschbare mit größter Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengetragen. Wird
das Unternehmen in dieser Form weitergeführt, so darf man sich davon für das
Begreifen der altniederländischen Malerei als bildnerisches Phänomen den größten
Gewinn versprechen. Nur für die Abbildungen möchte man dem Wunsche Aus-
druck geben, daß sie künftig dem Charakter der Malerei entsprechend mehr Leucht-
kraft entfalten mögen, während sie auf dem für diesen Band gewählten Papier einen
etwas schummerigen Eindruck machen.
Werner Weisbach.
A. E. Brinckmann, Spätwerke großer Meister. Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt a. M.
Eduard Sprangers Lebensformen haben sich nicht mit dem aufdringlichen Pathos
der Sensation durchgesetzt, sondern, dem Wesen des Gelehrten und seiner Schriften
entsprechend, allein durch das Schwergewicht ihres Gehaltes allmählich breitere
Kreise für sich gewonnen. Die erste, kunstwissenschaftliche Abhandlung, die sich
auf Spranger beruft, ist meines Wissens Brinckmanns vorliegende Arbeit. Brinck-
mann stellt für die Kunstgeschichte allerdings keine »idealen Grundtypen der Indi-
vidualität« auf, sondern will, indem er offenbar nur von allgemeinen Anregungen
durch Spranger und Freud ausgeht, in selbständigem Gedankenbau den typischen
Wandel innerhalb einer Bewußtseinsschicht fassen. Er teilt das menschliche Leben
in drei Zonen: Jugend, Reife, Alter, zitiert im Hinblick auf den letzten Lebens-
abschnitt Goethe: »Älter werden heißt selbst ein neues Geschäft antreten; alle Ver-
hältnisse verändern sich und man muß entweder zu handeln ganz aufhören oder
mit Willen und Bewußtsein das neue Rollenfach übernehmen« und charakterisiert
das Aufgeben des früheren Spannungszustandes, geht dann auf die letzte Umfor-
mung des künstlerischen Geistes ein, »die ehrfurchtgebietend und erschütternd ist.
Die Schöpferkraft des Menschen neigt sich zur Ruhe, doch sie tut es mit einem
BESPRECHUNGEN.
anzunehmen? Die Bedeutung der Turin-Mailänder Gebetbuchminiaturen für die Ent-
stehung des van Eyck-Stils ist allgemein anerkannt; wie diese aber auf verschiedene
Hände zu verteilen sind, darüber herrschen widersprechende Ansichten. Die Fried-
länders stimmt nicht überein mit der von Georges Xuhn, dem bedeutendsten Kenner Hul'l(1
des Gebietes neben Friedländer, der, wie dieser selbst sagt, eigentlich der einzige
Berechtigte ist hier ein selbständiges Urteil zu fällen, weil er das Turiner Gebet-
buch noch im Original vor seiner Verbrennung gründlich studiert hat. Die Gruppe
von Miniaturen und einige stilistisch mit ihnen zusammenhängende Tafelbilder, die
Xulin dem Hubert van Eyck zuweist, nimmt er als Frühwerke des Jan in Anspruch.
Für diese stellt er folgende chronologische Reihe auf: Miniaturen (Gruppe G);
Petersburger Altarflügel; Frauen am Grabe, Slg. Cook in Richmond; Kirchenmadonna,
Berlin; Kreuzigung, Berlin; Genter Altar. Hubert bleibt für ihn als Persönlichkeit
unfaßbar und kommt nur durch seine beglaubigte Mitarbeit an dem Genter Altar
in Betracht, die lediglich darin bestanden habe, daß er ihn anlegte. Auf Grund
seiner Interpretation der Inschrift und vermöge seiner Stilanalyse gelangt er dazu,
den Anteil der beiden Brüder so zu formulieren: »daß Hubert das Ganze oder
doch das Meiste davon erfunden, komponiert, gezeichnet, untermalt, vielleicht auch
stückweise zu Ende geführt hatte, Jan aber gezwungen war, sich im Fremden ein-
zurichten, und schließlich alle Tafeln erwünschter Harmonie willen überging«. Was
man heute sieht, sei also als die Handschrift des Jan van Eyck einzuschätzen.
Mit der ihm eigenen sachlichen und nüchternen Klarheit entwickelt Friedländer
seine Ansichten, und jeder, der sich über den Stoff unterrichten will, findet alles
Wünschbare mit größter Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengetragen. Wird
das Unternehmen in dieser Form weitergeführt, so darf man sich davon für das
Begreifen der altniederländischen Malerei als bildnerisches Phänomen den größten
Gewinn versprechen. Nur für die Abbildungen möchte man dem Wunsche Aus-
druck geben, daß sie künftig dem Charakter der Malerei entsprechend mehr Leucht-
kraft entfalten mögen, während sie auf dem für diesen Band gewählten Papier einen
etwas schummerigen Eindruck machen.
Werner Weisbach.
A. E. Brinckmann, Spätwerke großer Meister. Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt a. M.
Eduard Sprangers Lebensformen haben sich nicht mit dem aufdringlichen Pathos
der Sensation durchgesetzt, sondern, dem Wesen des Gelehrten und seiner Schriften
entsprechend, allein durch das Schwergewicht ihres Gehaltes allmählich breitere
Kreise für sich gewonnen. Die erste, kunstwissenschaftliche Abhandlung, die sich
auf Spranger beruft, ist meines Wissens Brinckmanns vorliegende Arbeit. Brinck-
mann stellt für die Kunstgeschichte allerdings keine »idealen Grundtypen der Indi-
vidualität« auf, sondern will, indem er offenbar nur von allgemeinen Anregungen
durch Spranger und Freud ausgeht, in selbständigem Gedankenbau den typischen
Wandel innerhalb einer Bewußtseinsschicht fassen. Er teilt das menschliche Leben
in drei Zonen: Jugend, Reife, Alter, zitiert im Hinblick auf den letzten Lebens-
abschnitt Goethe: »Älter werden heißt selbst ein neues Geschäft antreten; alle Ver-
hältnisse verändern sich und man muß entweder zu handeln ganz aufhören oder
mit Willen und Bewußtsein das neue Rollenfach übernehmen« und charakterisiert
das Aufgeben des früheren Spannungszustandes, geht dann auf die letzte Umfor-
mung des künstlerischen Geistes ein, »die ehrfurchtgebietend und erschütternd ist.
Die Schöpferkraft des Menschen neigt sich zur Ruhe, doch sie tut es mit einem