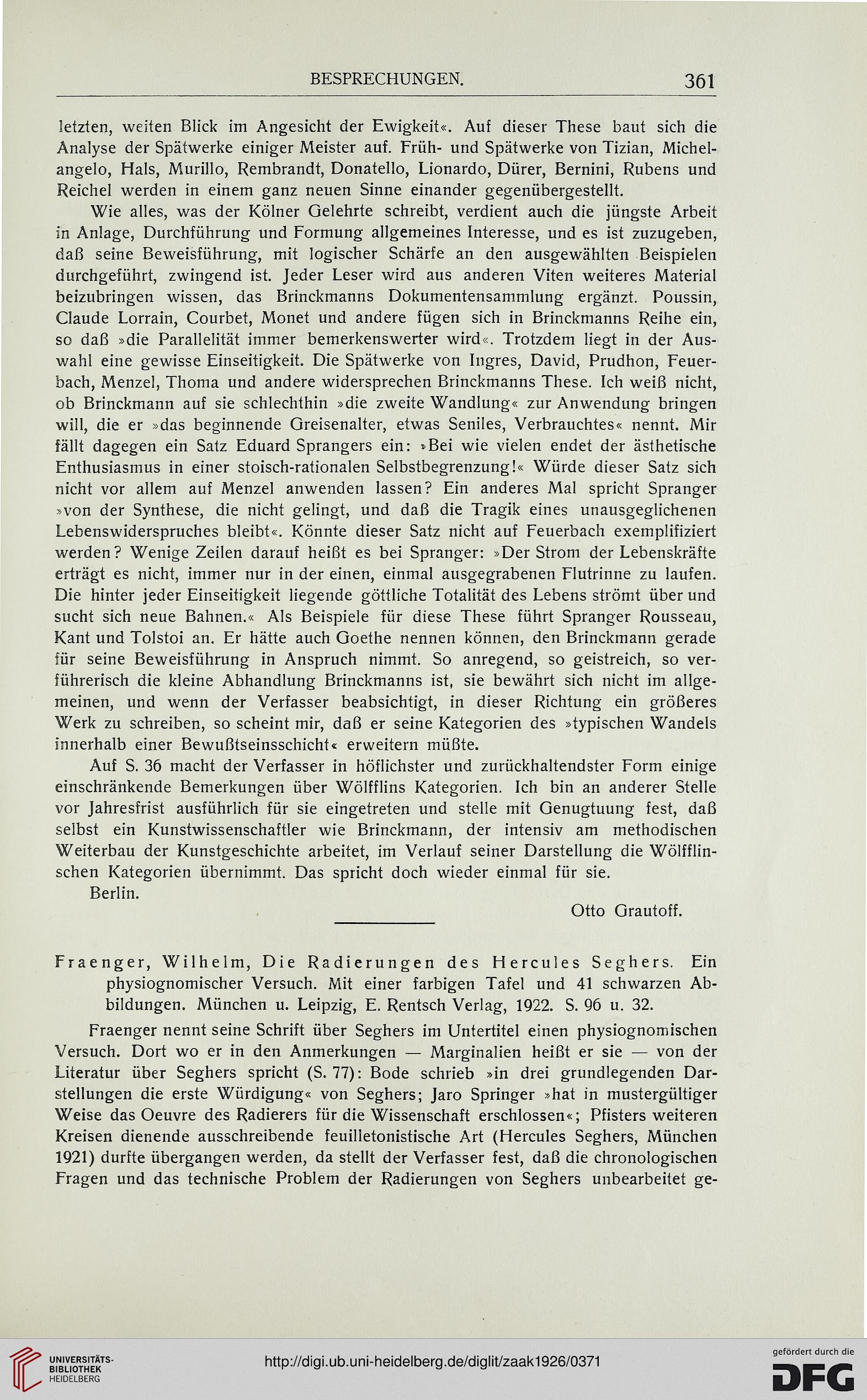BESPRECHUNGEN.
361
letzten, weiten Blick im Angesicht der Ewigkeit«. Auf dieser These baut sich die
Analyse der Spätwerke einiger Meister auf. Früh- und Spätwerke von Tizian, Michel-
angelo, Hals, Murillo, Rembrandt, Donatello, Lionardo, Dürer, Bernini, Rubens und
Reichel werden in einem ganz neuen Sinne einander gegenübergestellt.
Wie alles, was der Kölner Gelehrte schreibt, verdient auch die jüngste Arbeit
in Anlage, Durchführung und Formung allgemeines Interesse, und es ist zuzugeben,
daß seine Beweisführung, mit logischer Schärfe an den ausgewählten Beispielen
durchgeführt, zwingend ist. Jeder Leser wird aus anderen Viten weiteres Material
beizubringen wissen, das Brinckmanns Dokumentensammlung ergänzt. Poussin,
Claude Lorrain, Courbet, Monet und andere fügen sich in Brinckmanns Reihe ein,
so daß »die Parallelität immer bemerkenswerter wird«. Trotzdem liegt in der Aus-
wahl eine gewisse Einseitigkeit. Die Spätwerke von Ingres, David, Prudhon, Feuer-
bach, Menzel, Thoma und andere widersprechen Brinckmanns These. Ich weiß nicht,
ob Brinckmann auf sie schlechthin »die zweite Wandlung« zur Anwendung bringen
will, die er »das beginnende Greisenalter, etwas Seniles, Verbrauchtes« nennt. Mir
fällt dagegen ein Satz Eduard Sprangers ein: »Bei wie vielen endet der ästhetische
Enthusiasmus in einer stoisch-rationalen Selbstbegrenzung!« Würde dieser Satz sich
nicht vor allem auf Menzel anwenden lassen? Ein anderes Mal spricht Spranger
»von der Synthese, die nicht gelingt, und daß die Tragik eines unausgeglichenen
Lebenswiderspruches bleibt«. Könnte dieser Satz nicht auf Feuerbach exemplifiziert
werden? Wenige Zeilen darauf heißt es bei Spranger: »Der Strom der Lebenskräfte
erträgt es nicht, immer nur in der einen, einmal ausgegrabenen Flutrinne zu laufen.
Die hinter jeder Einseitigkeit liegende göttliche Totalität des Lebens strömt über und
sucht sich neue Bahnen.« Als Beispiele für diese These führt Spranger Rousseau,
Kant und Tolstoi an. Er hätte auch Goethe nennen können, den Brinckmann gerade
für seine Beweisführung in Anspruch nimmt. So anregend, so geistreich, so ver-
führerisch die kleine Abhandlung Brinckmanns ist, sie bewährt sich nicht im allge-
meinen, und wenn der Verfasser beabsichtigt, in dieser Richtung ein größeres
Werk zu schreiben, so scheint mir, daß er seine Kategorien des »typischen Wandels
innerhalb einer Bewußtseinsschicht« erweitern müßte.
Auf S. 36 macht der Verfasser in höflichster und zurückhaltendster Form einige
einschränkende Bemerkungen über Wölfflins Kategorien. Ich bin an anderer Stelle
vor Jahresfrist ausführlich für sie eingetreten und stelle mit Genugtuung fest, daß
selbst ein Kunstwissenschaftler wie Brinckmann, der intensiv am methodischen
Weiterbau der Kunstgeschichte arbeitet, im Verlauf seiner Darstellung die Wölfflin-
schen Kategorien übernimmt. Das spricht doch wieder einmal für sie.
Berlin.
Otto Grautoff.
Fraenger, Wilhelm, Die Radierungen des Hercules Seghers. Ein
physiognomischer Versuch. Mit einer farbigen Tafel und 41 schwarzen Ab-
bildungen. München u. Leipzig, E. Rentsch Verlag, 1922. S. 96 u. 32.
Fraenger nennt seine Schrift über Seghers im Untertitel einen physiognomischen
Versuch. Dort wo er in den Anmerkungen — Marginalien heißt er sie — von der
Literatur über Seghers spricht (S. 77): Bode schrieb »in drei grundlegenden Dar-
stellungen die erste Würdigung« von Seghers; Jaro Springer »hat in mustergültiger
Weise das Oeuvre des Radierers für die Wissenschaft erschlossen«; Pfisters weiteren
Kreisen dienende ausschreibende feuilietonistische Art (Hercules Seghers, München
1921) durfte übergangen werden, da stellt der Verfasser fest, daß die chronologischen
Fragen und das technische Problem der Radierungen von Seghers unbearbeitet ge-
361
letzten, weiten Blick im Angesicht der Ewigkeit«. Auf dieser These baut sich die
Analyse der Spätwerke einiger Meister auf. Früh- und Spätwerke von Tizian, Michel-
angelo, Hals, Murillo, Rembrandt, Donatello, Lionardo, Dürer, Bernini, Rubens und
Reichel werden in einem ganz neuen Sinne einander gegenübergestellt.
Wie alles, was der Kölner Gelehrte schreibt, verdient auch die jüngste Arbeit
in Anlage, Durchführung und Formung allgemeines Interesse, und es ist zuzugeben,
daß seine Beweisführung, mit logischer Schärfe an den ausgewählten Beispielen
durchgeführt, zwingend ist. Jeder Leser wird aus anderen Viten weiteres Material
beizubringen wissen, das Brinckmanns Dokumentensammlung ergänzt. Poussin,
Claude Lorrain, Courbet, Monet und andere fügen sich in Brinckmanns Reihe ein,
so daß »die Parallelität immer bemerkenswerter wird«. Trotzdem liegt in der Aus-
wahl eine gewisse Einseitigkeit. Die Spätwerke von Ingres, David, Prudhon, Feuer-
bach, Menzel, Thoma und andere widersprechen Brinckmanns These. Ich weiß nicht,
ob Brinckmann auf sie schlechthin »die zweite Wandlung« zur Anwendung bringen
will, die er »das beginnende Greisenalter, etwas Seniles, Verbrauchtes« nennt. Mir
fällt dagegen ein Satz Eduard Sprangers ein: »Bei wie vielen endet der ästhetische
Enthusiasmus in einer stoisch-rationalen Selbstbegrenzung!« Würde dieser Satz sich
nicht vor allem auf Menzel anwenden lassen? Ein anderes Mal spricht Spranger
»von der Synthese, die nicht gelingt, und daß die Tragik eines unausgeglichenen
Lebenswiderspruches bleibt«. Könnte dieser Satz nicht auf Feuerbach exemplifiziert
werden? Wenige Zeilen darauf heißt es bei Spranger: »Der Strom der Lebenskräfte
erträgt es nicht, immer nur in der einen, einmal ausgegrabenen Flutrinne zu laufen.
Die hinter jeder Einseitigkeit liegende göttliche Totalität des Lebens strömt über und
sucht sich neue Bahnen.« Als Beispiele für diese These führt Spranger Rousseau,
Kant und Tolstoi an. Er hätte auch Goethe nennen können, den Brinckmann gerade
für seine Beweisführung in Anspruch nimmt. So anregend, so geistreich, so ver-
führerisch die kleine Abhandlung Brinckmanns ist, sie bewährt sich nicht im allge-
meinen, und wenn der Verfasser beabsichtigt, in dieser Richtung ein größeres
Werk zu schreiben, so scheint mir, daß er seine Kategorien des »typischen Wandels
innerhalb einer Bewußtseinsschicht« erweitern müßte.
Auf S. 36 macht der Verfasser in höflichster und zurückhaltendster Form einige
einschränkende Bemerkungen über Wölfflins Kategorien. Ich bin an anderer Stelle
vor Jahresfrist ausführlich für sie eingetreten und stelle mit Genugtuung fest, daß
selbst ein Kunstwissenschaftler wie Brinckmann, der intensiv am methodischen
Weiterbau der Kunstgeschichte arbeitet, im Verlauf seiner Darstellung die Wölfflin-
schen Kategorien übernimmt. Das spricht doch wieder einmal für sie.
Berlin.
Otto Grautoff.
Fraenger, Wilhelm, Die Radierungen des Hercules Seghers. Ein
physiognomischer Versuch. Mit einer farbigen Tafel und 41 schwarzen Ab-
bildungen. München u. Leipzig, E. Rentsch Verlag, 1922. S. 96 u. 32.
Fraenger nennt seine Schrift über Seghers im Untertitel einen physiognomischen
Versuch. Dort wo er in den Anmerkungen — Marginalien heißt er sie — von der
Literatur über Seghers spricht (S. 77): Bode schrieb »in drei grundlegenden Dar-
stellungen die erste Würdigung« von Seghers; Jaro Springer »hat in mustergültiger
Weise das Oeuvre des Radierers für die Wissenschaft erschlossen«; Pfisters weiteren
Kreisen dienende ausschreibende feuilietonistische Art (Hercules Seghers, München
1921) durfte übergangen werden, da stellt der Verfasser fest, daß die chronologischen
Fragen und das technische Problem der Radierungen von Seghers unbearbeitet ge-