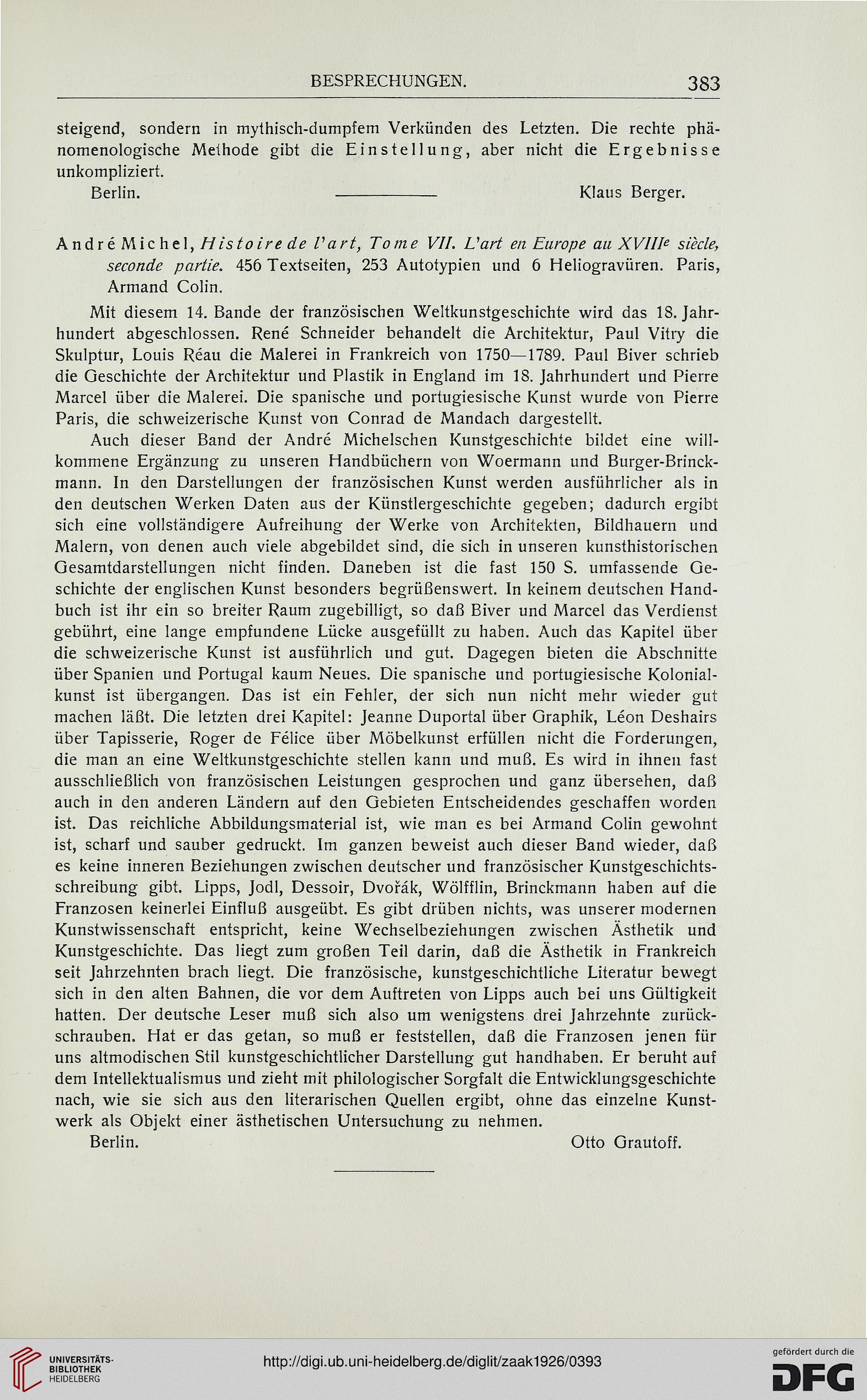BESPRECHUNGEN.
383
steigend, sondern in mythisch-dumpfem Verkünden des Letzten. Die rechte phä-
nomenologische Methode gibt die Einstellung, aber nicht die Ergebnisse
unkompliziert.
Berlin. - Klaus Berger.
Andre Michel, H isto ire de V art, To m e VII. Vart en Europe au XVIHe siede,
seconde partie. 456 Textseiten, 253 Autotypien und 6 Heliogravüren. Paris,
Armand Colin.
Mit diesem 14. Bande der französischen Weltkunstgeschichte wird das 18. Jahr-
hundert abgeschlossen. Rene Schneider behandelt die Architektur, Paul Vitry die
Skulptur, Louis Reau die Malerei in Frankreich von 1750—1789. Paul Biver schrieb
die Geschichte der Architektur und Plastik in England im 18. Jahrhundert und Pierre
Marcel über die Malerei. Die spanische und portugiesische Kunst wurde von Pierre
Paris, die schweizerische Kunst von Conrad de Mandach dargestellt.
Auch dieser Band der Andre Michelschen Kunstgeschichte bildet eine will-
kommene Ergänzung zu unseren Handbüchern von Woermann und Burger-Brinck-
mann. In den Darstellungen der französischen Kunst werden ausführlicher als in
den deutschen Werken Daten aus der Künstlergeschichte gegeben; dadurch ergibt
sich eine vollständigere Aufreihung der Werke von Architekten, Bildhauern und
Malern, von denen auch viele abgebildet sind, die sich in unseren kunsthistorischen
Gesamtdarstellungen nicht finden. Daneben ist die fast 150 S. umfassende Ge-
schichte der englischen Kunst besonders begrüßenswert. In keinem deutschen Hand-
buch ist ihr ein so breiter Raum zugebilligt, so daß Biver und Marcel das Verdienst
gebührt, eine lange empfundene Lücke ausgefüllt zu haben. Auch das Kapitel über
die schweizerische Kunst ist ausführlich und gut. Dagegen bieten die Abschnitte
über Spanien und Portugal kaum Neues. Die spanische und portugiesische Kolonial-
kunst ist übergangen. Das ist ein Fehler, der sich nun nicht mehr wieder gut
machen läßt. Die letzten drei Kapitel: Jeanne Duportal über Graphik, Leon Deshairs
über Tapisserie, Roger de Feiice über Möbelkunst erfüllen nicht die Forderungen,
die man an eine Weltkunstgeschichte stellen kann und muß. Es wird in ihnen fast
ausschließlich von französischen Leistungen gesprochen und ganz übersehen, daß
auch in den anderen Ländern auf den Gebieten Entscheidendes geschaffen worden
ist. Das reichliche Abbildungsmaterial ist, wie man es bei Armand Colin gewohnt
ist, scharf und sauber gedruckt. Im ganzen beweist auch dieser Band wieder, daß
es keine inneren Beziehungen zwischen deutscher und französischer Kunstgeschichts-
schreibung gibt. Lipps, Jodl, Dessoir, Dvofäk, Wölfflin, Brinckmann haben auf die
Franzosen keinerlei Einfluß ausgeübt. Es gibt drüben nichts, was unserer modernen
Kunstwissenschaft entspricht, keine Wechselbeziehungen zwischen Ästhetik und
Kunstgeschichte. Das liegt zum großen Teil darin, daß die Ästhetik in Frankreich
seit Jahrzehnten brach liegt. Die französische, kunstgeschichtliche Literatur bewegt
sich in den alten Bahnen, die vor dem Auftreten von Lipps auch bei uns Gültigkeit
hatten. Der deutsche Leser muß sich also um wenigstens drei Jahrzehnte zurück-
schrauben. Hat er das getan, so muß er feststellen, daß die Franzosen jenen für
uns altmodischen Stil kunstgeschichtlicher Darstellung gut handhaben. Er beruht auf
dem Intellektualismus und zieht mit philologischer Sorgfalt die Entwicklungsgeschichte
nach, wie sie sich aus den literarischen Quellen ergibt, ohne das einzelne Kunst-
werk als Objekt einer ästhetischen Untersuchung zu nehmen.
Berlin. Otto Grautoff.
383
steigend, sondern in mythisch-dumpfem Verkünden des Letzten. Die rechte phä-
nomenologische Methode gibt die Einstellung, aber nicht die Ergebnisse
unkompliziert.
Berlin. - Klaus Berger.
Andre Michel, H isto ire de V art, To m e VII. Vart en Europe au XVIHe siede,
seconde partie. 456 Textseiten, 253 Autotypien und 6 Heliogravüren. Paris,
Armand Colin.
Mit diesem 14. Bande der französischen Weltkunstgeschichte wird das 18. Jahr-
hundert abgeschlossen. Rene Schneider behandelt die Architektur, Paul Vitry die
Skulptur, Louis Reau die Malerei in Frankreich von 1750—1789. Paul Biver schrieb
die Geschichte der Architektur und Plastik in England im 18. Jahrhundert und Pierre
Marcel über die Malerei. Die spanische und portugiesische Kunst wurde von Pierre
Paris, die schweizerische Kunst von Conrad de Mandach dargestellt.
Auch dieser Band der Andre Michelschen Kunstgeschichte bildet eine will-
kommene Ergänzung zu unseren Handbüchern von Woermann und Burger-Brinck-
mann. In den Darstellungen der französischen Kunst werden ausführlicher als in
den deutschen Werken Daten aus der Künstlergeschichte gegeben; dadurch ergibt
sich eine vollständigere Aufreihung der Werke von Architekten, Bildhauern und
Malern, von denen auch viele abgebildet sind, die sich in unseren kunsthistorischen
Gesamtdarstellungen nicht finden. Daneben ist die fast 150 S. umfassende Ge-
schichte der englischen Kunst besonders begrüßenswert. In keinem deutschen Hand-
buch ist ihr ein so breiter Raum zugebilligt, so daß Biver und Marcel das Verdienst
gebührt, eine lange empfundene Lücke ausgefüllt zu haben. Auch das Kapitel über
die schweizerische Kunst ist ausführlich und gut. Dagegen bieten die Abschnitte
über Spanien und Portugal kaum Neues. Die spanische und portugiesische Kolonial-
kunst ist übergangen. Das ist ein Fehler, der sich nun nicht mehr wieder gut
machen läßt. Die letzten drei Kapitel: Jeanne Duportal über Graphik, Leon Deshairs
über Tapisserie, Roger de Feiice über Möbelkunst erfüllen nicht die Forderungen,
die man an eine Weltkunstgeschichte stellen kann und muß. Es wird in ihnen fast
ausschließlich von französischen Leistungen gesprochen und ganz übersehen, daß
auch in den anderen Ländern auf den Gebieten Entscheidendes geschaffen worden
ist. Das reichliche Abbildungsmaterial ist, wie man es bei Armand Colin gewohnt
ist, scharf und sauber gedruckt. Im ganzen beweist auch dieser Band wieder, daß
es keine inneren Beziehungen zwischen deutscher und französischer Kunstgeschichts-
schreibung gibt. Lipps, Jodl, Dessoir, Dvofäk, Wölfflin, Brinckmann haben auf die
Franzosen keinerlei Einfluß ausgeübt. Es gibt drüben nichts, was unserer modernen
Kunstwissenschaft entspricht, keine Wechselbeziehungen zwischen Ästhetik und
Kunstgeschichte. Das liegt zum großen Teil darin, daß die Ästhetik in Frankreich
seit Jahrzehnten brach liegt. Die französische, kunstgeschichtliche Literatur bewegt
sich in den alten Bahnen, die vor dem Auftreten von Lipps auch bei uns Gültigkeit
hatten. Der deutsche Leser muß sich also um wenigstens drei Jahrzehnte zurück-
schrauben. Hat er das getan, so muß er feststellen, daß die Franzosen jenen für
uns altmodischen Stil kunstgeschichtlicher Darstellung gut handhaben. Er beruht auf
dem Intellektualismus und zieht mit philologischer Sorgfalt die Entwicklungsgeschichte
nach, wie sie sich aus den literarischen Quellen ergibt, ohne das einzelne Kunst-
werk als Objekt einer ästhetischen Untersuchung zu nehmen.
Berlin. Otto Grautoff.