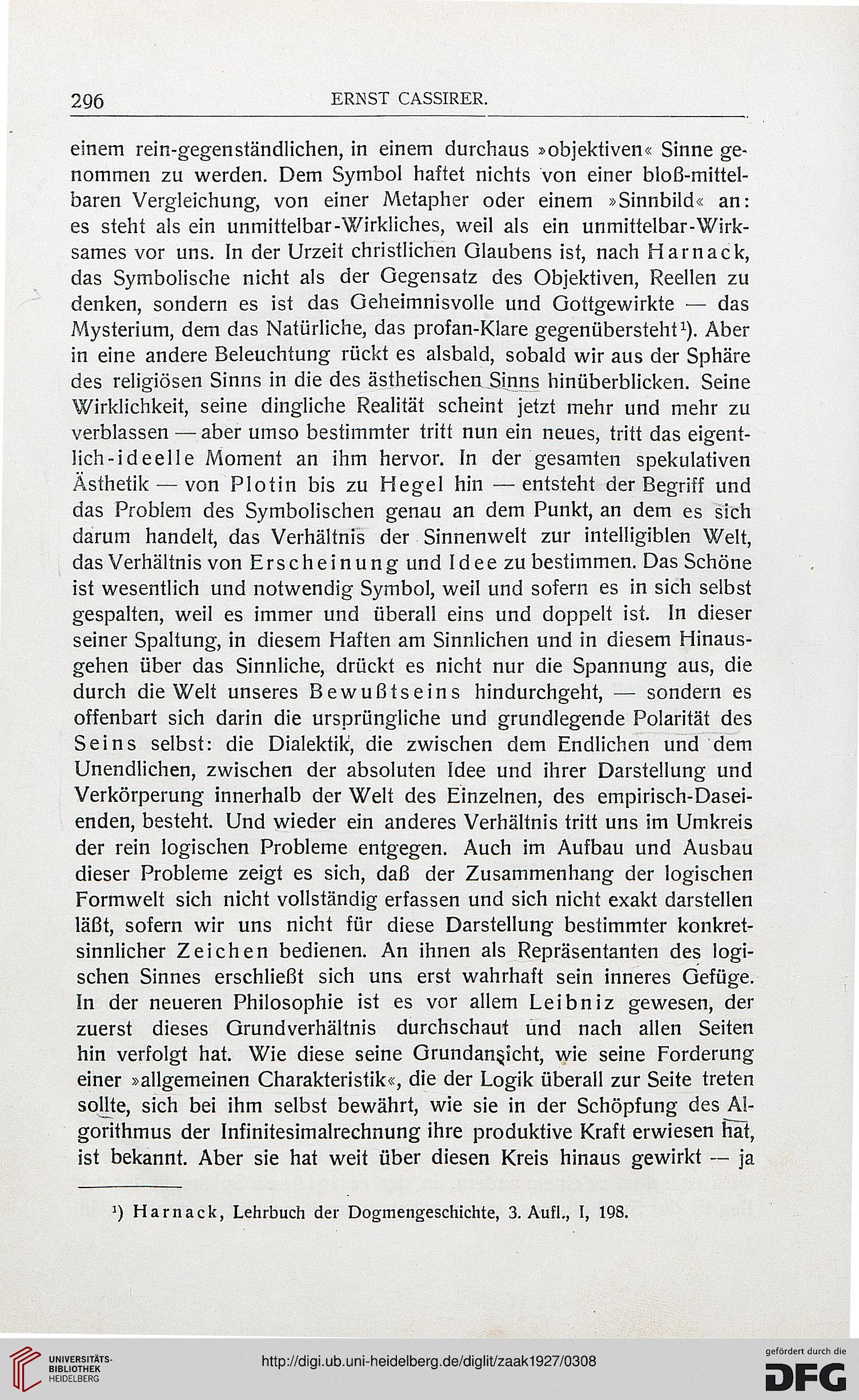296
ERNST CASSIRER.
einem rein-gegenständlichen, in einem durchaus »objektiven« Sinne ge-
nommen zu werden. Dem Symbol haftet nichts von einer bloß-mittel-
baren Vergleichung, von einer Metapher oder einem »Sinnbild« an:
es steht als ein unmittelbar-Wirkliches, weil als ein unmittelbar-Wirk-
sames vor uns. In der Urzeit christlichen Glaubens ist, nach Harnack,
das Symbolische nicht als der Gegensatz des Objektiven, Reellen zu
denken, sondern es ist das Geheimnisvolle und Gottgewirkte — das
Mysterium, dem das Natürliche, das profan-Klare gegenübersteht1). Aber
in eine andere Beleuchtung rückt es alsbald, sobald wir aus der Sphäre
des religiösen Sinns in die des ästhetischen Sinns hinüberblicken. Seine
Wirklichkeit, seine dingliche Realität scheint jetzt mehr und mehr zu
verblassen — aber umso bestimmter tritt nun ein neues, tritt das eigent-
lich-ideelle Moment an ihm hervor. In der gesamten spekulativen
Ästhetik — von Plotin bis zu Hegel hin —entsteht der Begriff und
das Problem des Symbolischen genau an dem Punkt, an dem es sich
darum handelt, das Verhältnis der Sinnenwelt zur intelligiblen Welt,
das Verhältnis von Erscheinung und Idee zu bestimmen. Das Schöne
ist wesentlich und notwendig Symbol, weil und sofern es in sich selbst
gespalten, weil es immer und überall eins und doppelt ist. In dieser
seiner Spaltung, in diesem Haften am Sinnlichen und in diesem Hinaus-
gehen über das Sinnliche, drückt es nicht nur die Spannung aus, die
durch die Welt unseres Bewußtseins hindurchgeht, — sondern es
offenbart sich darin die ursprüngliche und grundlegende Polarität des
Seins selbst: die Dialektik, die zwischen dem Endlichen und dem
Unendlichen, zwischen der absoluten Idee und ihrer Darstellung und
Verkörperung innerhalb der Welt des Einzelnen, des empirisch-Dasei-
enden, besteht. Und wieder ein anderes Verhältnis tritt uns im Umkreis
der rein logischen Probleme entgegen. Auch im Aufbau und Ausbau
dieser Probleme zeigt es sich, daß der Zusammenhang der logischen
Formwelt sich nicht vollständig erfassen und sich nicht exakt darstellen
läßt, sofern wir uns nicht für diese Darstellung bestimmter konkret-
sinnlicher Zeichen bedienen. An ihnen als Repräsentanten des logi-
schen Sinnes erschließt sich uns erst wahrhaft sein inneres Gefüge.
In der neueren Philosophie ist es vor allem Leibniz gewesen, der
zuerst dieses Grundverhältnis durchschaut und nach allen Seiten
hin verfolgt hat. Wie diese seine Grundansjcht, wie seine Forderung
einer »allgemeinen Charakteristik«, die der Logik überall zur Seite treten
sollte, sich bei ihm selbst bewährt, wie sie in der Schöpfung des Al-
gorithmus der Infinitesimalrechnung ihre produktive Kraft erwiesen hat,
ist bekannt. Aber sie hat weit über diesen Kreis hinaus gewirkt — ja
') Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3. Aufl., I, 198.
ERNST CASSIRER.
einem rein-gegenständlichen, in einem durchaus »objektiven« Sinne ge-
nommen zu werden. Dem Symbol haftet nichts von einer bloß-mittel-
baren Vergleichung, von einer Metapher oder einem »Sinnbild« an:
es steht als ein unmittelbar-Wirkliches, weil als ein unmittelbar-Wirk-
sames vor uns. In der Urzeit christlichen Glaubens ist, nach Harnack,
das Symbolische nicht als der Gegensatz des Objektiven, Reellen zu
denken, sondern es ist das Geheimnisvolle und Gottgewirkte — das
Mysterium, dem das Natürliche, das profan-Klare gegenübersteht1). Aber
in eine andere Beleuchtung rückt es alsbald, sobald wir aus der Sphäre
des religiösen Sinns in die des ästhetischen Sinns hinüberblicken. Seine
Wirklichkeit, seine dingliche Realität scheint jetzt mehr und mehr zu
verblassen — aber umso bestimmter tritt nun ein neues, tritt das eigent-
lich-ideelle Moment an ihm hervor. In der gesamten spekulativen
Ästhetik — von Plotin bis zu Hegel hin —entsteht der Begriff und
das Problem des Symbolischen genau an dem Punkt, an dem es sich
darum handelt, das Verhältnis der Sinnenwelt zur intelligiblen Welt,
das Verhältnis von Erscheinung und Idee zu bestimmen. Das Schöne
ist wesentlich und notwendig Symbol, weil und sofern es in sich selbst
gespalten, weil es immer und überall eins und doppelt ist. In dieser
seiner Spaltung, in diesem Haften am Sinnlichen und in diesem Hinaus-
gehen über das Sinnliche, drückt es nicht nur die Spannung aus, die
durch die Welt unseres Bewußtseins hindurchgeht, — sondern es
offenbart sich darin die ursprüngliche und grundlegende Polarität des
Seins selbst: die Dialektik, die zwischen dem Endlichen und dem
Unendlichen, zwischen der absoluten Idee und ihrer Darstellung und
Verkörperung innerhalb der Welt des Einzelnen, des empirisch-Dasei-
enden, besteht. Und wieder ein anderes Verhältnis tritt uns im Umkreis
der rein logischen Probleme entgegen. Auch im Aufbau und Ausbau
dieser Probleme zeigt es sich, daß der Zusammenhang der logischen
Formwelt sich nicht vollständig erfassen und sich nicht exakt darstellen
läßt, sofern wir uns nicht für diese Darstellung bestimmter konkret-
sinnlicher Zeichen bedienen. An ihnen als Repräsentanten des logi-
schen Sinnes erschließt sich uns erst wahrhaft sein inneres Gefüge.
In der neueren Philosophie ist es vor allem Leibniz gewesen, der
zuerst dieses Grundverhältnis durchschaut und nach allen Seiten
hin verfolgt hat. Wie diese seine Grundansjcht, wie seine Forderung
einer »allgemeinen Charakteristik«, die der Logik überall zur Seite treten
sollte, sich bei ihm selbst bewährt, wie sie in der Schöpfung des Al-
gorithmus der Infinitesimalrechnung ihre produktive Kraft erwiesen hat,
ist bekannt. Aber sie hat weit über diesen Kreis hinaus gewirkt — ja
') Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3. Aufl., I, 198.