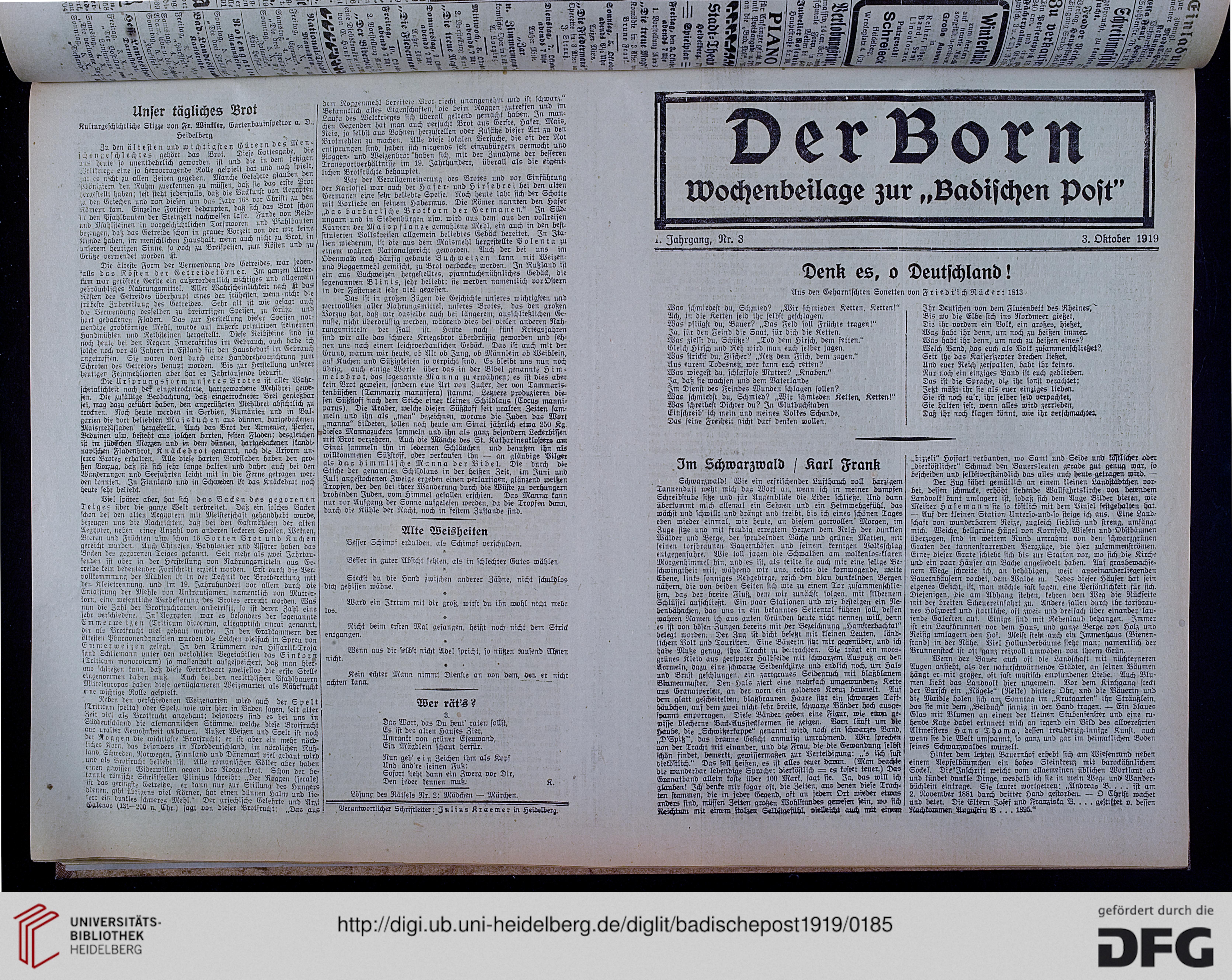Unser tagliches Brot
Kulturgeschichtliche Slizze von Fr. Winller, Eartenbcminspektor n. D..
Heidelberg
Zu den ältesten und roichtigsten E ü t e r ^ ^ s M e n -
schenceschlech 1 es kehört das Brot. Die>e Eottesüab .
uil.-- I)eute so unentbehrlich aeworden ist und die
.i^.lttricgc eine so hervorragende Rolle gespielt hat und noch >p -
,nt cs ncht zu allen Zeiten üegeben. Dianche Eelehrte klauv
Pbcniniern den Ruhm zuerkennen zu müssen. das; ste das erne
^rqcstc-lll haben: fest steht jcdenfalls. dag die Daälunst von U »t)p
,a dsn Criechen und von diesen um das ^ahr tb8 vor ^^
Römern kam. Einzelne Forscher behauptrn. dag sich^das IM
1,i den PfahlLauten der Steinzeit nachweisen las>e. ciunde von -n -
und Atbhlsteinen in vorüeschillitlichen Torsmooren und biabtoaui
beZcugcn, dast das Eetreide schon in grauer Vorzeit von der rmr l
KunLe Laben. im menschlichen Haushalt, wenn auch "lcht -owr,
unserem heutigen Sinne. so doch zu Breispeisen, MM Rosten und M
Eriitze verwendet worden ilst.
Die älteste Form der Verwendung des Eetreides. war leoen-
salls das Rösten der Eetreidelörner. ^>m gcriizen
tüm war geröstete Eerste ein austerordentlich wichtiges und uugenw.n
gebräuchliches Rahrungsmittel. Aller Wa^scheinlichkeit nach O das
Rösten dcs Detreides überhaupt eines der frühesten. wenN ENicht o,e
srüheste Zubereitung des Getreides. Sehr alt ist wie kieslrgt auch
d-- Verwendung desselben üu breiartigen Spersen. M Erutzv und
hart gebaäenen Fladen. Das zur Herstellung diesec Speiien. not-
wendige grobkörnige Mehl. wurde auf äusterst primitiven steinernen
Handmühlen und Reibsteinen hergestellt. Diiese Reibsteine >md ia
noch heutt bei den Negern Jnnerafrikas im Eebrauch, auch habe ich
solche noch vor 40 Iahren in Estland für den Hausbedarf im Gebrauch
angetrofscn. Sie waren dort durch eine Handdrehoorrichtung Zum
Cchroten des Eetreides benutzt worden. Bis zur Herstellung unserer
hculigen Feinmehlsorien aber hat es Zahrtausende bedurst.
Die Ursprungsform unseresBrotes ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach de? eingetrocknete. hartgewordene Mehlbrei gewe-
sen. Dic zufällige Beobachtung, dast eingetrockneter Brei geniehbar
sei. mag dazu geführt haben, den angerührten Mehlbrei absichtlich zu
trocknen. Noch heute werden in Serbien, Rumänien und m Bul-
garien die dort beliebten Maiskuchen cms dünnen, hartgebackenen
Liaismeylfladen hergestellt. Auch das Brot der Armenier, Perser.
Dcduinen usw. besteht aus sollhen harten, festen Fladen; desgleichen
ist im jüdSschen ALazzen und in dem dünnsn, hartgebaäsnen skcmdi-
navijchen Fladenbrot. Knäckebrot gencmnt, noch dis Urform un-
seres Brotes erhalten. Alle diese harten Brotfladen haben den gro-
ßcn Voitzug, dast si'e sich sehr lange halten und dccher auch bei den
Wanherungen und Seefcchrten leicht mit in die Ferne getragen wer-
den tonnten. Jn Finnland und in Schwrden ist Las Knäckebrot noch
heute sehr beliebt.
Viel später aber, hat sich das Dacken des gegorenen
Teiges über die ganze Welt verbreitet. Datz ein solches Backen
schon bei den alten Aegyptern mit Meisterschaft gehandhabt wurde,
bczeugen uns die Nachrichten. datz bei den Eastmählern der alten
Aegi)ptcr, neben ciner Unzahl von anderen leckeren Speisen. Welnen,
Licrm und Friichten usw. schon 16 Sorten Brot und Kuchen
gereicht wurden. Auch Chinesen. Vabylonier und Assyrer haben das
Bocken des gegorenen Teiges gekannt. Seit mehr als zwei Jahrtau-
senden isi aber in der Herstellung von Nahrungsmitteln aus Ee-
treide kein bedeutender Fortschriti erzielt worden. Erst durch die Ver-
vollkommnung der Mühlcn ist in der Technik der Brotbereitung mit
dev Kleietrennung. und im 19. Zaliruhundert vor allem durch die
Enigiftung der Mehle von Unkrautfamen. namentlich von Muttor-
lorn, einc wesentkiche Verbesserung des Brotes erreicht worden. Was
nun die Zahl der Brotfruchtarten anbetrifft, so ist deren Zahl eine
sehr oerschiedene. In'Aegyptcn war es besonders Ler sogenannte
Lmmerwe izen (Triticum dicoceum. altegyptisch emrai genannt,
dci als Brotfrucht vi'el gebaut wurde. In den Erabkaminsrn der
vltesteii Pbaraonendynastien wurden die Leichen vielfach in Spreu von
Eii-.merweizeii gelegt. Jn den Trümmern von Hissarlik-Troja
scmd Cchliemann unter den verkohlten Vegetabilien das Einkorn
(TriUcun. monocoicum) so massenhaft aufgespeichert, dast man hier-
uus schließen kann, datz diess Getreideart Meifellos die erste Stelle
«mcenommen daben must. Auch bei den neolithischen Pfcchlbarrern
lüütcleuropas haben diefe genügsameren Weizenarten als Nährfruckt
c ne wichtige Rolle gcfpielt. " ^
Ncben den verschiedenen Weinenarten wird auch der Spelt
lTriticim. spelta) oder Spelz. wie wir hier in Vaden sagen. seit alter
vict als Brotsrucht angebaut: besonders sind es bei uns "in
«uddeutschland die alemannischen Stämm-e^ wrlche diese Brotfrucht
nuc uralter Eewohncheit anbauen. Auster Weizen und Spelt ist noch
oci ^oggen die wichtigste Brotfrucht: er ist aber ein mehr nörd-
Liorn. das besonders in Norddeutschland, im nördlichen Ruh-
>and. Lchweden. Norwegen. Finnland und Dänemark viel gebaut wird
.und als Brotsrucht bcliebt ist. Alle romanischen Völker aber haben
emen g.tvisien Widerwillen gegen das Roggenbrot. Cchon der be-
tannte romische Schriftsteller Plinius schreibt: „Der Roggen (secale)
Eetreide. er lann nur zur Stillung des Hunaers
o,enen. gibi uorigens viel Körner, hat einen dünnen Halm und lie-
^unNes schweres Mehl." Der griechischs Eelehrte und Argt
Eglenos (121-200 lu Ehr.j sagt von dieser Brotsrucht: - -
dcm Roggenmehl üereitete Brot riecht unangenehin »u'd M schwar^"
Detaiintlich alles Eigeyschaften. die beim Roggen zutreffen und im
Laufa des Weltkriege's sich überall geltend gemacht haben. In man-
chen Gegenden hat man auch oersucht Brot ^^..Ebtste Hafer, Mai .
Ncis. jo selbst aus Bohnen herzustellen oder Zulätze dieser Art zu den
Biotmehlen zu machen. Alle diese lokalen Versuche. die oft der ^cot
cntsprungen sind. haben sich nirgends fest einzubürgern vermocht und
Roagen- und Weizenbrot 'haben sich. mit der Zunahme der besseren
Transportoerhältnisse im 19. Iahrhunhert, überall als die eigent-
Iichen Drotfrüchte behauptet. ^
Vor der Verallgemeinerung des Drotes und vor Einfuhrung
der Kartoffel war auch der Hafer- und Hirsebrei bei den alten
Eermanen eine sehr beliebte Speise. Noch heute labt sich dew «chotte
mit Vorliebe an seinem Habermus. Die Römer nannten den Hafer
.chas barbarische Vrotkorn der Eermanen." Zn Süd-
ungarn und in Siebenbürgen usw. wird aus dem aus den vollreifen
Körncrn üer M a i s p f l a n ze gemahlene Mehl. ein auch in den best-
siluierten Dolkskvsifen allgemein beliebtes Eebäck bereitet. Jn Jta-
lien.wiederum. ist die aus dem Maismehl hergestellte Polenta zu
einem wahren 9tationalgericht geworden. Auch der bei uns im
Odenwald noch häufig gebaute Buchweizen kann mit Weizen-
und Roggenmehl gemischt, zu Brot verbacken werden. In Rutzland ist
ein aus Vuchwsiüen hergestelltes. pfannkuchenähnliches Eebäck, die
sogeriunnten Dlinis. sehr beliebt; sie werden namentlich vor Ostern
m der Fastenzeit sebr oiel gegessen.
Das ist in grotzen Zügen die Eeschichte unseres wichtigsten und
werioollsten aller Nahrungsmittel, unseres Vrotes. das den grosien
Vorzug hat. dag wir dasselbe auch bei längerem. ausschlietzlichen Ee-
nusse, nicht überdrüssig werden, während dies Lei vielen anderen Nah-
rungsmitteln der Fall ist. Heute nach fünf Kriegsjahren
stnd wir alle das schwere Kriegsbrot überdrüssig geworden und sech-
nen uns nach einem leichtverdaulichen Eebäck. Das ist auch mit der
Erund, warum wir heute. ob Alt ob Zung. ob Männlein ob Weiblein.
auf Kuchen und Sützigkeiten so verpicht sind. Es bleibt uns nun noch
übrig, auch einige Worte über das in der Vibel genunnte Him -
inelsbrot. das sogenannte Manna zu erwähnen; es ist dies aber
lein Brot gewesen, sondern eine Art von Zucker. -er von Tammaris-
kenbüschen (Tammarix mannifera) stammt. Letztere prvdu-teren die-
sen Sützstoff nach dem Stiche einer kleinen Schildlaus (Cocus manni-
parus). Dte Araber. welche diesen Sützstoff seit uralten Aei-ten sam-
meln und ihn als „man" be.zeichne-n, woraus die Iuden das Wort
„manna" bildeten, sollen noch heute am Sinai jährlich etwa 25V Kg.
dieses MannoZuckers sammeln und ihn als ganz besondern Leäerbisfen
mil Vrot verzehren. Auch die Mönche des St. Katharinenklosters am
Stnai sanrmeln ihn in ledernen Schläuchen und benutzen ihn als
willlommenen Sützstoff, oder verkaufen ihn — an gläubige Pilger
als das himmlische Manna der Vibel. Die Lurch die
Stiche der genannten Schil-laus in der heitzen Zeit. im Iuni und
Iuli angestochenen Zweige ergeben ein-en perlartigen. glänzend weitzen
Tropfen, der den bei ihrer Wanderung durch die Wüste zu verhungern
drohcnden Juden, vom Himmel gefallen erschien. Das Manna kann
nur vor Aufgang der Sonne aufgelesen werden. da die Tropfen dcrrm.
durch die Kühle der Nacht, noch in festem Zustande sind.
Alte Weisheiten
Besser Schimpf er-ulden. als Schimpf verschulden.
Besier in guter Absicht sehlen, als in schlechter Eutes wählen
Steckst du die Hand Awischen anderer Zühne, nicht schuldlos
dich gebissen wähne.
Ward ein Ikrtum mit dir grvtz, wtrst du ihn wohl nichi mebr
Nicht beim ersten Mal gefangen. heitzt noch nicht dem Strick
entgangen.
Wenn aus dir selbst nicht Adel spricht, so nützen tausend Ahnen
Kein echter Mann nimmt Dienste an von de-m, den er nicht
achten kanu. . - ^
OerVorn
wochenbeilage zur „Saöischen post"
1. Iahrgang, Nr. 3
3. Oktober 1919
Denk es, o Deutschland!
Aus den Eeharnischten Sonetten von F r i ed rT ch R ück e r t 1813
Was schmiedest du, Schmied? „Wir schmieden Ketten. Ketten!'
Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen.
Was pslügst du, Bauer? „Das Feld soll Früchte tragen!"
Ia. für den Feind die Saat. für dich die Ketten.
Was zielsr du, Schütze? „Tod dem Hirsch, dem fetten."
Eleich Hirsch und Reh wird man euch selber jagen.
Was strickst du, Fischer? „Netz dem Fisch. dem zagen."
Aus eurem Todesuetz, wer kann euch retten?
Was wiegest du. schlaflose Mutter? „Knaben."
Ia, datz sie wachsen und dem Vaterlande
Im Dienst des Feindes Wunden schlagen sollen?
Wao schmiedst du, Schmied? „Wir schmieden Ketten, Ketten!"
Was schreibest Dichter du? Zn Glutbuchstaben
Einschreib' ich mein und meines Volkes Schande.
Das seine F-ceiheit nicht darf denken wollen.
Ihr Deutschen von dem Flutenbett des RheineS,^
Bis wo die Elbe sich ins Nordmeer gietzet,
Die ihr oordsm ein Volk. ein grotzes. hietzet.
Was habt ihr denn, um noch zu heitzen immer.
Wus habt ihr denn, um noch zu heitzen eines?
Welch Band, Las euch als Dolk zusammenschlietzet?.
Seit ihr das Kaiserszepter brechen lietzet.
Und euer Reich zerspalten. habt ihr keines.
Nur noch ein einziges Band ist euch geblieben.
Das ist die Sprache. die ihr sonst verachtet;
Zetzt mützt ihr sie als euer einziges liebsn.
Sie ist noch eu'r, ihr selber seid oerpachtet,
Sie halten fest, wenn alles wird zerrieben,
Datz ihr noch klagen könnt. mie ihr oecschmachtet.
Im Schwarzwald / Karl Frank
Schwarzwald! Wie ein ersrischender Lufthauch ooll harzigem
Tannenduft weht mich das Wort a». wenn ich in meiner dumpfen
Schreibstube sitze und sür Augenblicke die Lider schlietze. Und dann
überkommt mich allemal ein Sehneu und ein Heimwehgefühl, das
wächst und schwillt und drängt und treibt. bis ich eines schönen Tages
eben wieder einmal, wie heute. au diesem gottvollen' Morgen. im
Zuge sitze und mit freudig erregtem Herzen dem Reich der dunklen
Wälder und Berge, der sprudelnden Bäche und grünen Matten, mit
seinen torfbraunen Vauernhöfen und seinem kernigen Volksschlag
entgegenfahre. Wie toll jagen die Schwalben am wolkenlos-klaren
Morgenhimmel hin, und es ist, als teilte sie auch mir eine selige Be-
schwingtheit mit, während wir uns, rechts die kornwogende, wieite
Ebene, links sonniges Rebgebirge. rasch den bbau dunkelnden Bergen
nähern, die von beiden Seiten sich wie zu einem Tor zusammenschlie-
tzen, das der breite Flutz. dem wir zunüchst folgen. mit silbernem
Schlüssel aufschlietzt. Ein paar Stationen und wir besteigen ein Ne-
benbähnchen, das uns in ein bekanntes Seitental führen soll, dessen
wahren jltamen ich aus guten Eründen heute nicht uennen will. denn
es ist von bösen Zungen bereits mit der Bezeichnung „Hamsterbachtal"
delegt worden. Der Zug ist dicht Lesetzt mit kleinen Leuten. länd-
lichem Volk und Touristen. Eine Büuerin sitzt mir gegenüber. und ich
habe Mutze genug, ihre Tracht zu be-trachten. Sie trägt ein moos-
grünes Kleid aus gerippter Halbseide mit schwarzem Ausputz an den
Acrmeln. dazu eine schwarze Seidenschsirze und endlich noch, um Hals
und Brust geschlungei'.. ein zartaraues Seidentuch mit blatzblauem
Blnmenmuster. Den Hals ziett eine mehrfach umgewundene Kette
aus Granatperlen, an der vorn ein goldenes Kreuz baumelt. Auf
dem glatt gescheitelten, blatzbraunen Haare sitzt ein schwarzes Taft-
hüubchen, auf dem zwei nicht sehr breite. schwarze Bänder hoch ausge-
spannt emporragen. Diese Bänder geben eine Figur, wie eüwia ge-
wisie blecherne Back-Ausstecksormen sie zeigen. 3Zorn läuft um vie
Haube, bie „Schwitzerkappe" genannt wird. noch ein schwarzes Band,
„D'Spitz"'. das brcnme Gesicht anmutig umrahmend. Wir sprechen
von der Tracht init einander. und die Frau. die die Eewaiwung selbst
schön findet, bemertt, gewisiermatzen zur Verteidigung: „ s isch sust
dieköstlich." Das soll heitzen. es ist alles teuer daran. (Man beachte
die iwunderbar leb?ndige Sprache: dierköstlich — es kostet teuer.) Das
Granatbcmd allein koste über 100 Mark. sagt ste. Ia. das will ich
glauben! Ich denke mir sogar oft, die Zeiten. aus denen diese Trach-
ten stammen, die in jeder Gegend, oft an jedem Ort wreder ettoas
cmdrrs sind, müsien Zeiten grotzen Wohlstandes gewesen sein, wo stch
L^chttun mit eineW stolzen Selbstgefühl. vielleicht auch nvit «EM
„bizzeli" Hoffart verbanden. wo Samt und Seide und kostlicher oder
..dierköftlicher" Schmuck den Bauersleuten gerade gut genug war, so
bescheiden und selbftverständlich das alles auch heute getragen wrrd. —
Der Zug fährt gemütlich an einem kleinen Landstüdtchen oor-
bei, dessen schmucke, erhöht stehende Wallfahttskirche oon Letendem
Landoolk bunt umlagert ist. sodatz sich dem Auge Bilder bieten. wie
Meister Hasemann ste so köstlich mit dem Pinsel festgehalten hat.
— Auf der kleinen Station Unterso-und-so steige ich aus. Eine Laud-
schaft oon wunderbarem Reize. zugleich lieblich und streng. umfängt
mich. Weiche, hellgrüne Hügel von Kornfeld. Wiesen und Obstbäumen
überzogen, sind in weitem Rund umrahmt von den schwarzgrünen
Eraten der tannenstarrenden Bergzüge, die hier zuscnnmenströmen.
Einer dieser Erate schiebt sich bis zur Station vor, wo sich die Kirche
und ein paar Häuser am Bache angesiÄrelt haben. Auf grasbewachse-
nem Wege schreite ich. an behäbigen, weit auseinanderliegenden
Bauernhäusertt vorbei. dem Walde zu. Iedes dieser Häuser hät sein
eigenes Gesicht, ist, man möchte fast sagen. eine Perfönlichkeit für sich.
Diejenigen, die am Abhang stehen, kehren dem Weg die Rückseite
mit der breiten Scheuereinfahrt zu. Andere fallen durch ibr torfbrau-
ncs Holzwerk und stattliche. oft zwei- und dreisach über einander lau-
fende Ealerien auf. Einige sind mit Rebenlaub behangen. Jmmer
ist ein Laufbruniren vor dem Haus. und ganze Berge von Holz und
Reisig umlagern den Hof. Meist steh-t auch ein Immenhaus (Bienen-
stand) in der Nähe. Viel Hollunderbäume sieht man; namentlich der
Brunnenstock ist oft ganz reizvoll umwoben von ihrem Grün.
Wenn der Bauer cnich ost die Landschaft mit nüchterneren
Augen ansieht, als der nüturschwärmende Städter, an seinen Bäumen
hängt er mit grotzer. oft fast mystisch empfundener Liebe. Auch Blu-
men liebt das Landoolk hier ungemein. Vor dem Kirchgang steckt
der Bursch ein „NägAe" (Nelke) hinters Ohr. und die Bäuerin und
die Maidle holen sich am Sonntag im .Krutgatten" ihr Sttäutzlein,
das sie mit dem .Ketbuch^ sinnig in der Hand ttagsn. — Ein blaues
Glas mit Blumen an einem der kleinen Stubenfenstor und eine ru-
hende Katze dabei erinnert mich an irgend ein Bild des allverehtten
Altmeisters Hans Thoma, desien treuherzig-innige Kunst, auch
wenn sie die Welt umspannt, so ganz und gar im heimatlichen Boden
seines Schwarzwaldes wurzelt.
Hinter dem Letzten Dauernhof erhebt sich crm Wiesenrmid neben
einem Aepfelbäumchen ein hohes Steinkreuz init barockähnlichem
Sockel. Die'Jnschrift weicht vom allaemeinen üblichen Wottlcmt ab
und kündet .dunkle Dinge, weshalb ich sie in mein Weg- und Wander-
büchlein einttage. Sie lautet wottgetreu: „Andreas B. . . . ist am
2. November 1881 durch dtttter Hand gestorben. — O Christ wachet
und betet. Die Eltern Iotzef und Franziska D. . . . gesttfpet o. desien
Nachkonullen Augukttu B . . . 1895."
Kulturgeschichtliche Slizze von Fr. Winller, Eartenbcminspektor n. D..
Heidelberg
Zu den ältesten und roichtigsten E ü t e r ^ ^ s M e n -
schenceschlech 1 es kehört das Brot. Die>e Eottesüab .
uil.-- I)eute so unentbehrlich aeworden ist und die
.i^.lttricgc eine so hervorragende Rolle gespielt hat und noch >p -
,nt cs ncht zu allen Zeiten üegeben. Dianche Eelehrte klauv
Pbcniniern den Ruhm zuerkennen zu müssen. das; ste das erne
^rqcstc-lll haben: fest steht jcdenfalls. dag die Daälunst von U »t)p
,a dsn Criechen und von diesen um das ^ahr tb8 vor ^^
Römern kam. Einzelne Forscher behauptrn. dag sich^das IM
1,i den PfahlLauten der Steinzeit nachweisen las>e. ciunde von -n -
und Atbhlsteinen in vorüeschillitlichen Torsmooren und biabtoaui
beZcugcn, dast das Eetreide schon in grauer Vorzeit von der rmr l
KunLe Laben. im menschlichen Haushalt, wenn auch "lcht -owr,
unserem heutigen Sinne. so doch zu Breispeisen, MM Rosten und M
Eriitze verwendet worden ilst.
Die älteste Form der Verwendung des Eetreides. war leoen-
salls das Rösten der Eetreidelörner. ^>m gcriizen
tüm war geröstete Eerste ein austerordentlich wichtiges und uugenw.n
gebräuchliches Rahrungsmittel. Aller Wa^scheinlichkeit nach O das
Rösten dcs Detreides überhaupt eines der frühesten. wenN ENicht o,e
srüheste Zubereitung des Getreides. Sehr alt ist wie kieslrgt auch
d-- Verwendung desselben üu breiartigen Spersen. M Erutzv und
hart gebaäenen Fladen. Das zur Herstellung diesec Speiien. not-
wendige grobkörnige Mehl. wurde auf äusterst primitiven steinernen
Handmühlen und Reibsteinen hergestellt. Diiese Reibsteine >md ia
noch heutt bei den Negern Jnnerafrikas im Eebrauch, auch habe ich
solche noch vor 40 Iahren in Estland für den Hausbedarf im Gebrauch
angetrofscn. Sie waren dort durch eine Handdrehoorrichtung Zum
Cchroten des Eetreides benutzt worden. Bis zur Herstellung unserer
hculigen Feinmehlsorien aber hat es Zahrtausende bedurst.
Die Ursprungsform unseresBrotes ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach de? eingetrocknete. hartgewordene Mehlbrei gewe-
sen. Dic zufällige Beobachtung, dast eingetrockneter Brei geniehbar
sei. mag dazu geführt haben, den angerührten Mehlbrei absichtlich zu
trocknen. Noch heute werden in Serbien, Rumänien und m Bul-
garien die dort beliebten Maiskuchen cms dünnen, hartgebackenen
Liaismeylfladen hergestellt. Auch das Brot der Armenier, Perser.
Dcduinen usw. besteht aus sollhen harten, festen Fladen; desgleichen
ist im jüdSschen ALazzen und in dem dünnsn, hartgebaäsnen skcmdi-
navijchen Fladenbrot. Knäckebrot gencmnt, noch dis Urform un-
seres Brotes erhalten. Alle diese harten Brotfladen haben den gro-
ßcn Voitzug, dast si'e sich sehr lange halten und dccher auch bei den
Wanherungen und Seefcchrten leicht mit in die Ferne getragen wer-
den tonnten. Jn Finnland und in Schwrden ist Las Knäckebrot noch
heute sehr beliebt.
Viel später aber, hat sich das Dacken des gegorenen
Teiges über die ganze Welt verbreitet. Datz ein solches Backen
schon bei den alten Aegyptern mit Meisterschaft gehandhabt wurde,
bczeugen uns die Nachrichten. datz bei den Eastmählern der alten
Aegi)ptcr, neben ciner Unzahl von anderen leckeren Speisen. Welnen,
Licrm und Friichten usw. schon 16 Sorten Brot und Kuchen
gereicht wurden. Auch Chinesen. Vabylonier und Assyrer haben das
Bocken des gegorenen Teiges gekannt. Seit mehr als zwei Jahrtau-
senden isi aber in der Herstellung von Nahrungsmitteln aus Ee-
treide kein bedeutender Fortschriti erzielt worden. Erst durch die Ver-
vollkommnung der Mühlcn ist in der Technik der Brotbereitung mit
dev Kleietrennung. und im 19. Zaliruhundert vor allem durch die
Enigiftung der Mehle von Unkrautfamen. namentlich von Muttor-
lorn, einc wesentkiche Verbesserung des Brotes erreicht worden. Was
nun die Zahl der Brotfruchtarten anbetrifft, so ist deren Zahl eine
sehr oerschiedene. In'Aegyptcn war es besonders Ler sogenannte
Lmmerwe izen (Triticum dicoceum. altegyptisch emrai genannt,
dci als Brotfrucht vi'el gebaut wurde. In den Erabkaminsrn der
vltesteii Pbaraonendynastien wurden die Leichen vielfach in Spreu von
Eii-.merweizeii gelegt. Jn den Trümmern von Hissarlik-Troja
scmd Cchliemann unter den verkohlten Vegetabilien das Einkorn
(TriUcun. monocoicum) so massenhaft aufgespeichert, dast man hier-
uus schließen kann, datz diess Getreideart Meifellos die erste Stelle
«mcenommen daben must. Auch bei den neolithischen Pfcchlbarrern
lüütcleuropas haben diefe genügsameren Weizenarten als Nährfruckt
c ne wichtige Rolle gcfpielt. " ^
Ncben den verschiedenen Weinenarten wird auch der Spelt
lTriticim. spelta) oder Spelz. wie wir hier in Vaden sagen. seit alter
vict als Brotsrucht angebaut: besonders sind es bei uns "in
«uddeutschland die alemannischen Stämm-e^ wrlche diese Brotfrucht
nuc uralter Eewohncheit anbauen. Auster Weizen und Spelt ist noch
oci ^oggen die wichtigste Brotfrucht: er ist aber ein mehr nörd-
Liorn. das besonders in Norddeutschland, im nördlichen Ruh-
>and. Lchweden. Norwegen. Finnland und Dänemark viel gebaut wird
.und als Brotsrucht bcliebt ist. Alle romanischen Völker aber haben
emen g.tvisien Widerwillen gegen das Roggenbrot. Cchon der be-
tannte romische Schriftsteller Plinius schreibt: „Der Roggen (secale)
Eetreide. er lann nur zur Stillung des Hunaers
o,enen. gibi uorigens viel Körner, hat einen dünnen Halm und lie-
^unNes schweres Mehl." Der griechischs Eelehrte und Argt
Eglenos (121-200 lu Ehr.j sagt von dieser Brotsrucht: - -
dcm Roggenmehl üereitete Brot riecht unangenehin »u'd M schwar^"
Detaiintlich alles Eigeyschaften. die beim Roggen zutreffen und im
Laufa des Weltkriege's sich überall geltend gemacht haben. In man-
chen Gegenden hat man auch oersucht Brot ^^..Ebtste Hafer, Mai .
Ncis. jo selbst aus Bohnen herzustellen oder Zulätze dieser Art zu den
Biotmehlen zu machen. Alle diese lokalen Versuche. die oft der ^cot
cntsprungen sind. haben sich nirgends fest einzubürgern vermocht und
Roagen- und Weizenbrot 'haben sich. mit der Zunahme der besseren
Transportoerhältnisse im 19. Iahrhunhert, überall als die eigent-
Iichen Drotfrüchte behauptet. ^
Vor der Verallgemeinerung des Drotes und vor Einfuhrung
der Kartoffel war auch der Hafer- und Hirsebrei bei den alten
Eermanen eine sehr beliebte Speise. Noch heute labt sich dew «chotte
mit Vorliebe an seinem Habermus. Die Römer nannten den Hafer
.chas barbarische Vrotkorn der Eermanen." Zn Süd-
ungarn und in Siebenbürgen usw. wird aus dem aus den vollreifen
Körncrn üer M a i s p f l a n ze gemahlene Mehl. ein auch in den best-
siluierten Dolkskvsifen allgemein beliebtes Eebäck bereitet. Jn Jta-
lien.wiederum. ist die aus dem Maismehl hergestellte Polenta zu
einem wahren 9tationalgericht geworden. Auch der bei uns im
Odenwald noch häufig gebaute Buchweizen kann mit Weizen-
und Roggenmehl gemischt, zu Brot verbacken werden. In Rutzland ist
ein aus Vuchwsiüen hergestelltes. pfannkuchenähnliches Eebäck, die
sogeriunnten Dlinis. sehr beliebt; sie werden namentlich vor Ostern
m der Fastenzeit sebr oiel gegessen.
Das ist in grotzen Zügen die Eeschichte unseres wichtigsten und
werioollsten aller Nahrungsmittel, unseres Vrotes. das den grosien
Vorzug hat. dag wir dasselbe auch bei längerem. ausschlietzlichen Ee-
nusse, nicht überdrüssig werden, während dies Lei vielen anderen Nah-
rungsmitteln der Fall ist. Heute nach fünf Kriegsjahren
stnd wir alle das schwere Kriegsbrot überdrüssig geworden und sech-
nen uns nach einem leichtverdaulichen Eebäck. Das ist auch mit der
Erund, warum wir heute. ob Alt ob Zung. ob Männlein ob Weiblein.
auf Kuchen und Sützigkeiten so verpicht sind. Es bleibt uns nun noch
übrig, auch einige Worte über das in der Vibel genunnte Him -
inelsbrot. das sogenannte Manna zu erwähnen; es ist dies aber
lein Brot gewesen, sondern eine Art von Zucker. -er von Tammaris-
kenbüschen (Tammarix mannifera) stammt. Letztere prvdu-teren die-
sen Sützstoff nach dem Stiche einer kleinen Schildlaus (Cocus manni-
parus). Dte Araber. welche diesen Sützstoff seit uralten Aei-ten sam-
meln und ihn als „man" be.zeichne-n, woraus die Iuden das Wort
„manna" bildeten, sollen noch heute am Sinai jährlich etwa 25V Kg.
dieses MannoZuckers sammeln und ihn als ganz besondern Leäerbisfen
mil Vrot verzehren. Auch die Mönche des St. Katharinenklosters am
Stnai sanrmeln ihn in ledernen Schläuchen und benutzen ihn als
willlommenen Sützstoff, oder verkaufen ihn — an gläubige Pilger
als das himmlische Manna der Vibel. Die Lurch die
Stiche der genannten Schil-laus in der heitzen Zeit. im Iuni und
Iuli angestochenen Zweige ergeben ein-en perlartigen. glänzend weitzen
Tropfen, der den bei ihrer Wanderung durch die Wüste zu verhungern
drohcnden Juden, vom Himmel gefallen erschien. Das Manna kann
nur vor Aufgang der Sonne aufgelesen werden. da die Tropfen dcrrm.
durch die Kühle der Nacht, noch in festem Zustande sind.
Alte Weisheiten
Besser Schimpf er-ulden. als Schimpf verschulden.
Besier in guter Absicht sehlen, als in schlechter Eutes wählen
Steckst du die Hand Awischen anderer Zühne, nicht schuldlos
dich gebissen wähne.
Ward ein Ikrtum mit dir grvtz, wtrst du ihn wohl nichi mebr
Nicht beim ersten Mal gefangen. heitzt noch nicht dem Strick
entgangen.
Wenn aus dir selbst nicht Adel spricht, so nützen tausend Ahnen
Kein echter Mann nimmt Dienste an von de-m, den er nicht
achten kanu. . - ^
OerVorn
wochenbeilage zur „Saöischen post"
1. Iahrgang, Nr. 3
3. Oktober 1919
Denk es, o Deutschland!
Aus den Eeharnischten Sonetten von F r i ed rT ch R ück e r t 1813
Was schmiedest du, Schmied? „Wir schmieden Ketten. Ketten!'
Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen.
Was pslügst du, Bauer? „Das Feld soll Früchte tragen!"
Ia. für den Feind die Saat. für dich die Ketten.
Was zielsr du, Schütze? „Tod dem Hirsch, dem fetten."
Eleich Hirsch und Reh wird man euch selber jagen.
Was strickst du, Fischer? „Netz dem Fisch. dem zagen."
Aus eurem Todesuetz, wer kann euch retten?
Was wiegest du. schlaflose Mutter? „Knaben."
Ia, datz sie wachsen und dem Vaterlande
Im Dienst des Feindes Wunden schlagen sollen?
Wao schmiedst du, Schmied? „Wir schmieden Ketten, Ketten!"
Was schreibest Dichter du? Zn Glutbuchstaben
Einschreib' ich mein und meines Volkes Schande.
Das seine F-ceiheit nicht darf denken wollen.
Ihr Deutschen von dem Flutenbett des RheineS,^
Bis wo die Elbe sich ins Nordmeer gietzet,
Die ihr oordsm ein Volk. ein grotzes. hietzet.
Was habt ihr denn, um noch zu heitzen immer.
Wus habt ihr denn, um noch zu heitzen eines?
Welch Band, Las euch als Dolk zusammenschlietzet?.
Seit ihr das Kaiserszepter brechen lietzet.
Und euer Reich zerspalten. habt ihr keines.
Nur noch ein einziges Band ist euch geblieben.
Das ist die Sprache. die ihr sonst verachtet;
Zetzt mützt ihr sie als euer einziges liebsn.
Sie ist noch eu'r, ihr selber seid oerpachtet,
Sie halten fest, wenn alles wird zerrieben,
Datz ihr noch klagen könnt. mie ihr oecschmachtet.
Im Schwarzwald / Karl Frank
Schwarzwald! Wie ein ersrischender Lufthauch ooll harzigem
Tannenduft weht mich das Wort a». wenn ich in meiner dumpfen
Schreibstube sitze und sür Augenblicke die Lider schlietze. Und dann
überkommt mich allemal ein Sehneu und ein Heimwehgefühl, das
wächst und schwillt und drängt und treibt. bis ich eines schönen Tages
eben wieder einmal, wie heute. au diesem gottvollen' Morgen. im
Zuge sitze und mit freudig erregtem Herzen dem Reich der dunklen
Wälder und Berge, der sprudelnden Bäche und grünen Matten, mit
seinen torfbraunen Vauernhöfen und seinem kernigen Volksschlag
entgegenfahre. Wie toll jagen die Schwalben am wolkenlos-klaren
Morgenhimmel hin, und es ist, als teilte sie auch mir eine selige Be-
schwingtheit mit, während wir uns, rechts die kornwogende, wieite
Ebene, links sonniges Rebgebirge. rasch den bbau dunkelnden Bergen
nähern, die von beiden Seiten sich wie zu einem Tor zusammenschlie-
tzen, das der breite Flutz. dem wir zunüchst folgen. mit silbernem
Schlüssel aufschlietzt. Ein paar Stationen und wir besteigen ein Ne-
benbähnchen, das uns in ein bekanntes Seitental führen soll, dessen
wahren jltamen ich aus guten Eründen heute nicht uennen will. denn
es ist von bösen Zungen bereits mit der Bezeichnung „Hamsterbachtal"
delegt worden. Der Zug ist dicht Lesetzt mit kleinen Leuten. länd-
lichem Volk und Touristen. Eine Büuerin sitzt mir gegenüber. und ich
habe Mutze genug, ihre Tracht zu be-trachten. Sie trägt ein moos-
grünes Kleid aus gerippter Halbseide mit schwarzem Ausputz an den
Acrmeln. dazu eine schwarze Seidenschsirze und endlich noch, um Hals
und Brust geschlungei'.. ein zartaraues Seidentuch mit blatzblauem
Blnmenmuster. Den Hals ziett eine mehrfach umgewundene Kette
aus Granatperlen, an der vorn ein goldenes Kreuz baumelt. Auf
dem glatt gescheitelten, blatzbraunen Haare sitzt ein schwarzes Taft-
hüubchen, auf dem zwei nicht sehr breite. schwarze Bänder hoch ausge-
spannt emporragen. Diese Bänder geben eine Figur, wie eüwia ge-
wisie blecherne Back-Ausstecksormen sie zeigen. 3Zorn läuft um vie
Haube, bie „Schwitzerkappe" genannt wird. noch ein schwarzes Band,
„D'Spitz"'. das brcnme Gesicht anmutig umrahmend. Wir sprechen
von der Tracht init einander. und die Frau. die die Eewaiwung selbst
schön findet, bemertt, gewisiermatzen zur Verteidigung: „ s isch sust
dieköstlich." Das soll heitzen. es ist alles teuer daran. (Man beachte
die iwunderbar leb?ndige Sprache: dierköstlich — es kostet teuer.) Das
Granatbcmd allein koste über 100 Mark. sagt ste. Ia. das will ich
glauben! Ich denke mir sogar oft, die Zeiten. aus denen diese Trach-
ten stammen, die in jeder Gegend, oft an jedem Ort wreder ettoas
cmdrrs sind, müsien Zeiten grotzen Wohlstandes gewesen sein, wo stch
L^chttun mit eineW stolzen Selbstgefühl. vielleicht auch nvit «EM
„bizzeli" Hoffart verbanden. wo Samt und Seide und kostlicher oder
..dierköftlicher" Schmuck den Bauersleuten gerade gut genug war, so
bescheiden und selbftverständlich das alles auch heute getragen wrrd. —
Der Zug fährt gemütlich an einem kleinen Landstüdtchen oor-
bei, dessen schmucke, erhöht stehende Wallfahttskirche oon Letendem
Landoolk bunt umlagert ist. sodatz sich dem Auge Bilder bieten. wie
Meister Hasemann ste so köstlich mit dem Pinsel festgehalten hat.
— Auf der kleinen Station Unterso-und-so steige ich aus. Eine Laud-
schaft oon wunderbarem Reize. zugleich lieblich und streng. umfängt
mich. Weiche, hellgrüne Hügel von Kornfeld. Wiesen und Obstbäumen
überzogen, sind in weitem Rund umrahmt von den schwarzgrünen
Eraten der tannenstarrenden Bergzüge, die hier zuscnnmenströmen.
Einer dieser Erate schiebt sich bis zur Station vor, wo sich die Kirche
und ein paar Häuser am Bache angesiÄrelt haben. Auf grasbewachse-
nem Wege schreite ich. an behäbigen, weit auseinanderliegenden
Bauernhäusertt vorbei. dem Walde zu. Iedes dieser Häuser hät sein
eigenes Gesicht, ist, man möchte fast sagen. eine Perfönlichkeit für sich.
Diejenigen, die am Abhang stehen, kehren dem Weg die Rückseite
mit der breiten Scheuereinfahrt zu. Andere fallen durch ibr torfbrau-
ncs Holzwerk und stattliche. oft zwei- und dreisach über einander lau-
fende Ealerien auf. Einige sind mit Rebenlaub behangen. Jmmer
ist ein Laufbruniren vor dem Haus. und ganze Berge von Holz und
Reisig umlagern den Hof. Meist steh-t auch ein Immenhaus (Bienen-
stand) in der Nähe. Viel Hollunderbäume sieht man; namentlich der
Brunnenstock ist oft ganz reizvoll umwoben von ihrem Grün.
Wenn der Bauer cnich ost die Landschaft mit nüchterneren
Augen ansieht, als der nüturschwärmende Städter, an seinen Bäumen
hängt er mit grotzer. oft fast mystisch empfundener Liebe. Auch Blu-
men liebt das Landoolk hier ungemein. Vor dem Kirchgang steckt
der Bursch ein „NägAe" (Nelke) hinters Ohr. und die Bäuerin und
die Maidle holen sich am Sonntag im .Krutgatten" ihr Sttäutzlein,
das sie mit dem .Ketbuch^ sinnig in der Hand ttagsn. — Ein blaues
Glas mit Blumen an einem der kleinen Stubenfenstor und eine ru-
hende Katze dabei erinnert mich an irgend ein Bild des allverehtten
Altmeisters Hans Thoma, desien treuherzig-innige Kunst, auch
wenn sie die Welt umspannt, so ganz und gar im heimatlichen Boden
seines Schwarzwaldes wurzelt.
Hinter dem Letzten Dauernhof erhebt sich crm Wiesenrmid neben
einem Aepfelbäumchen ein hohes Steinkreuz init barockähnlichem
Sockel. Die'Jnschrift weicht vom allaemeinen üblichen Wottlcmt ab
und kündet .dunkle Dinge, weshalb ich sie in mein Weg- und Wander-
büchlein einttage. Sie lautet wottgetreu: „Andreas B. . . . ist am
2. November 1881 durch dtttter Hand gestorben. — O Christ wachet
und betet. Die Eltern Iotzef und Franziska D. . . . gesttfpet o. desien
Nachkonullen Augukttu B . . . 1895."