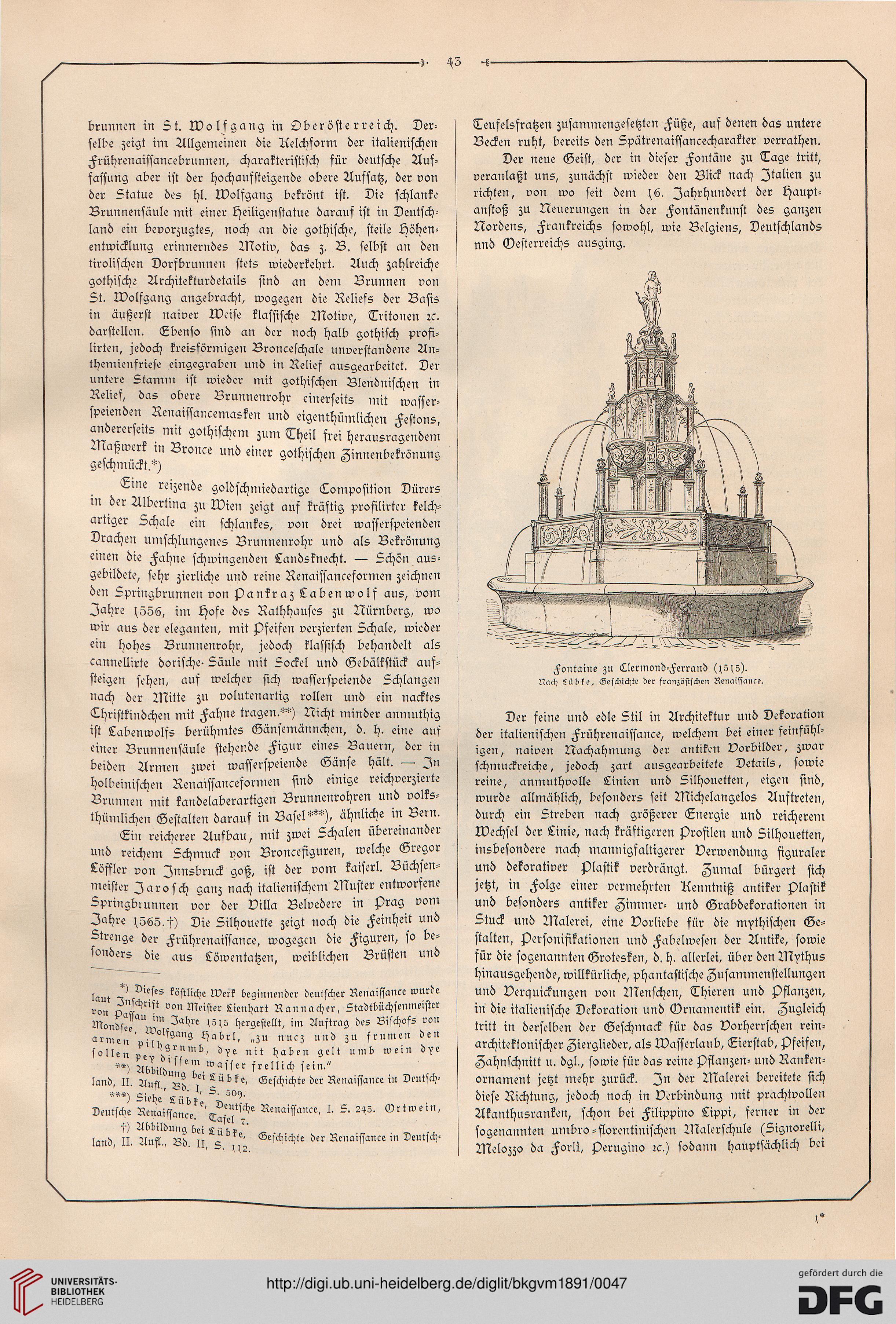brunnen in 5t. Wolfgang in Oberöste rreich. Der-
selbe zeigt im Allgemeinen die Aelchform der italienischen
Frührenaissancebrunnen, charakteristisch für deutsche Auf-
fassung aber ist der hochaufsteigende obere Aufsatz, der von
der 5tatue des hl. Wolfgang bekrönt ist. Die schlanke
Brunnensäule mit einer kseiligenstatue darauf ist in Deutsch-
land ein bevorzugtes, noch an die gothische, steile ^öhen-
entwicklung erinnerndes wotiv, das z. B. selbst an den
tirolischen Dorfbrunnen stets wiederkehrt. Auch zahlreiche
gothische Architekturdetails sind an dem Brunnen von
5t. Wolfgang angebracht, wogegen die Reliefs der Basis
in äußerst naiver weise klassische wotive, Tritonen rc.
darstellen. Ebenso sind an der noch halb gothisch profi-
lirten, jedoch kreisförmigen Bronceschale unverstandene An-
themienfriese eingegraben und in Relief ausgearbeitct. Der
untere Stamm ist wieder mit gothischen Blendnischen in
Relief, das obere Brunnenrohr einerseits mit wasser-
speienden Renaissancemasken und eigenthümlichen Festons,
andererseits mit gothischem zum Theil frei herausragendem
ceschn "ckt "" kmd ^>uer gothischen Zinnenbekrönung
Eine reizende goldschmiedartige Komposition Dürers
in der Albertina zu Wien zeigt auf kräftig profilirtcr kelch-
artiger 5chale ein schlankes, von drei wasserspeienden
Drachen umschlungenes Brunnenrohr und als Bekrönung
einen die Fahne schwingenden Landsknecht. — 5chön aus-
gebildete, sehr zierliche und reine Renaissanceformen zeichnen
den 5pringbrunnen von pankraz Labenwolf aus, vom
Jahre fö56, im chofe des Rathhauses zu Nürnberg, wo
wir aus der eleganten, mit pfeifen verzierten 5chale, wieder
ein hohes Brunnenrohr, jedoch klassisch behandelt als
cannellirte dorische- 5äule mit 5ockel und Gebälkstück auf-
steigen sehen, aus welcher sich wasserspeiende 5chlangen
nach der Witte zu volutenartig rollen und ein nacktes
Thristkindchen mit Fahne tragen.**) Nicht minder anmuthig
ist Labenwolfs berühmtes Gänsemännchen, d. h. eine auf
einer Brunnensäule stehende Figur eines Bauern, der in
beiden Armen zwei wasserspeiende Vänse hält. — 3n
holbeinischen Renaissanceformen sind einige reichverzierte
Brunnen mit kandelaberartigen Brunnenrohren und volks-
thümlichen Gestalten darauf in Basel***), ähnliche irr Bern.
Ein reicherer Aufbau, mit zwei 5chalen übereinander
urrd reichem 5chmuck von Broncesiguren, welche Gregor
köfflcr von Innsbruck goß, ist der vom kaiscrl. Büchsen-
meister Iarosch ganz nach italienischem wüster entworfene
Springbrunnen vor der Billa Belvedere in Prag vom
3«hre föSö.si) Die 5ilhouette zeigt noch die Feinheit und
Strenge der Frührenaissance, wogegen die Figuren, so be-
sonders die aus Löwentatzen, weiblichen Brüsten und
laut f^'c^cs köstliche Werk beginnender deutscher Renaissance u
von väss ^on Meister Lienhart Rannacher, Stadtbüchsenm
Mondsee "wi" ^"ksre sösä hcrgcstellt, im Auftrag des Bischofs
arme>/pim^°"b kjabrl, „zu nucz und zu frnmen
f0 ■ Ie n pe v v r"^ Y e "kt haben gelt uIN b wein
**) ybbilbu em.®affer freilich fein."
land, II. Aust ^ ^ übke, Geschichte der Renaissance in De
***) ^iehe' x " k' b- övy.
Deutsche Renaissance^'Renaissance, I. S. 243. Grtw
-f) Abbildung bei Lü bke '
land, II. Aust., Bd. II, S. ,, ) der Renaissance in De
Teufelsfratzen zusammengesetzten Füße, auf denen das untere
Becken ruht, bereits den 5pätrenaiffancecharakter verrathen.
Der neue Geist, der in dieser Fontäne zu Tage tritt,
veranlaßt uns, zunächst wieder den Blick nach Italien zu
richten, von wo seit dem f6. Jahrhundert der ^aupt-
anstoß zu Neuerungen in der Fontänenkunst des ganzen
Nordens, Frankreichs sowohl, wie Belgiens, Deutschlands
nnd (Oesterreichs ausging.
Fontaine zu Llerniond-Ferrand (sösb).
Nach Üübke, Geschichte der französischen Renaissance.
Der feine und edle Stil in Architektur und Dekoration
der italienischen Frührenaissance, welchem bei einer feinfühl-
igen, naiven Nachahmung der antiken Vorbilder, zwar
schmuckreiche, jedoch zart ausgearbeitete Details, sowie
reine, anmuthvolle Linien und 5ilhouetten, eigen sind,
wurde allmählich, besonders seit wichelangelos Auftreten,
durch ein 5treben nach größerer Energie und reicherem
Wechsel der Linie, nach kräftigeren Profilen und Silhouetten,
insbesondere nach mannigfaltigerer Verwendung figuraler
und dekorativer Plastik verdrängt. Zumal bürgert sich
jetzt, in Folge einer vermehrten Aenntniß antiker Plastik
und besonders antiker Zimmer- und Grabdekorationen in
5tuck und Walerei, eine Vorliebe für die mythischen Ge-
stalten, Personifikationen und Fabelwesen der Antike, sowie
für die sogenannten Grotesken, d. h. allerlei, über den wythus
hinausgehende, willkürliche, phantastische Zusammenstellungen
und Verquickungen von wenschen, Thieren und Pflanzen,
in die italienische Dekoration und Grnamentik ein. Zugleich
tritt in derselben der Geschmack für das vorherrschen rein-
architektonischer Zierglieder, als Wasserlaub, Eierstab, pfeifen,
Zahnschnitt u. dgl., sowie für das reine Pflanzen- und Ranken-
ornament jetzt mehr zurück. In der Walerei bereitete sich
diese Richtung, jedoch noch in Verbindung mit prachtvollen
Akanthusranken, schon bei Filippino Lippi, ferner in der
sogenannten umbro-florentinischen walerschule (5ignorelli,
welozzo da Forll, perugino rc.) sodann hauptsächlich bei
selbe zeigt im Allgemeinen die Aelchform der italienischen
Frührenaissancebrunnen, charakteristisch für deutsche Auf-
fassung aber ist der hochaufsteigende obere Aufsatz, der von
der 5tatue des hl. Wolfgang bekrönt ist. Die schlanke
Brunnensäule mit einer kseiligenstatue darauf ist in Deutsch-
land ein bevorzugtes, noch an die gothische, steile ^öhen-
entwicklung erinnerndes wotiv, das z. B. selbst an den
tirolischen Dorfbrunnen stets wiederkehrt. Auch zahlreiche
gothische Architekturdetails sind an dem Brunnen von
5t. Wolfgang angebracht, wogegen die Reliefs der Basis
in äußerst naiver weise klassische wotive, Tritonen rc.
darstellen. Ebenso sind an der noch halb gothisch profi-
lirten, jedoch kreisförmigen Bronceschale unverstandene An-
themienfriese eingegraben und in Relief ausgearbeitct. Der
untere Stamm ist wieder mit gothischen Blendnischen in
Relief, das obere Brunnenrohr einerseits mit wasser-
speienden Renaissancemasken und eigenthümlichen Festons,
andererseits mit gothischem zum Theil frei herausragendem
ceschn "ckt "" kmd ^>uer gothischen Zinnenbekrönung
Eine reizende goldschmiedartige Komposition Dürers
in der Albertina zu Wien zeigt auf kräftig profilirtcr kelch-
artiger 5chale ein schlankes, von drei wasserspeienden
Drachen umschlungenes Brunnenrohr und als Bekrönung
einen die Fahne schwingenden Landsknecht. — 5chön aus-
gebildete, sehr zierliche und reine Renaissanceformen zeichnen
den 5pringbrunnen von pankraz Labenwolf aus, vom
Jahre fö56, im chofe des Rathhauses zu Nürnberg, wo
wir aus der eleganten, mit pfeifen verzierten 5chale, wieder
ein hohes Brunnenrohr, jedoch klassisch behandelt als
cannellirte dorische- 5äule mit 5ockel und Gebälkstück auf-
steigen sehen, aus welcher sich wasserspeiende 5chlangen
nach der Witte zu volutenartig rollen und ein nacktes
Thristkindchen mit Fahne tragen.**) Nicht minder anmuthig
ist Labenwolfs berühmtes Gänsemännchen, d. h. eine auf
einer Brunnensäule stehende Figur eines Bauern, der in
beiden Armen zwei wasserspeiende Vänse hält. — 3n
holbeinischen Renaissanceformen sind einige reichverzierte
Brunnen mit kandelaberartigen Brunnenrohren und volks-
thümlichen Gestalten darauf in Basel***), ähnliche irr Bern.
Ein reicherer Aufbau, mit zwei 5chalen übereinander
urrd reichem 5chmuck von Broncesiguren, welche Gregor
köfflcr von Innsbruck goß, ist der vom kaiscrl. Büchsen-
meister Iarosch ganz nach italienischem wüster entworfene
Springbrunnen vor der Billa Belvedere in Prag vom
3«hre föSö.si) Die 5ilhouette zeigt noch die Feinheit und
Strenge der Frührenaissance, wogegen die Figuren, so be-
sonders die aus Löwentatzen, weiblichen Brüsten und
laut f^'c^cs köstliche Werk beginnender deutscher Renaissance u
von väss ^on Meister Lienhart Rannacher, Stadtbüchsenm
Mondsee "wi" ^"ksre sösä hcrgcstellt, im Auftrag des Bischofs
arme>/pim^°"b kjabrl, „zu nucz und zu frnmen
f0 ■ Ie n pe v v r"^ Y e "kt haben gelt uIN b wein
**) ybbilbu em.®affer freilich fein."
land, II. Aust ^ ^ übke, Geschichte der Renaissance in De
***) ^iehe' x " k' b- övy.
Deutsche Renaissance^'Renaissance, I. S. 243. Grtw
-f) Abbildung bei Lü bke '
land, II. Aust., Bd. II, S. ,, ) der Renaissance in De
Teufelsfratzen zusammengesetzten Füße, auf denen das untere
Becken ruht, bereits den 5pätrenaiffancecharakter verrathen.
Der neue Geist, der in dieser Fontäne zu Tage tritt,
veranlaßt uns, zunächst wieder den Blick nach Italien zu
richten, von wo seit dem f6. Jahrhundert der ^aupt-
anstoß zu Neuerungen in der Fontänenkunst des ganzen
Nordens, Frankreichs sowohl, wie Belgiens, Deutschlands
nnd (Oesterreichs ausging.
Fontaine zu Llerniond-Ferrand (sösb).
Nach Üübke, Geschichte der französischen Renaissance.
Der feine und edle Stil in Architektur und Dekoration
der italienischen Frührenaissance, welchem bei einer feinfühl-
igen, naiven Nachahmung der antiken Vorbilder, zwar
schmuckreiche, jedoch zart ausgearbeitete Details, sowie
reine, anmuthvolle Linien und 5ilhouetten, eigen sind,
wurde allmählich, besonders seit wichelangelos Auftreten,
durch ein 5treben nach größerer Energie und reicherem
Wechsel der Linie, nach kräftigeren Profilen und Silhouetten,
insbesondere nach mannigfaltigerer Verwendung figuraler
und dekorativer Plastik verdrängt. Zumal bürgert sich
jetzt, in Folge einer vermehrten Aenntniß antiker Plastik
und besonders antiker Zimmer- und Grabdekorationen in
5tuck und Walerei, eine Vorliebe für die mythischen Ge-
stalten, Personifikationen und Fabelwesen der Antike, sowie
für die sogenannten Grotesken, d. h. allerlei, über den wythus
hinausgehende, willkürliche, phantastische Zusammenstellungen
und Verquickungen von wenschen, Thieren und Pflanzen,
in die italienische Dekoration und Grnamentik ein. Zugleich
tritt in derselben der Geschmack für das vorherrschen rein-
architektonischer Zierglieder, als Wasserlaub, Eierstab, pfeifen,
Zahnschnitt u. dgl., sowie für das reine Pflanzen- und Ranken-
ornament jetzt mehr zurück. In der Walerei bereitete sich
diese Richtung, jedoch noch in Verbindung mit prachtvollen
Akanthusranken, schon bei Filippino Lippi, ferner in der
sogenannten umbro-florentinischen walerschule (5ignorelli,
welozzo da Forll, perugino rc.) sodann hauptsächlich bei