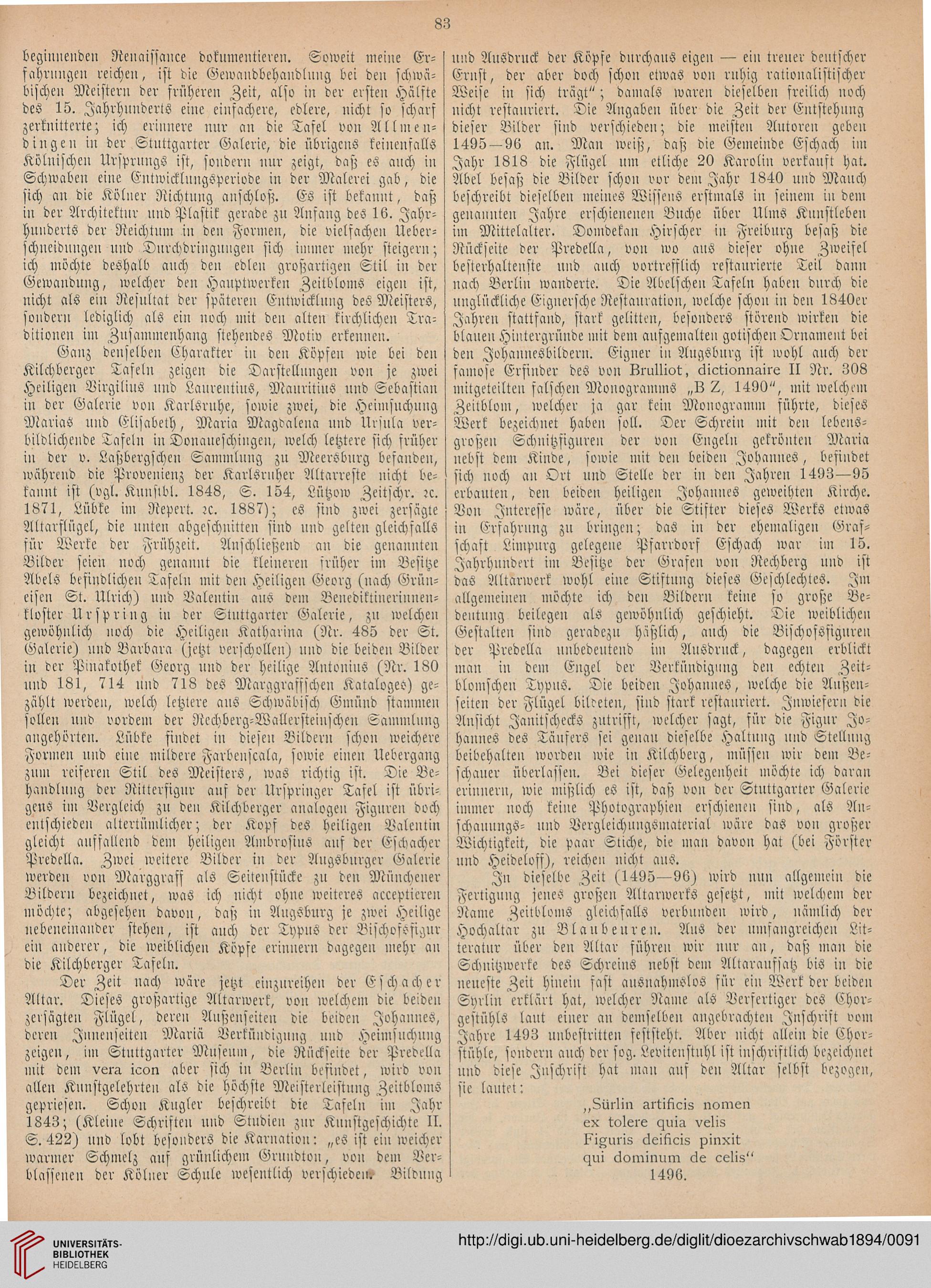83
beginnenden Renaissance dokumentieren. Soweit meine Er-
fahrungen reichen, ist die Gewandbehandlnng bei den schwä-
bischen Meistern der früheren Zeit, also in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts eine einfachere, edlere, nicht so scharf
zerknitterte; ich erinnere nur an die Tafel von Allmen-
dingen in der Stuttgarter Galerie, die übrigens keinenfalls
Kölnischen Ursprungs ist, sondern nur zeigt, daß es auch in
Schwaben eine EntwicklungSperivde in der Malerei gab, die
sich an die Kölner Richtung anschloß. Es ist bekannt, daß
in der Architektur und Plastik gerade zu Anfang des 16. Jahr-
hunderts der Reichtum in den Formen, die vielfache» Ueber-
schncidnngen und Durchdringungen sich immer mehr steigern;
ich möchte deshalb auch den edlen großartigen Stil in der
Gewandung, welcher den Hauptwerken Zeitbloms eigen ist,
nicht als ein Resultat der späteren Entwicklung des Meisters,
sondern lediglich als ein noch mit den alten kirchlichen Tra-
ditionen im Zusammenhang stehendes Motiv erkennen.
Ganz denselben Charakter in den Köpfen wie bei den
Kilchberger Tafeln zeigen die Darstellungen von je zwei
Heiligen Virgilius und Laurentius, Mauritius und Sebastian
in der Galerie von Karlsruhe, sowie zwei, die Heimsuchung
Marias und Elisabeth, Maria Magdalena und Ursula ver-
bildlichende Tafeln in Donaueschingen, welch letztere sich früher
in der v. Laßbergschcn Sammlung zu Meeröburg befanden,
während die Provenienz der Karlsruher Altarreste nicht be-
kannt ist (vgl. Knnslbl. 1848, S- 154, Lützow Zcitschr. rc.
1871, Lübke im Nepert. rc. 1887); es sind zwei zersägte
Altarflügel, die nuten abgeschnitten sind und gelten gleichfalls
für Werke der Frühzeit. Anschließend an die genannten
Bilder seien noch genannt die kleineren früher im Besitze
Abels befindlichen Tafeln mit den Heiligen Georg (nach Grün-
eisen St. Ulrich) und Valentin aus dem Benediktinerinnen-
klvster Urspring in der Stuttgarter Galerie, zu welchen
gewöhnlich noch die Heiligen Katharina (Nr. 485 der St.
Galerie) und Barbara (jetzt verschollen) und die beiden Bilder
in der Pinakothek Georg und der heilige Antonius (Nr. 180
und 181, 714 und 718 des Marggraffschen Kataloges) ge-
zählt werden, welch letztere aus Schwäbisch Gmünd stammen
sollen und vordem der Ncchberg-Wallersteinschen Sammlung
angehörten. Lübke findet in diesen Bilder» schon weichere
Formen und eine mildere Farbenscala, sowie einen Uebergang
zum reiferen Stil des Meisters, was richtig ist. Die Be-
handlung der Nitterfignr auf der Urspringer Tafel ist übri-
gens im Vergleich zu den Kilchberger analogen Figuren doch
entschieden altertümlicher; der Kopf des heiligen Valentin
gleicht ausfallend dem heiligen Ambrosius ans der Eschacher
Predella. Zwei weitere Bilder in der Augsburger Galerie
werden von Marggraff als Seitenstücke zu den Münchener
Bildern bezeichnet, was ich nicht ohne weiteres acceptieren
möchte; abgesehen davon, daß in Augsburg je zwei Heilige
nebeneinander stehen, ist auch der Typus der Bischofsfignr
ein anderer, die weiblichen Köpfe erinnern dagegen mehr an
die Kilchberger Tafeln.
Der Zeit nach wäre jetzt einzureihe» der Eschacher
Altar. Dieses großartige Altarwerk, von welchem die beiden
zersägten Flügel, deren Außenseiten die beiden Johannes,
deren Innenseiten Mariä Verkündigung und Heimsuchung
zeigen, im Stuttgarter Museum, die Rückseite der Predella
mit dem vern ieon aber sich in Berlin befindet, wird von
allen Kunstgelehrten als die höchste Meisterleistung Zeitbloms
gepriesen. Schon Kugler beschreibt die Tafeln im Jahr
1843; (Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte II.
S. 422) und lobt besonders die Karnation: „es ist ein weicher
warmer Schmelz ans grünlichem Grnndton, von dem Ver-
blassenen der Kölner Schule wesentlich verschiede,»- Bildung
und Ausdruck der Köpfe durchaus eigen — ei» treuer deutscher
Ernst, der aber doch schon etwas von ruhig rationalistischer
Weise in sich trägt"; damals waren dieselben freilich noch
nicht restauriert. Die Angaben über die Zeit der Entstehung
dieser Bilder sind verschieden; die meisten Autoren geben
1495 — 96 an. Man weiß, daß die Gemeinde Eschach im
Jahr 1818 die Flügel um etliche 20 Karotin verkauft hat.
Abel besaß die Bilder schon vvr dem Jahr 1840 und Manch
beschreibt dieselben meines Wissens erstmals in seinem in dem
genannten Jahre erschienenen Buche über Ulms Knnstleben
im Mittelalter. Domdekan Hirscher in Freiburg besaß die
Rückseite der Predella, von wo ans dieser ohne Zweifel
besterhaltenste und auch vortrefflich restaurierte Teil dann
nach Berlin wanderte. Die Abelschen Tafeln haben durch die
unglückliche Eignersche Restauration, welche schon in den 1840er
Jahren stattfand, stark gelitten, besonders störend wirken die
blauen Hintergründe mit dem aufgemalten gotischen Ornament bei
den Jvhannesbildern. Eigner in Augsburg ist wohl auch der
famose Erfinder des von krulliot, ckictionirnire II Nr. 308
mitgeteilten falschen Monogramms „L 1490", mit welchem
Zeitblom, welcher ja gar kein Monogramm führte, dieses
Werk bezeichnet haben soll. Der Schrein mit den lebens-
großen Schnitzfiguren der von Engeln gekrönten Maria
nebst dem Kinde, sowie mit den beiden Johannes, befindet
sich noch an Ort und Stelle der in den Jahren 1493—95
erbauten, den beiden heiligen Johannes geweihten Kirche.
Von Interesse wäre, über die Stifter dieses Werks etwas
in Erfahrung zu bringen; das in der ehemaligen Graf-
schaft Limpnrg gelegene Pfarrdorf Eschach war im 15.
Jahrhundert im Besitze der Grafen von Rechberg und ist
das Altarwerk wohl eine Stiftung dieses Geschlechtes. Im
allgemeinen möchte ich den Bildern keine so große Be-
deutung beilegen als gewöhnlich geschieht. Die weiblichen
Gestalten sind geradezu häßlich, auch die Bischofssignren
der Predella unbedeutend im Ausdruck, dagegen erblickt
man in dem Engel der Verkündigung den echten Zeit-
blomschen Typus. Die beiden Johannes, welche die Außen-
seiten der Flügel bildeten, sind stark restauriert. Inwiefern die
Ansicht JanitscheckS zutrifst, welcher sagt, für die Figur Jo-
hannes des Täufers sei genau dieselbe Haltung und Stellung
beibehalten worden wie in Kilchberg, müssen wir dem Be-
schauer überlassen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich daran
erinnern, wie mißlich es ist, daß von der Stuttgarter Galerie
immer noch keine Photographien erschienen sind, als An-
schannngs- und VergleichnngSmaterial wäre das von großer
Wichtigkeit, die paar Stiche, die man davon hat (bei Förster
und Heideloff), reiche» nicht aus.
In dieselbe Zeit (1495—96) wird nun allgemein die
Fertigung jenes großen Altarwerks gesetzt, mit welchem der
Name Zeitbloms gleichfalls verbunden wird, nämlich der
Hochaltar zu Blaubeuren. Ans der umfangreichen Li-
teratur über den Altar führen wir nur an, daß man die
Schnitzwerke des Schreins nebst dem Altaranfsatz bis in die
neueste Zeit hinein fast ausnahmslos für ein Werk der beiden
Syrlin erklärt hat, welcher Name als Verfertiger des Chor-
gestühls laut einer an demselben angebrachten Inschrift vom
Jahre 1493 unbestritten scststeht. Aber nicht allein die Chor-
stühle, sondern auch der sog. Levitenstnhl ist inschriftlich bezeichnet
und diese Inschrift hat man ans den Altar selbst bezogen,
sie lautet:
,,5ürlin artitreis nomen
ex tolere c;uin velis
lei^uris cleitrcis pinxit
cpui clominum Oe cetis"
1496.
beginnenden Renaissance dokumentieren. Soweit meine Er-
fahrungen reichen, ist die Gewandbehandlnng bei den schwä-
bischen Meistern der früheren Zeit, also in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts eine einfachere, edlere, nicht so scharf
zerknitterte; ich erinnere nur an die Tafel von Allmen-
dingen in der Stuttgarter Galerie, die übrigens keinenfalls
Kölnischen Ursprungs ist, sondern nur zeigt, daß es auch in
Schwaben eine EntwicklungSperivde in der Malerei gab, die
sich an die Kölner Richtung anschloß. Es ist bekannt, daß
in der Architektur und Plastik gerade zu Anfang des 16. Jahr-
hunderts der Reichtum in den Formen, die vielfache» Ueber-
schncidnngen und Durchdringungen sich immer mehr steigern;
ich möchte deshalb auch den edlen großartigen Stil in der
Gewandung, welcher den Hauptwerken Zeitbloms eigen ist,
nicht als ein Resultat der späteren Entwicklung des Meisters,
sondern lediglich als ein noch mit den alten kirchlichen Tra-
ditionen im Zusammenhang stehendes Motiv erkennen.
Ganz denselben Charakter in den Köpfen wie bei den
Kilchberger Tafeln zeigen die Darstellungen von je zwei
Heiligen Virgilius und Laurentius, Mauritius und Sebastian
in der Galerie von Karlsruhe, sowie zwei, die Heimsuchung
Marias und Elisabeth, Maria Magdalena und Ursula ver-
bildlichende Tafeln in Donaueschingen, welch letztere sich früher
in der v. Laßbergschcn Sammlung zu Meeröburg befanden,
während die Provenienz der Karlsruher Altarreste nicht be-
kannt ist (vgl. Knnslbl. 1848, S- 154, Lützow Zcitschr. rc.
1871, Lübke im Nepert. rc. 1887); es sind zwei zersägte
Altarflügel, die nuten abgeschnitten sind und gelten gleichfalls
für Werke der Frühzeit. Anschließend an die genannten
Bilder seien noch genannt die kleineren früher im Besitze
Abels befindlichen Tafeln mit den Heiligen Georg (nach Grün-
eisen St. Ulrich) und Valentin aus dem Benediktinerinnen-
klvster Urspring in der Stuttgarter Galerie, zu welchen
gewöhnlich noch die Heiligen Katharina (Nr. 485 der St.
Galerie) und Barbara (jetzt verschollen) und die beiden Bilder
in der Pinakothek Georg und der heilige Antonius (Nr. 180
und 181, 714 und 718 des Marggraffschen Kataloges) ge-
zählt werden, welch letztere aus Schwäbisch Gmünd stammen
sollen und vordem der Ncchberg-Wallersteinschen Sammlung
angehörten. Lübke findet in diesen Bilder» schon weichere
Formen und eine mildere Farbenscala, sowie einen Uebergang
zum reiferen Stil des Meisters, was richtig ist. Die Be-
handlung der Nitterfignr auf der Urspringer Tafel ist übri-
gens im Vergleich zu den Kilchberger analogen Figuren doch
entschieden altertümlicher; der Kopf des heiligen Valentin
gleicht ausfallend dem heiligen Ambrosius ans der Eschacher
Predella. Zwei weitere Bilder in der Augsburger Galerie
werden von Marggraff als Seitenstücke zu den Münchener
Bildern bezeichnet, was ich nicht ohne weiteres acceptieren
möchte; abgesehen davon, daß in Augsburg je zwei Heilige
nebeneinander stehen, ist auch der Typus der Bischofsfignr
ein anderer, die weiblichen Köpfe erinnern dagegen mehr an
die Kilchberger Tafeln.
Der Zeit nach wäre jetzt einzureihe» der Eschacher
Altar. Dieses großartige Altarwerk, von welchem die beiden
zersägten Flügel, deren Außenseiten die beiden Johannes,
deren Innenseiten Mariä Verkündigung und Heimsuchung
zeigen, im Stuttgarter Museum, die Rückseite der Predella
mit dem vern ieon aber sich in Berlin befindet, wird von
allen Kunstgelehrten als die höchste Meisterleistung Zeitbloms
gepriesen. Schon Kugler beschreibt die Tafeln im Jahr
1843; (Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte II.
S. 422) und lobt besonders die Karnation: „es ist ein weicher
warmer Schmelz ans grünlichem Grnndton, von dem Ver-
blassenen der Kölner Schule wesentlich verschiede,»- Bildung
und Ausdruck der Köpfe durchaus eigen — ei» treuer deutscher
Ernst, der aber doch schon etwas von ruhig rationalistischer
Weise in sich trägt"; damals waren dieselben freilich noch
nicht restauriert. Die Angaben über die Zeit der Entstehung
dieser Bilder sind verschieden; die meisten Autoren geben
1495 — 96 an. Man weiß, daß die Gemeinde Eschach im
Jahr 1818 die Flügel um etliche 20 Karotin verkauft hat.
Abel besaß die Bilder schon vvr dem Jahr 1840 und Manch
beschreibt dieselben meines Wissens erstmals in seinem in dem
genannten Jahre erschienenen Buche über Ulms Knnstleben
im Mittelalter. Domdekan Hirscher in Freiburg besaß die
Rückseite der Predella, von wo ans dieser ohne Zweifel
besterhaltenste und auch vortrefflich restaurierte Teil dann
nach Berlin wanderte. Die Abelschen Tafeln haben durch die
unglückliche Eignersche Restauration, welche schon in den 1840er
Jahren stattfand, stark gelitten, besonders störend wirken die
blauen Hintergründe mit dem aufgemalten gotischen Ornament bei
den Jvhannesbildern. Eigner in Augsburg ist wohl auch der
famose Erfinder des von krulliot, ckictionirnire II Nr. 308
mitgeteilten falschen Monogramms „L 1490", mit welchem
Zeitblom, welcher ja gar kein Monogramm führte, dieses
Werk bezeichnet haben soll. Der Schrein mit den lebens-
großen Schnitzfiguren der von Engeln gekrönten Maria
nebst dem Kinde, sowie mit den beiden Johannes, befindet
sich noch an Ort und Stelle der in den Jahren 1493—95
erbauten, den beiden heiligen Johannes geweihten Kirche.
Von Interesse wäre, über die Stifter dieses Werks etwas
in Erfahrung zu bringen; das in der ehemaligen Graf-
schaft Limpnrg gelegene Pfarrdorf Eschach war im 15.
Jahrhundert im Besitze der Grafen von Rechberg und ist
das Altarwerk wohl eine Stiftung dieses Geschlechtes. Im
allgemeinen möchte ich den Bildern keine so große Be-
deutung beilegen als gewöhnlich geschieht. Die weiblichen
Gestalten sind geradezu häßlich, auch die Bischofssignren
der Predella unbedeutend im Ausdruck, dagegen erblickt
man in dem Engel der Verkündigung den echten Zeit-
blomschen Typus. Die beiden Johannes, welche die Außen-
seiten der Flügel bildeten, sind stark restauriert. Inwiefern die
Ansicht JanitscheckS zutrifst, welcher sagt, für die Figur Jo-
hannes des Täufers sei genau dieselbe Haltung und Stellung
beibehalten worden wie in Kilchberg, müssen wir dem Be-
schauer überlassen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich daran
erinnern, wie mißlich es ist, daß von der Stuttgarter Galerie
immer noch keine Photographien erschienen sind, als An-
schannngs- und VergleichnngSmaterial wäre das von großer
Wichtigkeit, die paar Stiche, die man davon hat (bei Förster
und Heideloff), reiche» nicht aus.
In dieselbe Zeit (1495—96) wird nun allgemein die
Fertigung jenes großen Altarwerks gesetzt, mit welchem der
Name Zeitbloms gleichfalls verbunden wird, nämlich der
Hochaltar zu Blaubeuren. Ans der umfangreichen Li-
teratur über den Altar führen wir nur an, daß man die
Schnitzwerke des Schreins nebst dem Altaranfsatz bis in die
neueste Zeit hinein fast ausnahmslos für ein Werk der beiden
Syrlin erklärt hat, welcher Name als Verfertiger des Chor-
gestühls laut einer an demselben angebrachten Inschrift vom
Jahre 1493 unbestritten scststeht. Aber nicht allein die Chor-
stühle, sondern auch der sog. Levitenstnhl ist inschriftlich bezeichnet
und diese Inschrift hat man ans den Altar selbst bezogen,
sie lautet:
,,5ürlin artitreis nomen
ex tolere c;uin velis
lei^uris cleitrcis pinxit
cpui clominum Oe cetis"
1496.