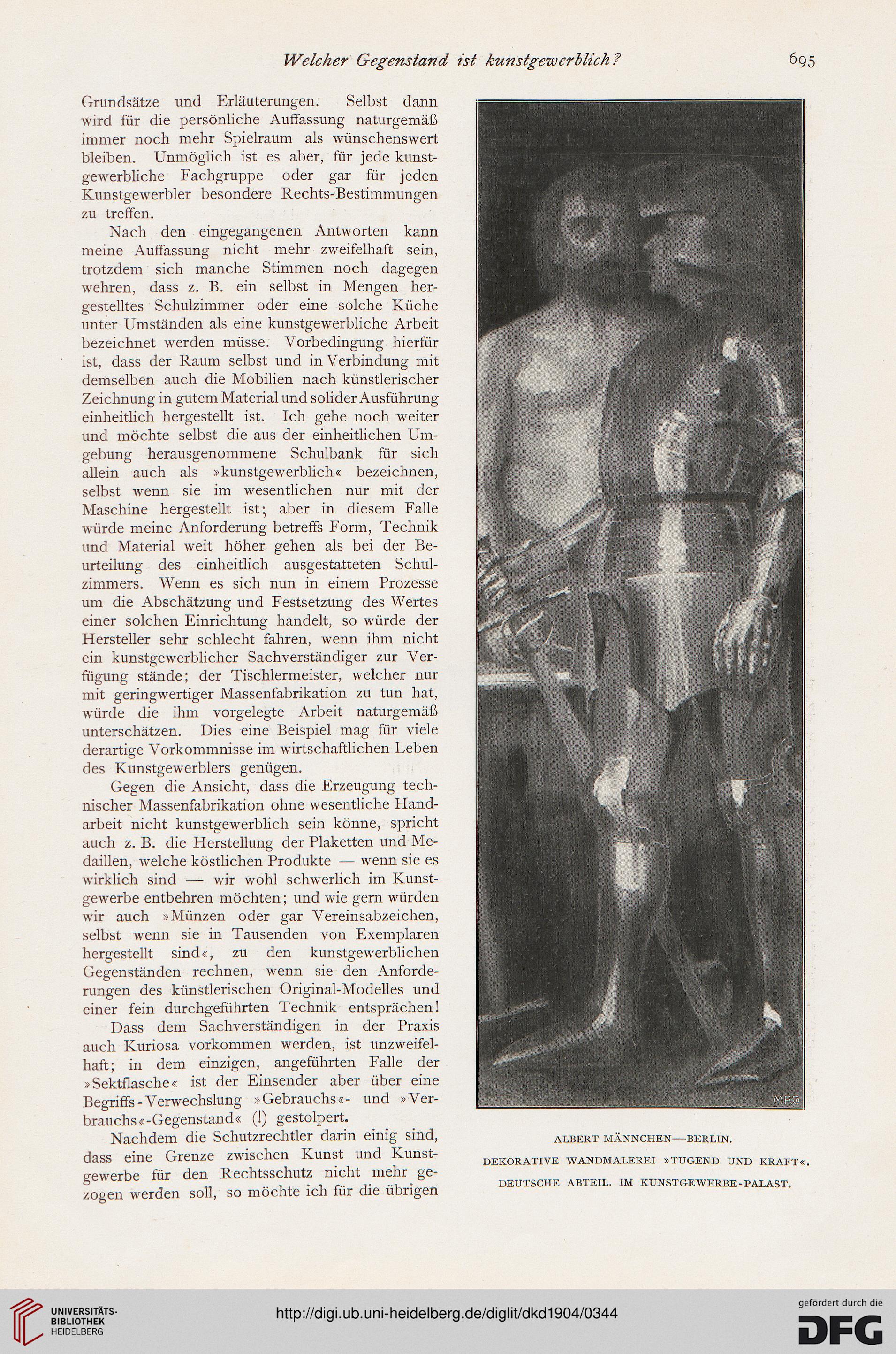Welcher Gegenstand ist kunstgewerblich?
695
Grundsätze und Erläuterungen. Selbst dann
■wird für die persönliche Auffassung naturgemäß
immer noch mehr Spielraum als wünschenswert
bleiben. Unmöglich ist es aber, für jede kunst-
gewerbliche Fachgruppe oder gar für jeden
Kunstgewerbler besondere Rechts-Bestimmungen
zu treffen.
Nach den eingegangenen Antworten kann
meine Auffassung nicht mehr zweifelhaft sein,
trotzdem sich manche Stimmen noch dagegen
wehren, dass z. B. ein selbst in Mengen her-
gestelltes Schulzimmer oder eine solche Küche
unter Umständen als eine kunstgewerbliche Arbeit
bezeichnet werden müsse. Vorbedingung hierfür
ist, dass der Raum selbst und in Verbindung mit
demselben auch die Mobilien nach künstlerischer
Zeichnung in gutem Material und solider Ausführung
einheitlich hergestellt ist. Ich gehe noch weiter
und möchte selbst die aus der einheitlichen Um-
gebung herausgenommene Schulbank für sich
allein auch als »kunstgewerblich« bezeichnen,
selbst wenn sie im wesentlichen nur mit der
Maschine hergestellt ist-, aber in diesem Falle
würde meine Anforderung betreffs Form, Technik
und Material weit höher gehen als bei der Be-
urteilung des einheitlich ausgestatteten Schul-
zimmers. Wenn es sich nun in einem Prozesse
um die Abschätzung und Festsetzung des Wertes
einer solchen Einrichtung handelt, so würde der
Hersteller sehr schlecht fahren, wenn ihm nicht
ein kunstgewerblicher Sachverständiger zur Ver-
fügung stände; der Tischlermeister, welcher nur
mit geringwertiger Massenfabrikation zu tun hat,
würde die ihm vorgelegte Arbeit naturgemäß
unterschätzen. Dies eine Beispiel mag für viele
derartige Vorkommnisse im wirtschaftlichen Leben
des Kunstgewerblers genügen.
Gegen die Ansicht, dass die Erzeugung tech-
nischer Massenfabrikation ohne wesentliche Hand-
arbeit nicht kunstgewerblich sein könne, spricht
auch z. B. die Herstellung der Plaketten und Me-
daillen, welche köstlichen Produkte — wenn sie es
wirklich sind — wir wohl schwerlich im Kunst-
gewerbe entbehren möchten; und wie gern würden
wir auch »Münzen oder gar Vereinsabzeichen,
selbst wenn sie in Tausenden von Exemplaren
hergestellt sind«, zu den kunstgewerblichen
Gegenständen rechnen, wenn sie den Anforde-
rungen des künstlerischen Original-Modelles und
einer fein durchgeführten Technik entsprächen!
Dass dem Sachverständigen in der Praxis
auch Kuriosa vorkommen werden, ist unzweifel-
haft; in dem einzigen, angeführten Falle der
»Sektflasche« ist der Einsender aber über eine
Begriffs-Verwechslung »Gebrauchs«- und »Ver-
brauchs«-Gegenstand« (1) gestolpert.
Nachdem die Schutzrechtler darin einig sind,
dass eine Grenze zwischen Kunst und Kunst-
gewerbe für den Rechtsschutz nicht mehr ge-
zogen werden soll, so möchte ich für die übrigen
ALBERT MANNCHEN—BERLIN.
DEKORATIVE WANDMALEREI »TUGEND UND KRAFT«.
DEUTSCHE ABTEIL. IM KUNSTGEWERBE-PALAST.
695
Grundsätze und Erläuterungen. Selbst dann
■wird für die persönliche Auffassung naturgemäß
immer noch mehr Spielraum als wünschenswert
bleiben. Unmöglich ist es aber, für jede kunst-
gewerbliche Fachgruppe oder gar für jeden
Kunstgewerbler besondere Rechts-Bestimmungen
zu treffen.
Nach den eingegangenen Antworten kann
meine Auffassung nicht mehr zweifelhaft sein,
trotzdem sich manche Stimmen noch dagegen
wehren, dass z. B. ein selbst in Mengen her-
gestelltes Schulzimmer oder eine solche Küche
unter Umständen als eine kunstgewerbliche Arbeit
bezeichnet werden müsse. Vorbedingung hierfür
ist, dass der Raum selbst und in Verbindung mit
demselben auch die Mobilien nach künstlerischer
Zeichnung in gutem Material und solider Ausführung
einheitlich hergestellt ist. Ich gehe noch weiter
und möchte selbst die aus der einheitlichen Um-
gebung herausgenommene Schulbank für sich
allein auch als »kunstgewerblich« bezeichnen,
selbst wenn sie im wesentlichen nur mit der
Maschine hergestellt ist-, aber in diesem Falle
würde meine Anforderung betreffs Form, Technik
und Material weit höher gehen als bei der Be-
urteilung des einheitlich ausgestatteten Schul-
zimmers. Wenn es sich nun in einem Prozesse
um die Abschätzung und Festsetzung des Wertes
einer solchen Einrichtung handelt, so würde der
Hersteller sehr schlecht fahren, wenn ihm nicht
ein kunstgewerblicher Sachverständiger zur Ver-
fügung stände; der Tischlermeister, welcher nur
mit geringwertiger Massenfabrikation zu tun hat,
würde die ihm vorgelegte Arbeit naturgemäß
unterschätzen. Dies eine Beispiel mag für viele
derartige Vorkommnisse im wirtschaftlichen Leben
des Kunstgewerblers genügen.
Gegen die Ansicht, dass die Erzeugung tech-
nischer Massenfabrikation ohne wesentliche Hand-
arbeit nicht kunstgewerblich sein könne, spricht
auch z. B. die Herstellung der Plaketten und Me-
daillen, welche köstlichen Produkte — wenn sie es
wirklich sind — wir wohl schwerlich im Kunst-
gewerbe entbehren möchten; und wie gern würden
wir auch »Münzen oder gar Vereinsabzeichen,
selbst wenn sie in Tausenden von Exemplaren
hergestellt sind«, zu den kunstgewerblichen
Gegenständen rechnen, wenn sie den Anforde-
rungen des künstlerischen Original-Modelles und
einer fein durchgeführten Technik entsprächen!
Dass dem Sachverständigen in der Praxis
auch Kuriosa vorkommen werden, ist unzweifel-
haft; in dem einzigen, angeführten Falle der
»Sektflasche« ist der Einsender aber über eine
Begriffs-Verwechslung »Gebrauchs«- und »Ver-
brauchs«-Gegenstand« (1) gestolpert.
Nachdem die Schutzrechtler darin einig sind,
dass eine Grenze zwischen Kunst und Kunst-
gewerbe für den Rechtsschutz nicht mehr ge-
zogen werden soll, so möchte ich für die übrigen
ALBERT MANNCHEN—BERLIN.
DEKORATIVE WANDMALEREI »TUGEND UND KRAFT«.
DEUTSCHE ABTEIL. IM KUNSTGEWERBE-PALAST.