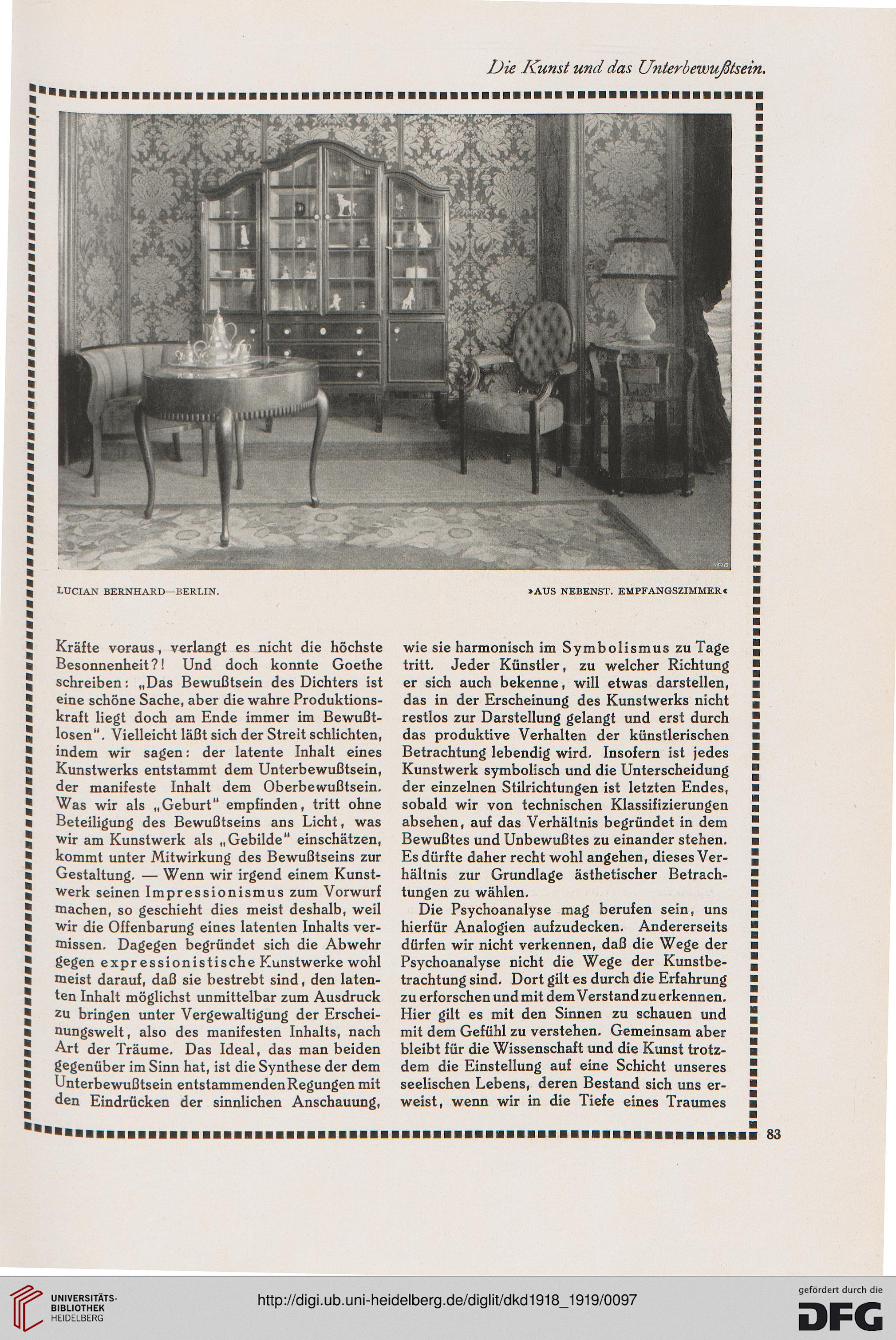Die Kunst und das Unterbewußtsein.
LUCIAN BERNHARD—BERLIN.
»AUS NEBENST. EMPFANGSZIMMER«
Kräfte voraus, verlangt es nicht die höchste
Besonnenheit?! Und doch konnte Goethe
schreiben: „Das Bewußtsein des Dichters ist
eine schöne Sache, aber die wahre Produktions-
kraft liegt doch am Ende immer im Bewußt-
losen". Vielleicht läßt sich der Streit schlichten,
indem wir sagen: der latente Inhalt eines
Kunstwerks entstammt dem Unterbewußtsein,
der manifeste Inhalt dem Oberbewußtsein.
Was wir als „Geburt" empfinden, tritt ohne
Beteiligung des Bewußtseins ans Licht, was
wir am Kunstwerk als „Gebilde" einschätzen,
kommt unter Mitwirkung des Bewußtseins zur
Gestaltung. — Wenn wir irgend einem Kunst-
werk seinen Impressionismus zum Vorwurf
machen, so geschieht dies meist deshalb, weil
wir die Offenbarung eines latenten Inhalts ver-
missen. Dagegen begründet sich die Abwehr
gegen expressionistische Kunstwerke wohl
meist darauf, daß sie bestrebt sind, den laten-
ten Inhalt möglichst unmittelbar zum Ausdruck
zu bringen unter Vergewaltigung der Erschei-
nungswelt , also des manifesten Inhalts, nach
Art der Träume. Das Ideal, das man beiden
gegenüber im Sinn hat, ist die Synthese der dem
Unterbewußtsein entstammendenRegungen mit
den Eindrücken der sinnlichen Anschauung,
wie sie harmonisch im Symbolismus zu Tage
tritt. Jeder Künstler, zu welcher Richtung
er sich auch bekenne, will etwas darstellen,
das in der Erscheinung des Kunstwerks nicht
restlos zur Darstellung gelangt und erst durch
das produktive Verhalten der künstlerischen
Betrachtung lebendig wird. Insofern ist jedes
Kunstwerk symbolisch und die Unterscheidung
der einzelnen Stilrichtungen ist letzten Endes,
sobald wir von technischen Klassifizierungen
absehen, auf das Verhältnis begründet in dem
Bewußtes und Unbewußtes zu einander stehen.
Es dürfte daher recht wohl angehen, dieses Ver-
hältnis zur Grundlage ästhetischer Betrach-
tungen zu wählen.
Die Psychoanalyse mag berufen sein, uns
hierfür Analogien aufzudecken. Andererseits
dürfen wir nicht verkennen, daß die Wege der
Psychoanalyse nicht die Wege der Kunstbe-
trachtung sind. Dort gilt es durch die Erfahrung
zu erforschen und mit dem Verstand zu erkennen.
Hier gilt es mit den Sinnen zu schauen und
mit dem Gefühl zu verstehen. Gemeinsam aber
bleibt für die Wissenschaft und die Kunst trotz-
dem die Einstellung auf eine Schicht unseres
seelischen Lebens, deren Bestand sich uns er-
weist, wenn wir in die Tiefe eines Traumes
83
LUCIAN BERNHARD—BERLIN.
»AUS NEBENST. EMPFANGSZIMMER«
Kräfte voraus, verlangt es nicht die höchste
Besonnenheit?! Und doch konnte Goethe
schreiben: „Das Bewußtsein des Dichters ist
eine schöne Sache, aber die wahre Produktions-
kraft liegt doch am Ende immer im Bewußt-
losen". Vielleicht läßt sich der Streit schlichten,
indem wir sagen: der latente Inhalt eines
Kunstwerks entstammt dem Unterbewußtsein,
der manifeste Inhalt dem Oberbewußtsein.
Was wir als „Geburt" empfinden, tritt ohne
Beteiligung des Bewußtseins ans Licht, was
wir am Kunstwerk als „Gebilde" einschätzen,
kommt unter Mitwirkung des Bewußtseins zur
Gestaltung. — Wenn wir irgend einem Kunst-
werk seinen Impressionismus zum Vorwurf
machen, so geschieht dies meist deshalb, weil
wir die Offenbarung eines latenten Inhalts ver-
missen. Dagegen begründet sich die Abwehr
gegen expressionistische Kunstwerke wohl
meist darauf, daß sie bestrebt sind, den laten-
ten Inhalt möglichst unmittelbar zum Ausdruck
zu bringen unter Vergewaltigung der Erschei-
nungswelt , also des manifesten Inhalts, nach
Art der Träume. Das Ideal, das man beiden
gegenüber im Sinn hat, ist die Synthese der dem
Unterbewußtsein entstammendenRegungen mit
den Eindrücken der sinnlichen Anschauung,
wie sie harmonisch im Symbolismus zu Tage
tritt. Jeder Künstler, zu welcher Richtung
er sich auch bekenne, will etwas darstellen,
das in der Erscheinung des Kunstwerks nicht
restlos zur Darstellung gelangt und erst durch
das produktive Verhalten der künstlerischen
Betrachtung lebendig wird. Insofern ist jedes
Kunstwerk symbolisch und die Unterscheidung
der einzelnen Stilrichtungen ist letzten Endes,
sobald wir von technischen Klassifizierungen
absehen, auf das Verhältnis begründet in dem
Bewußtes und Unbewußtes zu einander stehen.
Es dürfte daher recht wohl angehen, dieses Ver-
hältnis zur Grundlage ästhetischer Betrach-
tungen zu wählen.
Die Psychoanalyse mag berufen sein, uns
hierfür Analogien aufzudecken. Andererseits
dürfen wir nicht verkennen, daß die Wege der
Psychoanalyse nicht die Wege der Kunstbe-
trachtung sind. Dort gilt es durch die Erfahrung
zu erforschen und mit dem Verstand zu erkennen.
Hier gilt es mit den Sinnen zu schauen und
mit dem Gefühl zu verstehen. Gemeinsam aber
bleibt für die Wissenschaft und die Kunst trotz-
dem die Einstellung auf eine Schicht unseres
seelischen Lebens, deren Bestand sich uns er-
weist, wenn wir in die Tiefe eines Traumes
83