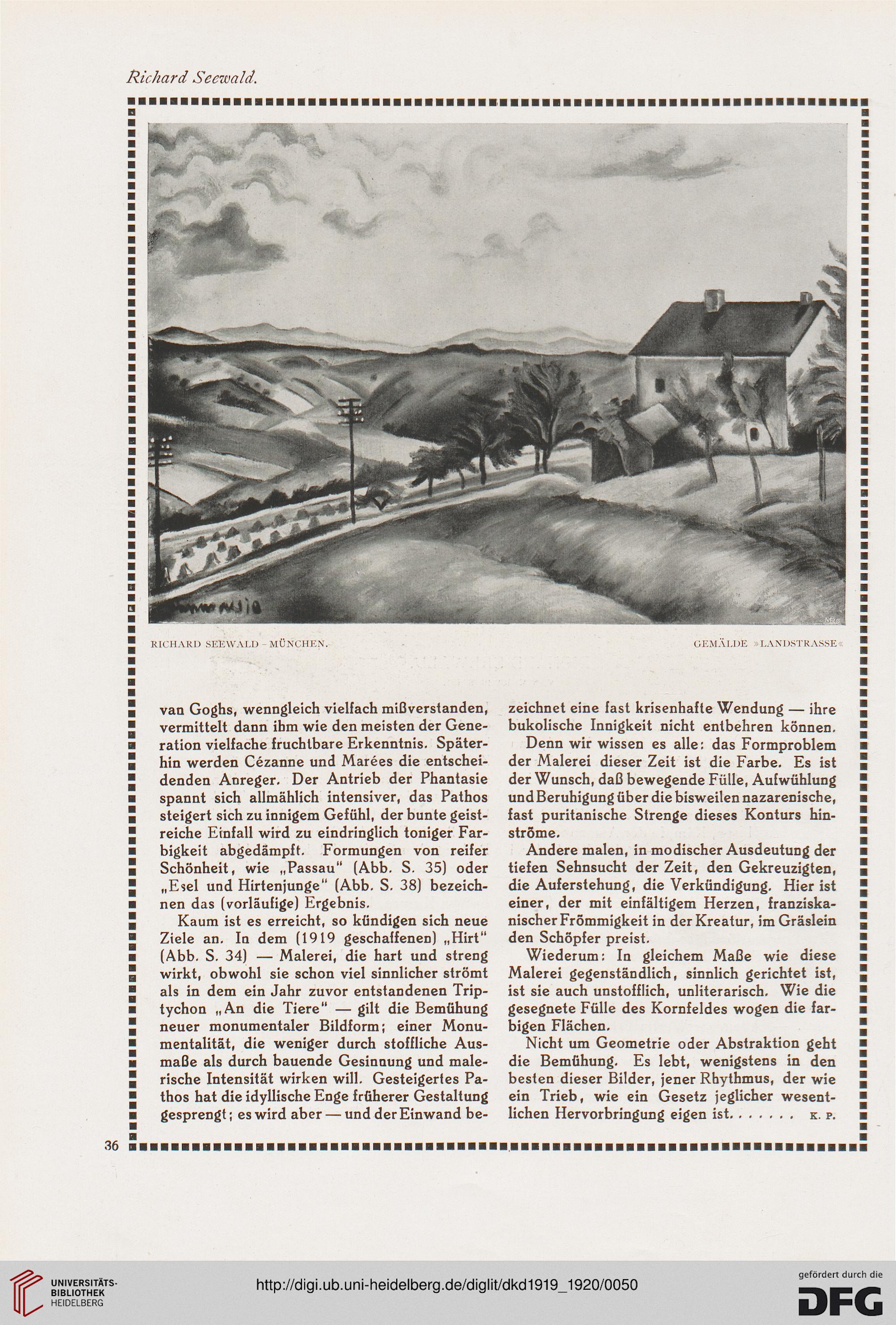Richard Seewald.
van Goghs, wenngleich vielfach mißverstanden,
vermittelt dann ihm wie den meisten der Gene-
ration vielfache fruchtbare Erkenntnis. Später-
hin werden Cezanne und Marees die entschei-
denden Anreger. Der Antrieb der Phantasie
spannt sich allmählich intensiver, das Pathos
steigert sich zu innigem Gefühl, der bunte geist-
reiche Einfall wird zu eindringlich toniger Far-
bigkeit abgedämpft. Formungen von reifer
Schönheit, wie „Passau" (Abb. S. 35) oder
„Esel und Hirtenjunge" (Abb. S. 38) bezeich-
nen das (vorläufige) Ergebnis.
Kaum ist es erreicht, so kündigen sich neue
Ziele an. In dem (1919 geschaffenen) „Hirt"
(Abb. S. 34) — Malerei, die hart und streng
wirkt, obwohl sie schon viel sinnlicher strömt
als in dem ein Jahr zuvor entstandenen Trip-
tychon „An die Tiere" — gilt die Bemühung
neuer monumentaler Bildform; einer Monu-
mentalität, die weniger durch stoffliche Aus-
maße als durch bauende Gesinnung und male-
rische Intensität wirken will. Gesteigerfes Pa-
thos hat die idyllische Enge früherer Gestaltung
gesprengt; es wird aber — und der Einwand be-
zeichnet eine fast krisenhafte Wendung — ihre
bukolische Innigkeit nicht entbehren können.
Denn wir wissen es alle: das Formproblem
der Malerei dieser Zeit ist die Farbe. Es ist
der Wunsch, daß bewegende Fülle, Aufwühlung
und Beruhigung über die bisweilen nazarenische,
fast puritanische Strenge dieses Konturs hin-
ströme.
Andere malen, in modischer Ausdeutung der
tiefen Sehnsucht der Zeit, den Gekreuzigten,
die Auferstehung, die Verkündigung. Hier ist
einer, der mit einfältigem Herzen, franziska-
nischer Frömmigkeit in der Kreatur, im Gräslein
den Schöpfer preist.
Wiederum: In gleichem Maße wie diese
Malerei gegenständlich, sinnlich gerichtet ist,
ist sie auch unstofflich, unliterarisch. Wie die
gesegnete Fülle des Kornfeldes wogen die far-
bigen Flächen.
Nicht um Geometrie oder Abstraktion geht
die Bemühung. Es lebt, wenigstens in den
besten dieser Bilder, jener Rhythmus, der wie
ein Trieb, wie ein Gesetz jeglicher wesent-
lichen Hervorbringung eigen ist....... k. p.
van Goghs, wenngleich vielfach mißverstanden,
vermittelt dann ihm wie den meisten der Gene-
ration vielfache fruchtbare Erkenntnis. Später-
hin werden Cezanne und Marees die entschei-
denden Anreger. Der Antrieb der Phantasie
spannt sich allmählich intensiver, das Pathos
steigert sich zu innigem Gefühl, der bunte geist-
reiche Einfall wird zu eindringlich toniger Far-
bigkeit abgedämpft. Formungen von reifer
Schönheit, wie „Passau" (Abb. S. 35) oder
„Esel und Hirtenjunge" (Abb. S. 38) bezeich-
nen das (vorläufige) Ergebnis.
Kaum ist es erreicht, so kündigen sich neue
Ziele an. In dem (1919 geschaffenen) „Hirt"
(Abb. S. 34) — Malerei, die hart und streng
wirkt, obwohl sie schon viel sinnlicher strömt
als in dem ein Jahr zuvor entstandenen Trip-
tychon „An die Tiere" — gilt die Bemühung
neuer monumentaler Bildform; einer Monu-
mentalität, die weniger durch stoffliche Aus-
maße als durch bauende Gesinnung und male-
rische Intensität wirken will. Gesteigerfes Pa-
thos hat die idyllische Enge früherer Gestaltung
gesprengt; es wird aber — und der Einwand be-
zeichnet eine fast krisenhafte Wendung — ihre
bukolische Innigkeit nicht entbehren können.
Denn wir wissen es alle: das Formproblem
der Malerei dieser Zeit ist die Farbe. Es ist
der Wunsch, daß bewegende Fülle, Aufwühlung
und Beruhigung über die bisweilen nazarenische,
fast puritanische Strenge dieses Konturs hin-
ströme.
Andere malen, in modischer Ausdeutung der
tiefen Sehnsucht der Zeit, den Gekreuzigten,
die Auferstehung, die Verkündigung. Hier ist
einer, der mit einfältigem Herzen, franziska-
nischer Frömmigkeit in der Kreatur, im Gräslein
den Schöpfer preist.
Wiederum: In gleichem Maße wie diese
Malerei gegenständlich, sinnlich gerichtet ist,
ist sie auch unstofflich, unliterarisch. Wie die
gesegnete Fülle des Kornfeldes wogen die far-
bigen Flächen.
Nicht um Geometrie oder Abstraktion geht
die Bemühung. Es lebt, wenigstens in den
besten dieser Bilder, jener Rhythmus, der wie
ein Trieb, wie ein Gesetz jeglicher wesent-
lichen Hervorbringung eigen ist....... k. p.