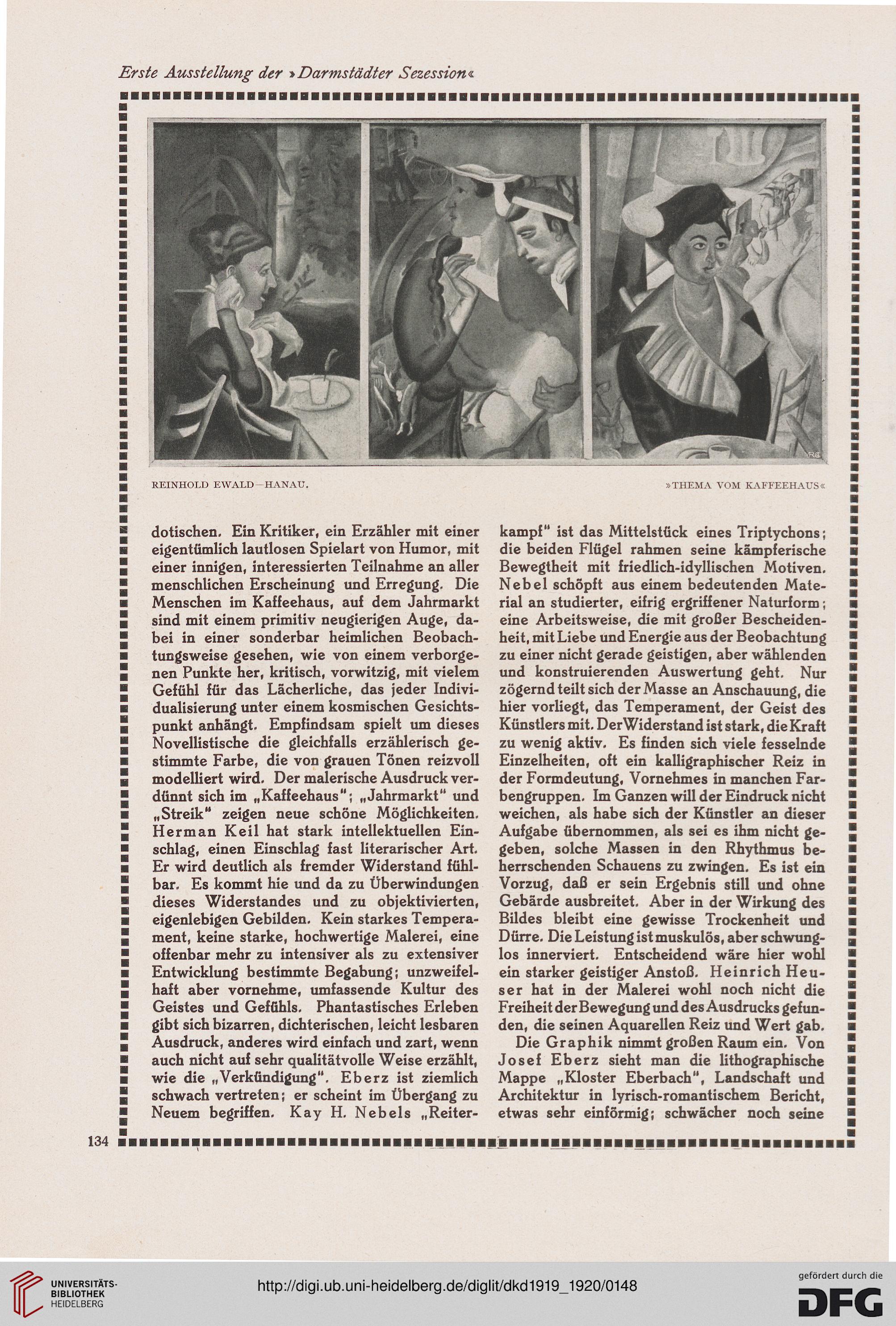Erste Ausstellung der »Darmstädter Sezession«.
REINH07.D EWALD-HANAU.
»THEMA VOM KAFFEEHAUS«
dotischen. Ein Kritiker, ein Erzähler mit einer
eigentümlich lautlosen Spielart von Humor, mit
einer innigen, interessierten Teilnahme an aller
menschlichen Erscheinung und Erregung. Die
Menschen im Kaffeehaus, auf dem Jahrmarkt
sind mit einem primitiv neugierigen Auge, da-
bei in einer sonderbar heimlichen Beobach-
tungsweise gesehen, wie von einem verborge-
nen Punkte her, kritisch, vorwitzig, mit vielem
Gefühl für das Lächerliche, das jeder Indivi-
dualisierung unter einem kosmischen Gesichts-
punkt anhängt. Empfindsam spielt um dieses
Novellistische die gleichfalls erzählerisch ge-
stimmte Farbe, die von grauen Tönen reizvoll
modelliert wird. Der malerische Ausdruck ver-
dünnt sich im „Kaffeehaus"; „Jahrmarkt" und
„Streik" zeigen neue schöne Möglichkeiten.
Herman Keil hat stark intellektuellen Ein-
schlag, einen Einschlag fast literarischer Art.
Er wird deutlich als fremder Widerstand fühl-
bar. Es kommt hie und da zu Überwindungen
dieses Widerstandes und zu objektivierten,
eigenlebigen Gebilden. Kein starkes Tempera-
ment, keine starke, hochwertige Malerei, eine
offenbar mehr zu intensiver als zu extensiver
Entwicklung bestimmte Begabung; unzweifel-
haft aber vornehme, umfassende Kultur des
Geistes und Gefühls. Phantastisches Erleben
gibt sich bizarren, dichterischen, leicht lesbaren
Ausdruck, anderes wird einfach und zart, wenn
auch nicht auf sehr qualitätvolle Weise erzählt,
wie die „Verkündigung". Eberz ist ziemlich
schwach vertreten; er scheint im Übergang zu
Neuem begriffen. Kay H. Nebels „Reiter-
kampf" ist das Mittelstück eines Triptychons;
die beiden Flügel rahmen seine kämpferische
Bewegtheit mit friedlich-idyllischen Motiven.
Nebel schöpft aus einem bedeutenden Mate-
rial an studierter, eifrig ergriffener Naturform;
eine Arbeitsweise, die mit großer Bescheiden-
heit, mit Liebe und Energie aus der Beobachtung
zu einer nicht gerade geistigen, aber wählenden
und konstruierenden Auswertung geht. Nur
zögernd teilt sich der Masse an Anschauung, die
hier vorliegt, das Temperament, der Geist des
Künstlers mit. DerWiderstand ist stark, die Kraft
zu wenig aktiv. Es finden sich viele fesselnde
Einzelheiten, oft ein kalligraphischer Reiz in
der Formdeutung, Vornehmes in manchen Far-
bengruppen. Im Ganzen will der Eindruck nicht
weichen, als habe sich der Künstler an dieser
Aufgabe übernommen, als sei es ihm nicht ge-
geben, solche Massen in den Rhythmus be-
herrschenden Schauens zu zwingen. Es ist ein
Vorzug, daß er sein Ergebnis still und ohne
Gebärde ausbreitet. Aber in der Wirkung des
Bildes bleibt eine gewisse Trockenheit und
Dürre. Die Leistung ist muskulös, aber schwung-
los innerviert. Entscheidend wäre hier wohl
ein starker geistiger Anstoß. Heinrich Heu-
ser hat in der Malerei wohl noch nicht die
Freiheit der Bewegung und des Ausdrucks gefun-
den, die seinen Aquarellen Reiz und Wert gab.
Die Graphik nimmt großen Raum ein. Von
Josef Eberz sieht man die lithographische
Mappe „Kloster Eberbach", Landschaft und
Architektur in lyrisch-romantischem Bericht,
etwas sehr einförmig; schwächer noch seine
REINH07.D EWALD-HANAU.
»THEMA VOM KAFFEEHAUS«
dotischen. Ein Kritiker, ein Erzähler mit einer
eigentümlich lautlosen Spielart von Humor, mit
einer innigen, interessierten Teilnahme an aller
menschlichen Erscheinung und Erregung. Die
Menschen im Kaffeehaus, auf dem Jahrmarkt
sind mit einem primitiv neugierigen Auge, da-
bei in einer sonderbar heimlichen Beobach-
tungsweise gesehen, wie von einem verborge-
nen Punkte her, kritisch, vorwitzig, mit vielem
Gefühl für das Lächerliche, das jeder Indivi-
dualisierung unter einem kosmischen Gesichts-
punkt anhängt. Empfindsam spielt um dieses
Novellistische die gleichfalls erzählerisch ge-
stimmte Farbe, die von grauen Tönen reizvoll
modelliert wird. Der malerische Ausdruck ver-
dünnt sich im „Kaffeehaus"; „Jahrmarkt" und
„Streik" zeigen neue schöne Möglichkeiten.
Herman Keil hat stark intellektuellen Ein-
schlag, einen Einschlag fast literarischer Art.
Er wird deutlich als fremder Widerstand fühl-
bar. Es kommt hie und da zu Überwindungen
dieses Widerstandes und zu objektivierten,
eigenlebigen Gebilden. Kein starkes Tempera-
ment, keine starke, hochwertige Malerei, eine
offenbar mehr zu intensiver als zu extensiver
Entwicklung bestimmte Begabung; unzweifel-
haft aber vornehme, umfassende Kultur des
Geistes und Gefühls. Phantastisches Erleben
gibt sich bizarren, dichterischen, leicht lesbaren
Ausdruck, anderes wird einfach und zart, wenn
auch nicht auf sehr qualitätvolle Weise erzählt,
wie die „Verkündigung". Eberz ist ziemlich
schwach vertreten; er scheint im Übergang zu
Neuem begriffen. Kay H. Nebels „Reiter-
kampf" ist das Mittelstück eines Triptychons;
die beiden Flügel rahmen seine kämpferische
Bewegtheit mit friedlich-idyllischen Motiven.
Nebel schöpft aus einem bedeutenden Mate-
rial an studierter, eifrig ergriffener Naturform;
eine Arbeitsweise, die mit großer Bescheiden-
heit, mit Liebe und Energie aus der Beobachtung
zu einer nicht gerade geistigen, aber wählenden
und konstruierenden Auswertung geht. Nur
zögernd teilt sich der Masse an Anschauung, die
hier vorliegt, das Temperament, der Geist des
Künstlers mit. DerWiderstand ist stark, die Kraft
zu wenig aktiv. Es finden sich viele fesselnde
Einzelheiten, oft ein kalligraphischer Reiz in
der Formdeutung, Vornehmes in manchen Far-
bengruppen. Im Ganzen will der Eindruck nicht
weichen, als habe sich der Künstler an dieser
Aufgabe übernommen, als sei es ihm nicht ge-
geben, solche Massen in den Rhythmus be-
herrschenden Schauens zu zwingen. Es ist ein
Vorzug, daß er sein Ergebnis still und ohne
Gebärde ausbreitet. Aber in der Wirkung des
Bildes bleibt eine gewisse Trockenheit und
Dürre. Die Leistung ist muskulös, aber schwung-
los innerviert. Entscheidend wäre hier wohl
ein starker geistiger Anstoß. Heinrich Heu-
ser hat in der Malerei wohl noch nicht die
Freiheit der Bewegung und des Ausdrucks gefun-
den, die seinen Aquarellen Reiz und Wert gab.
Die Graphik nimmt großen Raum ein. Von
Josef Eberz sieht man die lithographische
Mappe „Kloster Eberbach", Landschaft und
Architektur in lyrisch-romantischem Bericht,
etwas sehr einförmig; schwächer noch seine