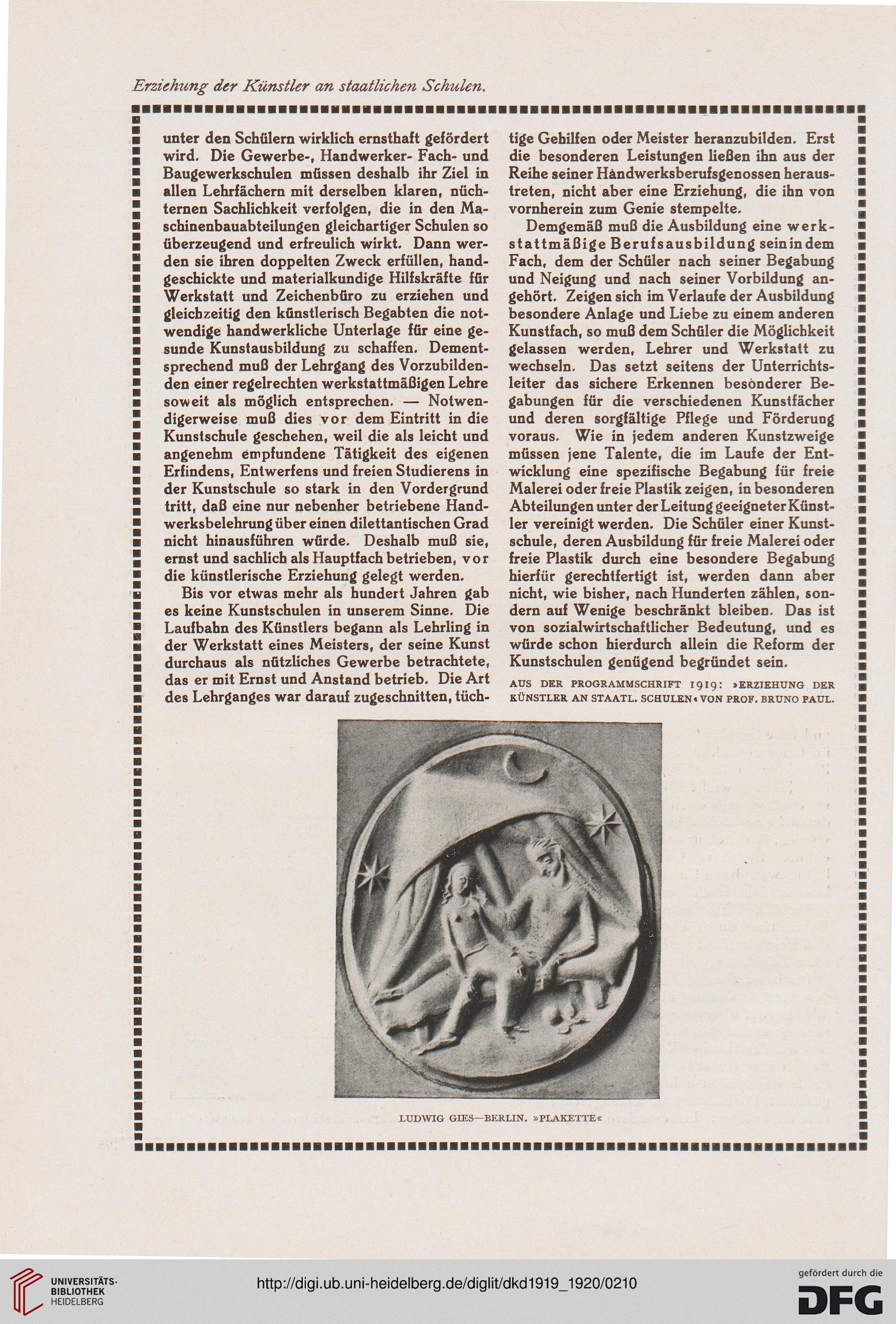Erziehung der Künstler an staatlichen Schulen.
unter den Schülern wirklich ernsthaft gefördert
wird. Die Gewerbe-, Handwerker- Fach- und
Baugewerkschulen müssen deshalb ihr Ziel in
allen Lehrfächern mit derselben klaren, nüch-
ternen Sachlichkeit verfolgen, die in den Ma-
schinenbauabteilungen gleichartiger Schulen so
überzeugend und erfreulich wirkt. Dann wer-
den sie ihren doppelten Zweck erfüllen, hand-
geschickte und materialkundige Hilfskräfte für
Werkstatt und Zeichenbüro zu erziehen und
gleichzeitig den künstlerisch Begabten die not-
wendige handwerkliche Unterlage für eine ge-
sunde Kunstausbildung zu schaffen. Dement-
sprechend muß der Lehrgang des Vorzubilden-
den einer regelrechten werkstattmäßigen Lehre
soweit als möglich entsprechen. — Notwen-
digerweise muß dies vor dem Eintritt in die
Kunstschule geschehen, weil die als leicht und
angenehm empfundene Tätigkeit des eigenen
Erfindens, Entwerfens und freien Studierens in
der Kunstschule so stark in den Vordergrund
tritt, daß eine nur nebenher betriebene Hand-
werksbelehrung über einen dilettantischen Grad
nicht hinausführen würde. Deshalb muß sie,
ernst und sachlich als Hauptfach betrieben, vor
die künstlerische Erziehung gelegt werden.
Bis vor etwas mehr als hundert Jahren gab
es keine Kunstschulen in unserem Sinne. Die
Laufbahn des Künstlers begann als Lehrling in
der Werkstatt eines Meisters, der seine Kunst
durchaus als nützliches Gewerbe betrachtete,
das er mit Ernst und Anstand betrieb. Die Art
des Lehrganges war darauf zugeschnitten, tüch-
tige Gehilfen oder Meister heranzubilden. Erst
die besonderen Leistungen ließen ihn aus der
Reihe seiner Händwerksberufsgenossen heraus-
treten, nicht aber eine Erziehung, die ihn von
vornherein zum Genie stempelte.
Demgemäß muß die Ausbildung eine werk-
stattmäßige Berufsausbildung sein in dem
Fach, dem der Schüler nach seiner Begabung
und Neigung und nach seiner Vorbildung an-
gehört. Zeigen sich im Verlaufe der Ausbildung
besondere Anlage und Liebe zu einem anderen
Kunstfach, so muß dem Schüler die Möglichkeit
gelassen werden, Lehrer und Werkstatt zu
wechseln. Das setzt seitens der Unterrichts-
leiter das sichere Erkennen besonderer Be-
gabungen für die verschiedenen Kunstfächer
und deren sorgfältige Pflege und Förderung
voraus. Wie in jedem anderen Kunstzweige
müssen jene Talente, die im Laufe der Ent-
wicklung eine spezifische Begabung für freie
Malerei oder freie Plastik zeigen, in besonderen
Abteilungen unter der Leitung geeigneter Künst-
ler vereinigt werden. Die Schüler einer Kunst-
schule, deren Ausbildung für freie Malerei oder
freie Plastik durch eine besondere Begabung
hierfür gerechtfertigt ist, werden dann aber
nicht, wie bisher, nach Hunderten zählen, son-
dern auf Wenige beschränkt bleiben. Das ist
von sozialwirtschaftlicher Bedeutung, und es
würde schon hierdurch allein die Reform der
Kunstschulen genügend begründet sein.
AUS DER PROGRAMMSCHRIFT I9I9: »ERZIEHUNG DER
KÜNSTLER AN STAATL. SCHULEN« VON PROF. BRUNO PAUL.
LUDWIG GLES—BERLIN. »PLAKETTE«
unter den Schülern wirklich ernsthaft gefördert
wird. Die Gewerbe-, Handwerker- Fach- und
Baugewerkschulen müssen deshalb ihr Ziel in
allen Lehrfächern mit derselben klaren, nüch-
ternen Sachlichkeit verfolgen, die in den Ma-
schinenbauabteilungen gleichartiger Schulen so
überzeugend und erfreulich wirkt. Dann wer-
den sie ihren doppelten Zweck erfüllen, hand-
geschickte und materialkundige Hilfskräfte für
Werkstatt und Zeichenbüro zu erziehen und
gleichzeitig den künstlerisch Begabten die not-
wendige handwerkliche Unterlage für eine ge-
sunde Kunstausbildung zu schaffen. Dement-
sprechend muß der Lehrgang des Vorzubilden-
den einer regelrechten werkstattmäßigen Lehre
soweit als möglich entsprechen. — Notwen-
digerweise muß dies vor dem Eintritt in die
Kunstschule geschehen, weil die als leicht und
angenehm empfundene Tätigkeit des eigenen
Erfindens, Entwerfens und freien Studierens in
der Kunstschule so stark in den Vordergrund
tritt, daß eine nur nebenher betriebene Hand-
werksbelehrung über einen dilettantischen Grad
nicht hinausführen würde. Deshalb muß sie,
ernst und sachlich als Hauptfach betrieben, vor
die künstlerische Erziehung gelegt werden.
Bis vor etwas mehr als hundert Jahren gab
es keine Kunstschulen in unserem Sinne. Die
Laufbahn des Künstlers begann als Lehrling in
der Werkstatt eines Meisters, der seine Kunst
durchaus als nützliches Gewerbe betrachtete,
das er mit Ernst und Anstand betrieb. Die Art
des Lehrganges war darauf zugeschnitten, tüch-
tige Gehilfen oder Meister heranzubilden. Erst
die besonderen Leistungen ließen ihn aus der
Reihe seiner Händwerksberufsgenossen heraus-
treten, nicht aber eine Erziehung, die ihn von
vornherein zum Genie stempelte.
Demgemäß muß die Ausbildung eine werk-
stattmäßige Berufsausbildung sein in dem
Fach, dem der Schüler nach seiner Begabung
und Neigung und nach seiner Vorbildung an-
gehört. Zeigen sich im Verlaufe der Ausbildung
besondere Anlage und Liebe zu einem anderen
Kunstfach, so muß dem Schüler die Möglichkeit
gelassen werden, Lehrer und Werkstatt zu
wechseln. Das setzt seitens der Unterrichts-
leiter das sichere Erkennen besonderer Be-
gabungen für die verschiedenen Kunstfächer
und deren sorgfältige Pflege und Förderung
voraus. Wie in jedem anderen Kunstzweige
müssen jene Talente, die im Laufe der Ent-
wicklung eine spezifische Begabung für freie
Malerei oder freie Plastik zeigen, in besonderen
Abteilungen unter der Leitung geeigneter Künst-
ler vereinigt werden. Die Schüler einer Kunst-
schule, deren Ausbildung für freie Malerei oder
freie Plastik durch eine besondere Begabung
hierfür gerechtfertigt ist, werden dann aber
nicht, wie bisher, nach Hunderten zählen, son-
dern auf Wenige beschränkt bleiben. Das ist
von sozialwirtschaftlicher Bedeutung, und es
würde schon hierdurch allein die Reform der
Kunstschulen genügend begründet sein.
AUS DER PROGRAMMSCHRIFT I9I9: »ERZIEHUNG DER
KÜNSTLER AN STAATL. SCHULEN« VON PROF. BRUNO PAUL.
LUDWIG GLES—BERLIN. »PLAKETTE«