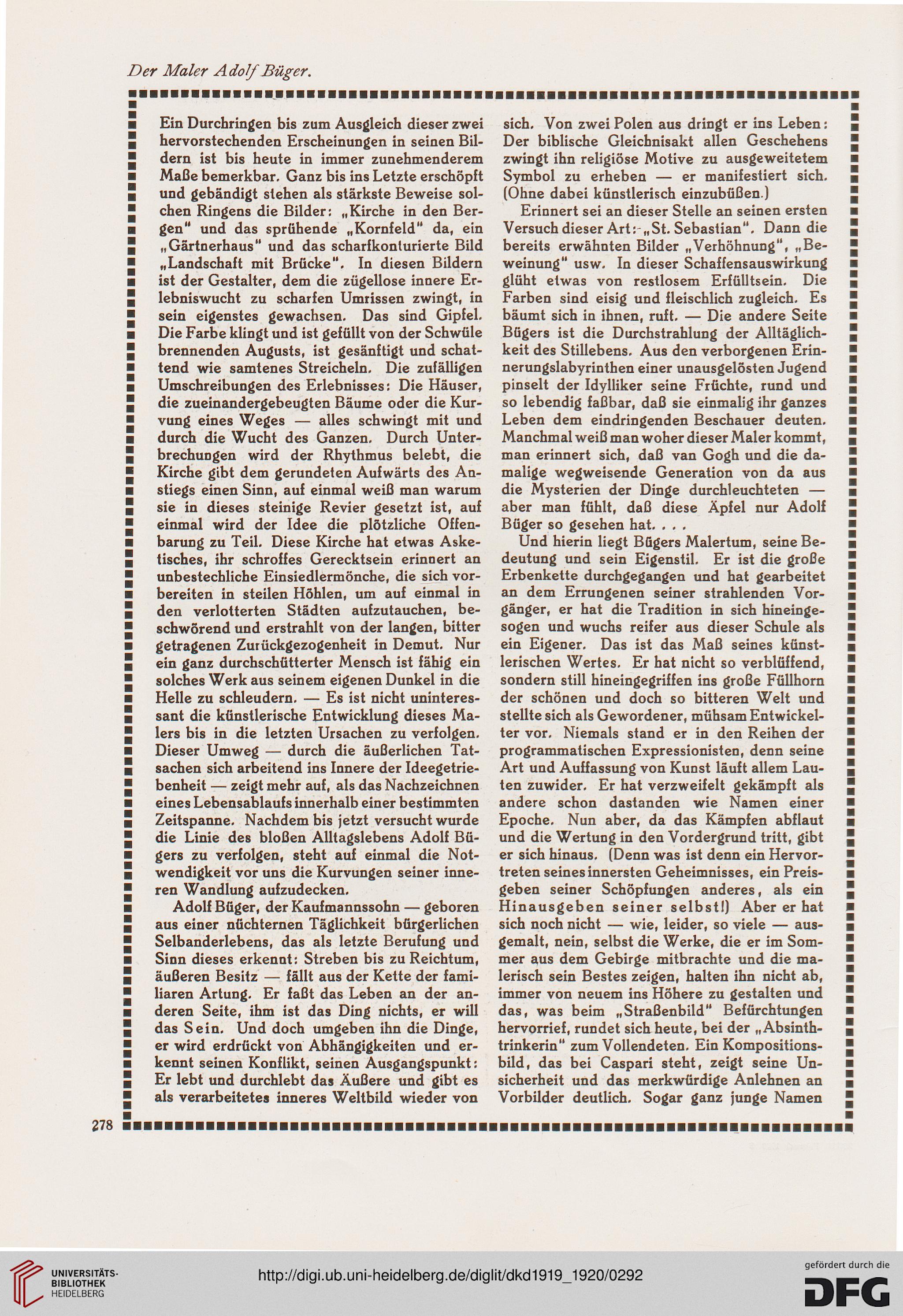Der Maler A dolf Büger.
Ein Durchringen bis zum Ausgleich dieser zwei
hervorstechenden Erscheinungen in seinen Bil-
dern ist bis heute in immer zunehmenderem
Maße bemerkbar. Ganz bis ins Letzte erschöpft
und gebändigt stehen als stärkste Beweise sol-
chen Ringens die Bilder: „Kirche in den Ber-
gen" und das sprühende „Kornfeld" da, ein
„Gärtnerhaus" und das scharfkonturierte Bild
„Landschaft mit Brücke". In diesen Bildern
ist der Gestalter, dem die zügellose innere Er-
lebniswucht zu scharfen Umrissen zwingt, in
sein eigenstes gewachsen. Das sind Gipfel.
Die Farbe klingt und ist gefüllt von der Schwüle
brennenden Augusts, ist gesänftigt und schat-
tend wie samtenes Streicheln. Die zufälligen
Umschreibungen des Erlebnisses: Die Häuser,
die zueinandergebeugten Bäume oder die Kur-
vung eines Weges — alles schwingt mit und
durch die Wucht des Ganzen. Durch Unter-
brechungen wird der Rhythmus belebt, die
Kirche gibt dem gerundeten Aufwärts des An-
stiegs einen Sinn, auf einmal weiß man warum
sie in dieses steinige Revier gesetzt ist, auf
einmal wird der Idee die plötzliche Offen-
barung zu Teil. Diese Kirche hat etwas Aske-
tisches, ihr schroffes Gerecktsein erinnert an
unbestechliche Einsiedlermönche, die sich vor-
bereiten in steilen Höhlen, um auf einmal in
den verlotterten Städten aufzutauchen, be-
schwörend und erstrahlt von der langen, bitter
getragenen Zurückgezogenheit in Demut. Nur
ein ganz durchschütterter Mensch ist fähig ein
solches Werk aus seinem eigenen Dunkel in die
Helle zu schleudern. — Es ist nicht uninteres-
sant die künstlerische Entwicklung dieses Ma-
lers bis in die letzten Ursachen zu verfolgen.
Dieser Umweg — durch die äußerlichen Tat-
sachen sich arbeitend ins Innere der Ideegetrie-
benheit — zeigt mehr auf, als das Nachzeichnen
eines Lebensablaufs innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne. Nachdem bis jetzt versucht wurde
die Linie des bloßen Alltagslebens Adolf Bü-
gers zu verfolgen, steht auf einmal die Not-
wendigkeit vor uns die Kurvungen seiner inne-
ren Wandlung aufzudecken.
Adolf Büger, der Kaufmannssohn — geboren
aus einer nüchternen Täglichkeit bürgerlichen
Seibanderlebens, das als letzte Berufung und
Sinn dieses erkennt: Streben bis zu Reichtum,
äußeren Besitz — fällt aus der Kette der fami-
liären Artung. Er faßt das Leben an der an-
deren Seite, ihm ist das Ding nichts, er will
das Sein. Und doch umgeben ihn die Dinge,
er wird erdrückt von Abhängigkeiten und er-
kennt seinen Konflikt, seinen Ausgangspunkt:
Er lebt und durchlebt das Äußere und gibt es
als verarbeitetes inneres Weltbild wieder von
sich. Von zwei Polen aus dringt er ins Leben:
Der biblische Gleichnisakt allen Geschehens
zwingt ihn religiöse Motive zu ausgeweitetem
Symbol zu erheben — er manifestiert sich.
(Ohne dabei künstlerisch einzubüßen.)
Erinnert sei an dieser Stelle an seinen ersten
Versuch dieser Art: „St. Sebastian". Dann die
bereits erwähnten Bilder „Verhöhnung", „Be-
weinung" usw. In dieser Schaffensauswirkung
glüht etwas von restlosem Erfülltsein. Die
Farben sind eisig und fleischlich zugleich. Es
bäumt sich in ihnen, ruft. — Die andere Seite
Bügers ist die Durchstrahlung der Alltäglich-
keit des Stillebens. Aus den verborgenen Erin-
nerungslabyrinthen einer unausgelösten Jugend
pinselt der Idylliker seine Früchte, rund und
so lebendig faßbar, daß sie einmalig ihr ganzes
Leben dem eindringenden Beschauer deuten.
Manchmal weiß man woher dieser Maler kommt,
man erinnert sich, daß van Gogh und die da-
malige wegweisende Generation von da aus
die Mysterien der Dinge durchleuchteten —
aber man fühlt, daß diese Äpfel nur Adolf
Büger so gesehen hat. . . .
Und hierin liegt Bügers Malertum, seine Be-
deutung und sein Eigenstil. Er ist die große
Erbenkette durchgegangen und hat gearbeitet
an dem Errungenen seiner strahlenden Vor-
gänger, er hat die Tradition in sich hineinge-
sogen und wuchs reifer aus dieser Schule als
ein Eigener. Das ist das Maß seines künst-
lerischen Wertes. Er hat nicht so verblüffend,
sondern still hineingegriffen ins große Füllhorn
der schönen und doch so bitteren Welt und
stellte sich als Gewordener, mühsam Entwickel-
ter vor. Niemals stand er in den Reihen der
programmatischen Expressionisten, denn seine
Art und Auffassung von Kunst läuft allem Lau-
ten zuwider. Er hat verzweifelt gekämpft als
andere schon dastanden wie Namen einer
Epoche. Nun aber, da das Kämpfen abflaut
und die Wertung in den Vordergrund tritt, gibt
er sich hinaus. (Denn was ist denn ein Hervor-
treten seines innersten Geheimnisses, ein Preis-
geben seiner Schöpfungen anderes, als ein
Hinausgeben seiner selbst!) Aber er hat
sich noch nicht — wie, leider, so viele — aus-
gemalt, nein, selbst die Werke, die er im Som-
mer aus dem Gebirge mitbrachte und die ma-
lerisch sein Bestes zeigen, halten ihn nicht ab,
immer von neuem ins Höhere zu gestalten und
das, was beim „Straßenbild" Befürchtungen
hervorrief, rundet sich heute, bei der „Absinth-
trinkerin" zum Vollendeten. Ein Kompositions-
bild, das bei Caspari steht, zeigt seine Un-
sicherheit und das merkwürdige Anlehnen an
Vorbilder deutlich. Sogar ganz junge Namen
Ein Durchringen bis zum Ausgleich dieser zwei
hervorstechenden Erscheinungen in seinen Bil-
dern ist bis heute in immer zunehmenderem
Maße bemerkbar. Ganz bis ins Letzte erschöpft
und gebändigt stehen als stärkste Beweise sol-
chen Ringens die Bilder: „Kirche in den Ber-
gen" und das sprühende „Kornfeld" da, ein
„Gärtnerhaus" und das scharfkonturierte Bild
„Landschaft mit Brücke". In diesen Bildern
ist der Gestalter, dem die zügellose innere Er-
lebniswucht zu scharfen Umrissen zwingt, in
sein eigenstes gewachsen. Das sind Gipfel.
Die Farbe klingt und ist gefüllt von der Schwüle
brennenden Augusts, ist gesänftigt und schat-
tend wie samtenes Streicheln. Die zufälligen
Umschreibungen des Erlebnisses: Die Häuser,
die zueinandergebeugten Bäume oder die Kur-
vung eines Weges — alles schwingt mit und
durch die Wucht des Ganzen. Durch Unter-
brechungen wird der Rhythmus belebt, die
Kirche gibt dem gerundeten Aufwärts des An-
stiegs einen Sinn, auf einmal weiß man warum
sie in dieses steinige Revier gesetzt ist, auf
einmal wird der Idee die plötzliche Offen-
barung zu Teil. Diese Kirche hat etwas Aske-
tisches, ihr schroffes Gerecktsein erinnert an
unbestechliche Einsiedlermönche, die sich vor-
bereiten in steilen Höhlen, um auf einmal in
den verlotterten Städten aufzutauchen, be-
schwörend und erstrahlt von der langen, bitter
getragenen Zurückgezogenheit in Demut. Nur
ein ganz durchschütterter Mensch ist fähig ein
solches Werk aus seinem eigenen Dunkel in die
Helle zu schleudern. — Es ist nicht uninteres-
sant die künstlerische Entwicklung dieses Ma-
lers bis in die letzten Ursachen zu verfolgen.
Dieser Umweg — durch die äußerlichen Tat-
sachen sich arbeitend ins Innere der Ideegetrie-
benheit — zeigt mehr auf, als das Nachzeichnen
eines Lebensablaufs innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne. Nachdem bis jetzt versucht wurde
die Linie des bloßen Alltagslebens Adolf Bü-
gers zu verfolgen, steht auf einmal die Not-
wendigkeit vor uns die Kurvungen seiner inne-
ren Wandlung aufzudecken.
Adolf Büger, der Kaufmannssohn — geboren
aus einer nüchternen Täglichkeit bürgerlichen
Seibanderlebens, das als letzte Berufung und
Sinn dieses erkennt: Streben bis zu Reichtum,
äußeren Besitz — fällt aus der Kette der fami-
liären Artung. Er faßt das Leben an der an-
deren Seite, ihm ist das Ding nichts, er will
das Sein. Und doch umgeben ihn die Dinge,
er wird erdrückt von Abhängigkeiten und er-
kennt seinen Konflikt, seinen Ausgangspunkt:
Er lebt und durchlebt das Äußere und gibt es
als verarbeitetes inneres Weltbild wieder von
sich. Von zwei Polen aus dringt er ins Leben:
Der biblische Gleichnisakt allen Geschehens
zwingt ihn religiöse Motive zu ausgeweitetem
Symbol zu erheben — er manifestiert sich.
(Ohne dabei künstlerisch einzubüßen.)
Erinnert sei an dieser Stelle an seinen ersten
Versuch dieser Art: „St. Sebastian". Dann die
bereits erwähnten Bilder „Verhöhnung", „Be-
weinung" usw. In dieser Schaffensauswirkung
glüht etwas von restlosem Erfülltsein. Die
Farben sind eisig und fleischlich zugleich. Es
bäumt sich in ihnen, ruft. — Die andere Seite
Bügers ist die Durchstrahlung der Alltäglich-
keit des Stillebens. Aus den verborgenen Erin-
nerungslabyrinthen einer unausgelösten Jugend
pinselt der Idylliker seine Früchte, rund und
so lebendig faßbar, daß sie einmalig ihr ganzes
Leben dem eindringenden Beschauer deuten.
Manchmal weiß man woher dieser Maler kommt,
man erinnert sich, daß van Gogh und die da-
malige wegweisende Generation von da aus
die Mysterien der Dinge durchleuchteten —
aber man fühlt, daß diese Äpfel nur Adolf
Büger so gesehen hat. . . .
Und hierin liegt Bügers Malertum, seine Be-
deutung und sein Eigenstil. Er ist die große
Erbenkette durchgegangen und hat gearbeitet
an dem Errungenen seiner strahlenden Vor-
gänger, er hat die Tradition in sich hineinge-
sogen und wuchs reifer aus dieser Schule als
ein Eigener. Das ist das Maß seines künst-
lerischen Wertes. Er hat nicht so verblüffend,
sondern still hineingegriffen ins große Füllhorn
der schönen und doch so bitteren Welt und
stellte sich als Gewordener, mühsam Entwickel-
ter vor. Niemals stand er in den Reihen der
programmatischen Expressionisten, denn seine
Art und Auffassung von Kunst läuft allem Lau-
ten zuwider. Er hat verzweifelt gekämpft als
andere schon dastanden wie Namen einer
Epoche. Nun aber, da das Kämpfen abflaut
und die Wertung in den Vordergrund tritt, gibt
er sich hinaus. (Denn was ist denn ein Hervor-
treten seines innersten Geheimnisses, ein Preis-
geben seiner Schöpfungen anderes, als ein
Hinausgeben seiner selbst!) Aber er hat
sich noch nicht — wie, leider, so viele — aus-
gemalt, nein, selbst die Werke, die er im Som-
mer aus dem Gebirge mitbrachte und die ma-
lerisch sein Bestes zeigen, halten ihn nicht ab,
immer von neuem ins Höhere zu gestalten und
das, was beim „Straßenbild" Befürchtungen
hervorrief, rundet sich heute, bei der „Absinth-
trinkerin" zum Vollendeten. Ein Kompositions-
bild, das bei Caspari steht, zeigt seine Un-
sicherheit und das merkwürdige Anlehnen an
Vorbilder deutlich. Sogar ganz junge Namen