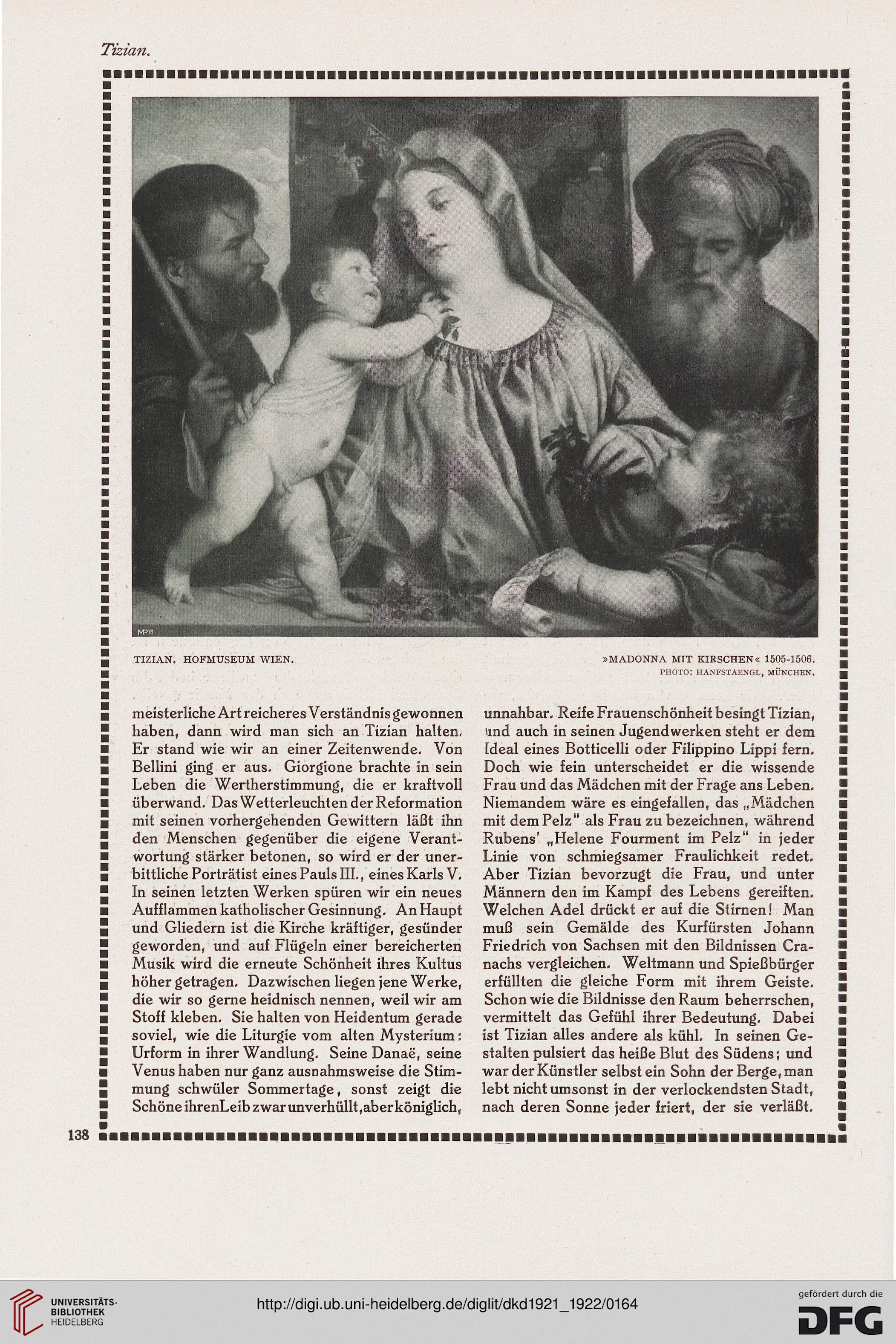Tizian.
meisterliche Art reicheres Verständnis gewonnen
haben, dann wird man sich an Tizian halten.
Er stand wie wir an einer Zeitenwende. Von
Bellini ging er aus. Giorgione brachte in sein
Leben die Wertherstimmung, die er kraftvoll
überwand. Das Wetterleuchten der Reformation
mit seinen vorhergehenden Gewittern läßt ihn
den Menschen gegenüber die eigene Verant-
wortung stärker betonen, so wird er der uner-
bittliche Porträtist eines Pauls III., eines Karls V.
In seinen letzten Werken spüren wir ein neues
Aufflammen katholischer Gesinnung. An Haupt
und Gliedern ist die Kirche kräftiger, gesünder
geworden, und auf Flügeln einer bereicherten
Musik wird die erneute Schönheit ihres Kultus
höher getragen. Dazwischen liegen jene Werke,
die wir so gerne heidnisch nennen, weil wir am
Stoff kleben. Sie halten von Heidentum gerade
soviel, wie die Liturgie vom alten Mysterium:
Urform in ihrer Wandlung. Seine Danae, seine
Venus haben nur ganz ausnahmsweise die Stim-
mung schwüler Sommertage, sonst zeigt die
Schöne ihrenLeib zwar unverhüllt,aberköniglich,
unnahbar. Reife Frauenschönheit besingt Tizian,
und auch in seinen Jugendwerken steht er dem
Ideal eines Botticelli oder Filippino Lippi fern.
Doch wie fein unterscheidet er die wissende
Frau und das Mädchen mit der Frage ans Leben.
Niemandem wäre es eingefallen, das „Mädchen
mit dem Pelz" als Frau zu bezeichnen, während
Rubens' „Helene Fourment im Pelz" in jeder
Linie von schmiegsamer Fraulichkeit redet.
Aber Tizian bevorzugt die Frau, und unter
Männern den im Kampf des Lebens gereiften.
Welchen Adel drückt er auf die Stirnen! Man
muß sein Gemälde des Kurfürsten Johann
Friedrich von Sachsen mit den Bildnissen Cra-
nachs vergleichen. Weltmann und Spießbürger
erfüllten die gleiche Form mit ihrem Geiste.
Schon wie die Bildnisse den Raum beherrschen,
vermittelt das Gefühl ihrer Bedeutung. Dabei
ist Tizian alles andere als kühl. In seinen Ge-
stalten pulsiert das heiße Blut des Südens; und
war der Künstler selbst ein Sohn der Berge, man
lebt nicht umsonst in der verlockendsten Stadt,
nach deren Sonne jeder friert, der sie verläßt.
138
meisterliche Art reicheres Verständnis gewonnen
haben, dann wird man sich an Tizian halten.
Er stand wie wir an einer Zeitenwende. Von
Bellini ging er aus. Giorgione brachte in sein
Leben die Wertherstimmung, die er kraftvoll
überwand. Das Wetterleuchten der Reformation
mit seinen vorhergehenden Gewittern läßt ihn
den Menschen gegenüber die eigene Verant-
wortung stärker betonen, so wird er der uner-
bittliche Porträtist eines Pauls III., eines Karls V.
In seinen letzten Werken spüren wir ein neues
Aufflammen katholischer Gesinnung. An Haupt
und Gliedern ist die Kirche kräftiger, gesünder
geworden, und auf Flügeln einer bereicherten
Musik wird die erneute Schönheit ihres Kultus
höher getragen. Dazwischen liegen jene Werke,
die wir so gerne heidnisch nennen, weil wir am
Stoff kleben. Sie halten von Heidentum gerade
soviel, wie die Liturgie vom alten Mysterium:
Urform in ihrer Wandlung. Seine Danae, seine
Venus haben nur ganz ausnahmsweise die Stim-
mung schwüler Sommertage, sonst zeigt die
Schöne ihrenLeib zwar unverhüllt,aberköniglich,
unnahbar. Reife Frauenschönheit besingt Tizian,
und auch in seinen Jugendwerken steht er dem
Ideal eines Botticelli oder Filippino Lippi fern.
Doch wie fein unterscheidet er die wissende
Frau und das Mädchen mit der Frage ans Leben.
Niemandem wäre es eingefallen, das „Mädchen
mit dem Pelz" als Frau zu bezeichnen, während
Rubens' „Helene Fourment im Pelz" in jeder
Linie von schmiegsamer Fraulichkeit redet.
Aber Tizian bevorzugt die Frau, und unter
Männern den im Kampf des Lebens gereiften.
Welchen Adel drückt er auf die Stirnen! Man
muß sein Gemälde des Kurfürsten Johann
Friedrich von Sachsen mit den Bildnissen Cra-
nachs vergleichen. Weltmann und Spießbürger
erfüllten die gleiche Form mit ihrem Geiste.
Schon wie die Bildnisse den Raum beherrschen,
vermittelt das Gefühl ihrer Bedeutung. Dabei
ist Tizian alles andere als kühl. In seinen Ge-
stalten pulsiert das heiße Blut des Südens; und
war der Künstler selbst ein Sohn der Berge, man
lebt nicht umsonst in der verlockendsten Stadt,
nach deren Sonne jeder friert, der sie verläßt.
138