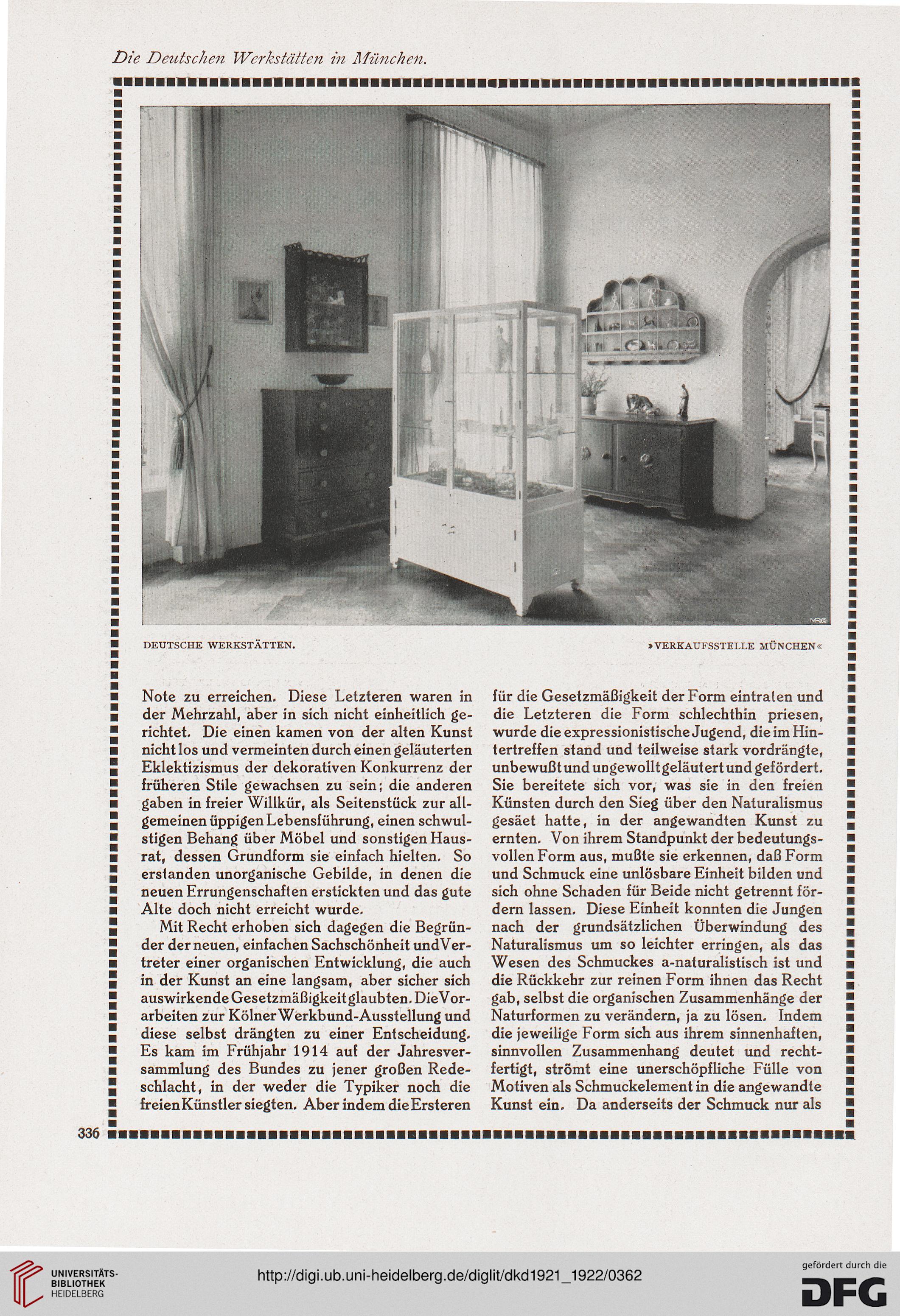Die Deutschen Werkstätten in München.
Note zu erreichen. Diese Letzteren waren in
der Mehrzahl, aber in sich nicht einheitlich ge-
richtet. Die einen kamen von der alten Kunst
nicht los und vermeinten durch einen geläuterten
Eklektizismus der dekorativen Konkurrenz der
früheren Stile gewachsen zu sein; die anderen
gaben in freier Willkür, als Seitenstück zur all-
gemeinen üppigen Lebensführung, einen schwul-
stigen Behang über Möbel und sonstigen Haus-
rat, dessen Grundform sie einfach hielten. So
erstanden unorganische Gebilde, in denen die
neuen Errungenschaften erstickten und das gute
Alte doch nicht erreicht wurde.
Mit Recht erhoben sich dagegen die Begrün-
der der neuen, einfachen Sachschönheit undVer-
treter einer organischen Entwicklung, die auch
in der Kunst an eine langsam, aber sicher sich
auswirkende Gesetzmäßigkeit glaubten. Die Vor-
arbeiten zur Kölner Werkbund-Ausstellung und
diese selbst drängten zu einer Entscheidung.
Es kam im Frühjahr 1914 auf der Jahresver-
sammlung des Bundes zu jener großen Rede-
schlacht, in der weder die Typiker noch die
freien Künstler siegten. Aber indem dieErsteren
für die Gesetzmäßigkeit der Form eintraten und
die Letzteren die Form schlechthin priesen,
wurde die expressionistische Jugend, die im Hin-
tertreffen stand und teilweise stark vordrängte,
unbewußt und ungewollt geläutert und gefördert.
Sie bereitete sich vor, was sie in den freien
Künsten durch den Sieg über den Naturalismus
gesäet hatte, in der angewandten Kunst zu
ernten. Von ihrem Standpunkt der bedeutungs-
vollen Form aus, mußte sie erkennen, daß Form
und Schmuck eine unlösbare Einheit bilden und
sich ohne Schaden für Beide nicht getrennt för-
dern lassen. Diese Einheit konnten die Jungen
nach der grundsätzlichen Überwindung des
Naturalismus um so leichter erringen, als das
Wesen des Schmuckes a-naturalistisch ist und
die Rückkehr zur reinen Form ihnen das Recht
gab, selbst die organischen Zusammenhänge der
Naturformen zu verändern, ja zu lösen. Indem
die jeweilige Form sich aus ihrem sinnenhaften,
sinnvollen Zusammenhang deutet und recht-
fertigt, strömt eine unerschöpfliche Fülle von
Motiven als Schmuckelement in die angewandte
Kunst ein. Da anderseits der Schmuck nur als
Note zu erreichen. Diese Letzteren waren in
der Mehrzahl, aber in sich nicht einheitlich ge-
richtet. Die einen kamen von der alten Kunst
nicht los und vermeinten durch einen geläuterten
Eklektizismus der dekorativen Konkurrenz der
früheren Stile gewachsen zu sein; die anderen
gaben in freier Willkür, als Seitenstück zur all-
gemeinen üppigen Lebensführung, einen schwul-
stigen Behang über Möbel und sonstigen Haus-
rat, dessen Grundform sie einfach hielten. So
erstanden unorganische Gebilde, in denen die
neuen Errungenschaften erstickten und das gute
Alte doch nicht erreicht wurde.
Mit Recht erhoben sich dagegen die Begrün-
der der neuen, einfachen Sachschönheit undVer-
treter einer organischen Entwicklung, die auch
in der Kunst an eine langsam, aber sicher sich
auswirkende Gesetzmäßigkeit glaubten. Die Vor-
arbeiten zur Kölner Werkbund-Ausstellung und
diese selbst drängten zu einer Entscheidung.
Es kam im Frühjahr 1914 auf der Jahresver-
sammlung des Bundes zu jener großen Rede-
schlacht, in der weder die Typiker noch die
freien Künstler siegten. Aber indem dieErsteren
für die Gesetzmäßigkeit der Form eintraten und
die Letzteren die Form schlechthin priesen,
wurde die expressionistische Jugend, die im Hin-
tertreffen stand und teilweise stark vordrängte,
unbewußt und ungewollt geläutert und gefördert.
Sie bereitete sich vor, was sie in den freien
Künsten durch den Sieg über den Naturalismus
gesäet hatte, in der angewandten Kunst zu
ernten. Von ihrem Standpunkt der bedeutungs-
vollen Form aus, mußte sie erkennen, daß Form
und Schmuck eine unlösbare Einheit bilden und
sich ohne Schaden für Beide nicht getrennt för-
dern lassen. Diese Einheit konnten die Jungen
nach der grundsätzlichen Überwindung des
Naturalismus um so leichter erringen, als das
Wesen des Schmuckes a-naturalistisch ist und
die Rückkehr zur reinen Form ihnen das Recht
gab, selbst die organischen Zusammenhänge der
Naturformen zu verändern, ja zu lösen. Indem
die jeweilige Form sich aus ihrem sinnenhaften,
sinnvollen Zusammenhang deutet und recht-
fertigt, strömt eine unerschöpfliche Fülle von
Motiven als Schmuckelement in die angewandte
Kunst ein. Da anderseits der Schmuck nur als