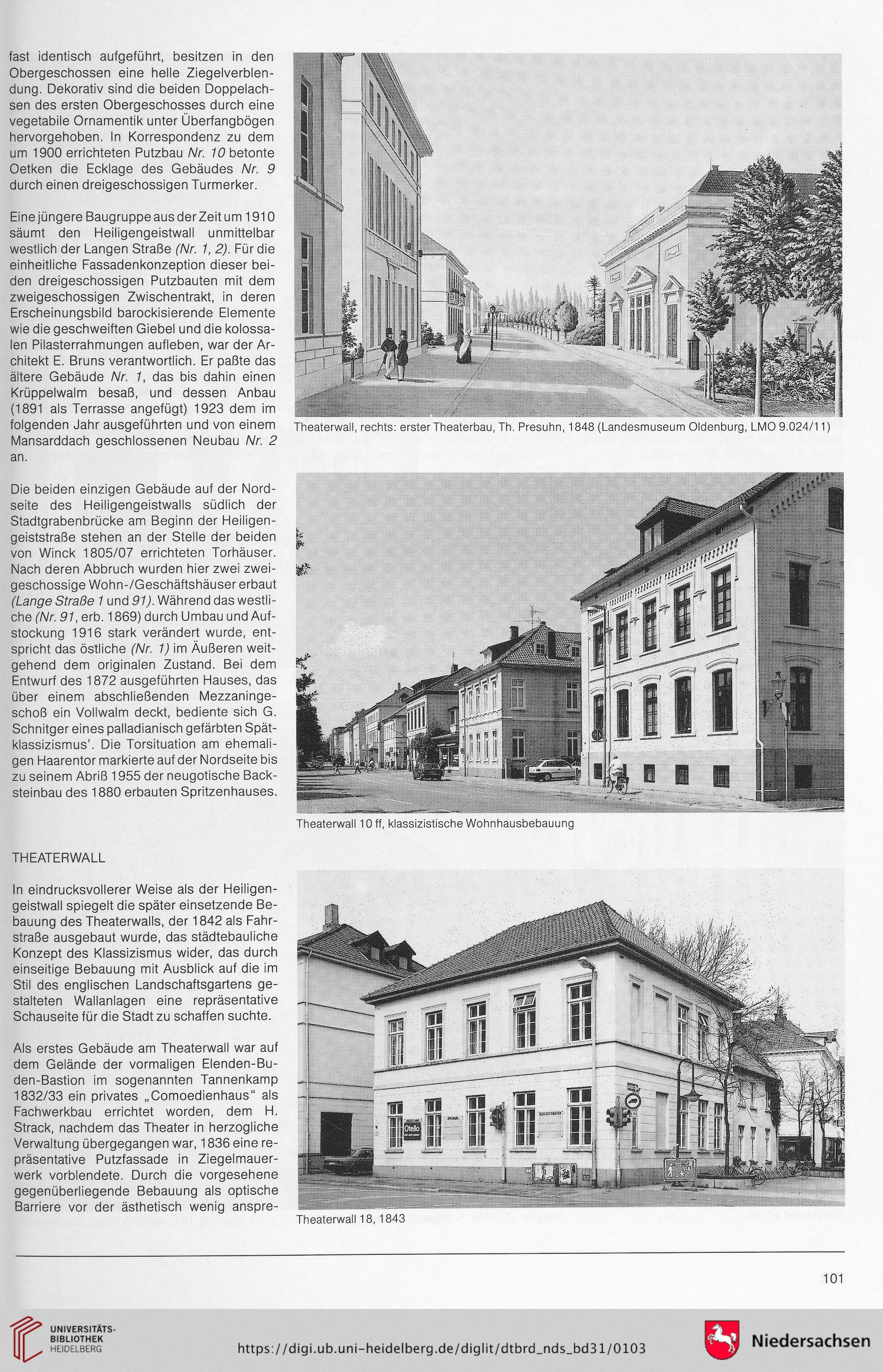fast identisch aufgeführt, besitzen in den
Obergeschossen eine helle Ziegelverblen-
dung. Dekorativ sind die beiden Doppelach-
sen des ersten Obergeschosses durch eine
vegetabile Ornamentik unter Überfangbögen
hervorgehoben. In Korrespondenz zu dem
um 1900 errichteten Putzbau Nr. 10 betonte
Oetken die Ecklage des Gebäudes Nr. 9
durch einen dreigeschossigen Turmerker.
Einejüngere BaugruppeausderZeitum 1910
säumt den Heiligengeistwall unmittelbar
westlich der Langen Straße (Nr. 1, 2). Für die
einheitliche Fassadenkonzeption dieser bei-
den dreigeschossigen Putzbauten mit dem
zweigeschossigen Zwischentrakt, in deren
Erscheinungsbild barockisierende Elemente
wie die geschweiften Giebel und die kolossa-
len Pilasterrahmungen aufleben, war der Ar-
chitekt E. Bruns verantwortlich. Er paßte das
ältere Gebäude Nr. 1, das bis dahin einen
Krüppelwalm besaß, und dessen Anbau
(1891 als Terrasse angefügt) 1923 dem im
folgenden Jahr ausgeführten und von einem
Mansarddach geschlossenen Neubau Nr. 2
an.
Die beiden einzigen Gebäude auf der Nord-
seite des Heiligengeistwalls südlich der
Stadtgrabenbrücke am Beginn der Heiligen-
geiststraße stehen an der Stelle der beiden
von Winck 1805/07 errichteten Torhäuser.
Nach deren Abbruch wurden hier zwei zwei-
geschossige Wohn-/Geschäftshäuser erbaut
(Lange Straße 1 und 91). Während das westli-
che (Nr. 91, erb. 1869) durch Umbau und Auf-
stockung 1916 stark verändert wurde, ent-
spricht das östliche (Nr. 1) im Äußeren weit-
gehend dem originalen Zustand. Bei dem
Entwurf des 1872 ausgeführten Hauses, das
über einem abschließenden Mezzaninge-
schoß ein Vollwalm deckt, bediente sich G.
Schnitger eines palladianisch gefärbten Spät-
klassizismus’. Die Torsituation am ehemali-
gen Haarentor markierte auf der Nordseite bis
zu seinem Abriß 1955 der neugotische Back-
steinbau des 1880 erbauten Spritzenhauses.
Theaterwall, rechts: erster Theaterbau, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/11)
Theaterwall 10 ff, klassizistische Wohnhausbebauung
THE ATER WALL
In eindrucksvollerer Weise als der Heiligen-
geistwall spiegelt die später einsetzende Be-
bauung des Theaterwalls, der 1842 als Fahr-
straße ausgebaut wurde, das städtebauliche
Konzept des Klassizismus wider, das durch
einseitige Bebauung mit Ausblick auf die im
Stil des englischen Landschaftsgartens ge-
stalteten Wallanlagen eine repräsentative
Schauseite für die Stadt zu schaffen suchte.
Als erstes Gebäude am Theaterwall war auf
dem Gelände der vormaligen Elenden-Bu-
den-Bastion im sogenannten Tannenkamp
1832/33 ein privates „Comoedienhaus“ als
Fachwerkbau errichtet worden, dem H.
Strack, nachdem das Theater in herzogliche
Verwaltung übergegangen war, 1836 eine re-
präsentative Putzfassade in Ziegelmauer-
werk vorblendete. Durch die vorgesehene
gegenüberliegende Bebauung als optische
Barriere vor der ästhetisch wenig anspre-
Z v ’■ i 11 •
Theaterwall 18, 1843
101
Obergeschossen eine helle Ziegelverblen-
dung. Dekorativ sind die beiden Doppelach-
sen des ersten Obergeschosses durch eine
vegetabile Ornamentik unter Überfangbögen
hervorgehoben. In Korrespondenz zu dem
um 1900 errichteten Putzbau Nr. 10 betonte
Oetken die Ecklage des Gebäudes Nr. 9
durch einen dreigeschossigen Turmerker.
Einejüngere BaugruppeausderZeitum 1910
säumt den Heiligengeistwall unmittelbar
westlich der Langen Straße (Nr. 1, 2). Für die
einheitliche Fassadenkonzeption dieser bei-
den dreigeschossigen Putzbauten mit dem
zweigeschossigen Zwischentrakt, in deren
Erscheinungsbild barockisierende Elemente
wie die geschweiften Giebel und die kolossa-
len Pilasterrahmungen aufleben, war der Ar-
chitekt E. Bruns verantwortlich. Er paßte das
ältere Gebäude Nr. 1, das bis dahin einen
Krüppelwalm besaß, und dessen Anbau
(1891 als Terrasse angefügt) 1923 dem im
folgenden Jahr ausgeführten und von einem
Mansarddach geschlossenen Neubau Nr. 2
an.
Die beiden einzigen Gebäude auf der Nord-
seite des Heiligengeistwalls südlich der
Stadtgrabenbrücke am Beginn der Heiligen-
geiststraße stehen an der Stelle der beiden
von Winck 1805/07 errichteten Torhäuser.
Nach deren Abbruch wurden hier zwei zwei-
geschossige Wohn-/Geschäftshäuser erbaut
(Lange Straße 1 und 91). Während das westli-
che (Nr. 91, erb. 1869) durch Umbau und Auf-
stockung 1916 stark verändert wurde, ent-
spricht das östliche (Nr. 1) im Äußeren weit-
gehend dem originalen Zustand. Bei dem
Entwurf des 1872 ausgeführten Hauses, das
über einem abschließenden Mezzaninge-
schoß ein Vollwalm deckt, bediente sich G.
Schnitger eines palladianisch gefärbten Spät-
klassizismus’. Die Torsituation am ehemali-
gen Haarentor markierte auf der Nordseite bis
zu seinem Abriß 1955 der neugotische Back-
steinbau des 1880 erbauten Spritzenhauses.
Theaterwall, rechts: erster Theaterbau, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/11)
Theaterwall 10 ff, klassizistische Wohnhausbebauung
THE ATER WALL
In eindrucksvollerer Weise als der Heiligen-
geistwall spiegelt die später einsetzende Be-
bauung des Theaterwalls, der 1842 als Fahr-
straße ausgebaut wurde, das städtebauliche
Konzept des Klassizismus wider, das durch
einseitige Bebauung mit Ausblick auf die im
Stil des englischen Landschaftsgartens ge-
stalteten Wallanlagen eine repräsentative
Schauseite für die Stadt zu schaffen suchte.
Als erstes Gebäude am Theaterwall war auf
dem Gelände der vormaligen Elenden-Bu-
den-Bastion im sogenannten Tannenkamp
1832/33 ein privates „Comoedienhaus“ als
Fachwerkbau errichtet worden, dem H.
Strack, nachdem das Theater in herzogliche
Verwaltung übergegangen war, 1836 eine re-
präsentative Putzfassade in Ziegelmauer-
werk vorblendete. Durch die vorgesehene
gegenüberliegende Bebauung als optische
Barriere vor der ästhetisch wenig anspre-
Z v ’■ i 11 •
Theaterwall 18, 1843
101