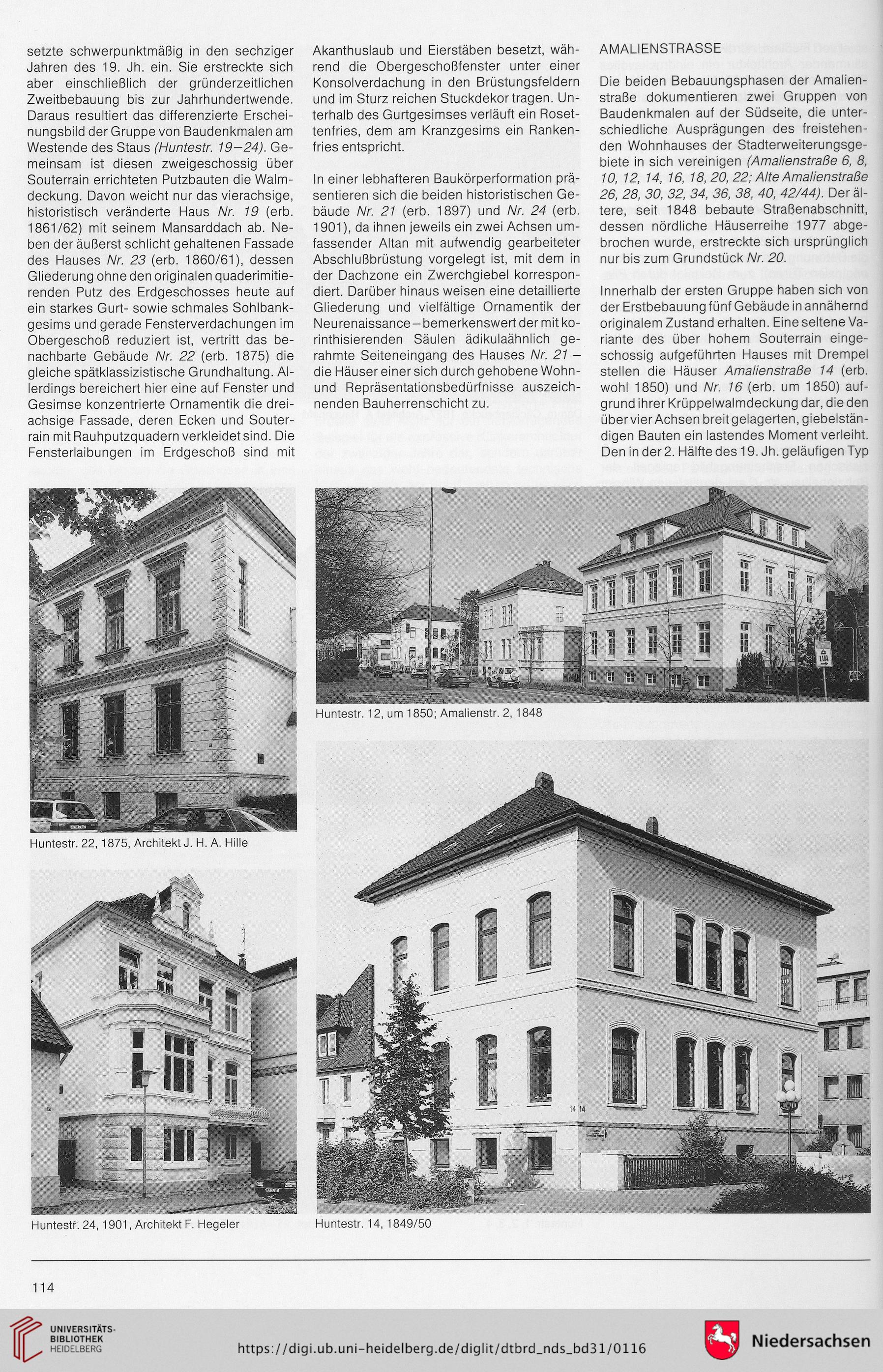setzte schwerpunktmäßig in den sechziger
Jahren des 19. Jh. ein. Sie erstreckte sich
aber einschließlich der gründerzeitlichen
Zweitbebauung bis zur Jahrhundertwende.
Daraus resultiert das differenzierte Erschei-
nungsbild der Gruppe von Baudenkmalen am
Westende des Staus (Huntestr. 19-24). Ge-
meinsam ist diesen zweigeschossig über
Souterrain errichteten Putzbauten die Walm-
deckung. Davon weicht nur das vierachsige,
historistisch veränderte Haus Nr. 19 (erb.
1861/62) mit seinem Mansarddach ab. Ne-
ben der äußerst schlicht gehaltenen Fassade
des Hauses Nr. 23 (erb. 1860/61), dessen
Gliederung ohne den originalen quaderimitie-
renden Putz des Erdgeschosses heute auf
ein starkes Gurt- sowie schmales Sohlbank-
gesims und gerade Fensterverdachungen im
Obergeschoß reduziert ist, vertritt das be-
nachbarte Gebäude Nr. 22 (erb. 1875) die
gleiche spätklassizistische Grundhaltung. Al-
lerdings bereichert hier eine auf Fenster und
Gesimse konzentrierte Ornamentik die drei-
achsige Fassade, deren Ecken und Souter-
rain mit Rauhputzquadern verkleidet sind. Die
Fensterlaibungen im Erdgeschoß sind mit
Huntestr. 22,1875, Architekt J. H. A. Hille
Huntestr: 24,1901, Architekt F. Hegeier
Akanthuslaub und Eierstäben besetzt, wäh-
rend die Obergeschoßfenster unter einer
Konsolverdachung in den Brüstungsfeldern
und im Sturz reichen Stuckdekortragen. Un-
terhalb des Gurtgesimses verläuft ein Roset-
tenfries, dem am Kranzgesims ein Ranken-
fries entspricht.
In einer lebhafteren Baukörperformation prä-
sentieren sich die beiden historistischen Ge-
bäude Nr. 21 (erb. 1897) und Nr. 24 (erb.
1901), da ihnen jeweils ein zwei Achsen um-
fassender Altan mit aufwendig gearbeiteter
Abschlußbrüstung vorgelegt ist, mit dem in
der Dachzone ein Zwerchgiebel korrespon-
diert. Darüber hinaus weisen eine detaillierte
Gliederung und vielfältige Ornamentik der
Neurenaissance-bemerkenswert der mit ko-
rinthisierenden Säulen ädikulaähnlich ge-
rahmte Seiteneingang des Hauses Nr. 21 -
die Häuser einer sich durch gehobene Wohn-
und Repräsentationsbedürfnisse auszeich-
nenden Bauherrenschicht zu.
AMALIENSTRASSE
Die beiden Bebauungsphasen der Amalien-
straße dokumentieren zwei Gruppen von
Baudenkmalen auf der Südseite, die unter-
schiedliche Ausprägungen des freistehen-
den Wohnhauses der Stadterweiterungsge-
biete in sich vereinigen (Amalienstraße 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Alte Amalienstraße
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44). Der äl-
tere, seit 1848 bebaute Straßenabschnitt,
dessen nördliche Häuserreihe 1977 abge-
brochen wurde, erstreckte sich ursprünglich
nur bis zum Grundstück Nr. 20.
Innerhalb der ersten Gruppe haben sich von
der Erstbebauung fünf Gebäude in annähernd
originalem Zustand erhalten. Eine seltene Va-
riante des über hohem Souterrain einge-
schossig aufgeführten Hauses mit Drempel
stellen die Häuser Amalienstraße 14 (erb.
wohl 1850) und Nr. 16 (erb. um 1850) auf-
grund ihrer Krüppelwalmdeckung dar, die den
übervier Achsen breit gelagerten, giebelstän-
digen Bauten ein lastendes Moment verleiht.
Den in der 2. Hälfte des 19. Jh. geläufigen Typ
Huntestr. 12, um 1850; Amalienstr. 2,1848
Huntestr. 14, 1849/50
114
Jahren des 19. Jh. ein. Sie erstreckte sich
aber einschließlich der gründerzeitlichen
Zweitbebauung bis zur Jahrhundertwende.
Daraus resultiert das differenzierte Erschei-
nungsbild der Gruppe von Baudenkmalen am
Westende des Staus (Huntestr. 19-24). Ge-
meinsam ist diesen zweigeschossig über
Souterrain errichteten Putzbauten die Walm-
deckung. Davon weicht nur das vierachsige,
historistisch veränderte Haus Nr. 19 (erb.
1861/62) mit seinem Mansarddach ab. Ne-
ben der äußerst schlicht gehaltenen Fassade
des Hauses Nr. 23 (erb. 1860/61), dessen
Gliederung ohne den originalen quaderimitie-
renden Putz des Erdgeschosses heute auf
ein starkes Gurt- sowie schmales Sohlbank-
gesims und gerade Fensterverdachungen im
Obergeschoß reduziert ist, vertritt das be-
nachbarte Gebäude Nr. 22 (erb. 1875) die
gleiche spätklassizistische Grundhaltung. Al-
lerdings bereichert hier eine auf Fenster und
Gesimse konzentrierte Ornamentik die drei-
achsige Fassade, deren Ecken und Souter-
rain mit Rauhputzquadern verkleidet sind. Die
Fensterlaibungen im Erdgeschoß sind mit
Huntestr. 22,1875, Architekt J. H. A. Hille
Huntestr: 24,1901, Architekt F. Hegeier
Akanthuslaub und Eierstäben besetzt, wäh-
rend die Obergeschoßfenster unter einer
Konsolverdachung in den Brüstungsfeldern
und im Sturz reichen Stuckdekortragen. Un-
terhalb des Gurtgesimses verläuft ein Roset-
tenfries, dem am Kranzgesims ein Ranken-
fries entspricht.
In einer lebhafteren Baukörperformation prä-
sentieren sich die beiden historistischen Ge-
bäude Nr. 21 (erb. 1897) und Nr. 24 (erb.
1901), da ihnen jeweils ein zwei Achsen um-
fassender Altan mit aufwendig gearbeiteter
Abschlußbrüstung vorgelegt ist, mit dem in
der Dachzone ein Zwerchgiebel korrespon-
diert. Darüber hinaus weisen eine detaillierte
Gliederung und vielfältige Ornamentik der
Neurenaissance-bemerkenswert der mit ko-
rinthisierenden Säulen ädikulaähnlich ge-
rahmte Seiteneingang des Hauses Nr. 21 -
die Häuser einer sich durch gehobene Wohn-
und Repräsentationsbedürfnisse auszeich-
nenden Bauherrenschicht zu.
AMALIENSTRASSE
Die beiden Bebauungsphasen der Amalien-
straße dokumentieren zwei Gruppen von
Baudenkmalen auf der Südseite, die unter-
schiedliche Ausprägungen des freistehen-
den Wohnhauses der Stadterweiterungsge-
biete in sich vereinigen (Amalienstraße 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Alte Amalienstraße
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44). Der äl-
tere, seit 1848 bebaute Straßenabschnitt,
dessen nördliche Häuserreihe 1977 abge-
brochen wurde, erstreckte sich ursprünglich
nur bis zum Grundstück Nr. 20.
Innerhalb der ersten Gruppe haben sich von
der Erstbebauung fünf Gebäude in annähernd
originalem Zustand erhalten. Eine seltene Va-
riante des über hohem Souterrain einge-
schossig aufgeführten Hauses mit Drempel
stellen die Häuser Amalienstraße 14 (erb.
wohl 1850) und Nr. 16 (erb. um 1850) auf-
grund ihrer Krüppelwalmdeckung dar, die den
übervier Achsen breit gelagerten, giebelstän-
digen Bauten ein lastendes Moment verleiht.
Den in der 2. Hälfte des 19. Jh. geläufigen Typ
Huntestr. 12, um 1850; Amalienstr. 2,1848
Huntestr. 14, 1849/50
114