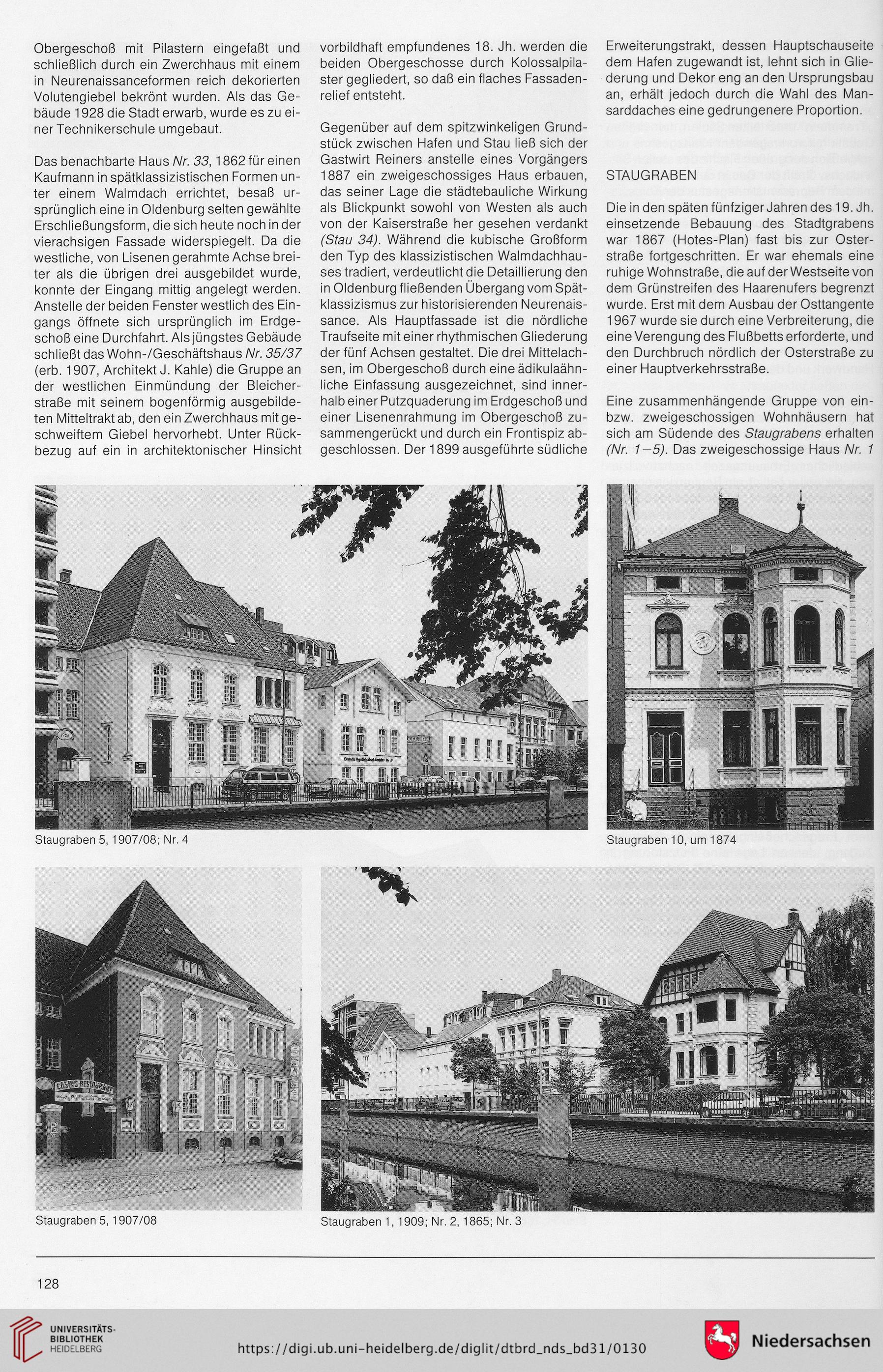Obergeschoß mit Pilastern eingefaßt und
schließlich durch ein Zwerchhaus mit einem
in Neurenaissanceformen reich dekorierten
Volutengiebel bekrönt wurden. Als das Ge-
bäude 1928 die Stadt erwarb, wurde es zu ei-
ner Technikerschule umgebaut.
Das benachbarte Haus Nr. 33,1862 für einen
Kaufmann in spätklassizistischen Formen un-
ter einem Walmdach errichtet, besaß ur-
sprünglich eine in Oldenburg selten gewählte
Erschließungsform, die sich heute noch in der
vierachsigen Fassade widerspiegelt. Da die
westliche, von Lisenen gerahmte Achse brei-
ter als die übrigen drei ausgebildet wurde,
konnte der Eingang mittig angelegt werden.
Anstelle der beiden Fenster westlich des Ein-
gangs öffnete sich ursprünglich im Erdge-
schoß eine Durchfahrt. Ais jüngstes Gebäude
schließt das Wohn-/Geschäftshaus Nr. 35/37
(erb. 1907, Architekt J. Kahle) die Gruppe an
der westlichen Einmündung der Bleicher-
straße mit seinem bogenförmig ausgebilde-
ten Mitteltrakt ab, den ein Zwerchhaus mit ge-
schweiftem Giebel hervorhebt. Unter Rück-
bezug auf ein in architektonischer Hinsicht
vorbildhaft empfundenes 18. Jh. werden die
beiden Obergeschosse durch Kolossalpila-
ster gegliedert, so daß ein flaches Fassaden-
relief entsteht.
Gegenüber auf dem spitzwinkeligen Grund-
stück zwischen Hafen und Stau ließ sich der
Gastwirt Reiners anstelle eines Vorgängers
1887 ein zweigeschossiges Haus erbauen,
das seiner Lage die städtebauliche Wirkung
als Blickpunkt sowohl von Westen als auch
von der Kaiserstraße her gesehen verdankt
(Stau 34). Während die kubische Großform
den Typ des klassizistischen Walmdachhau-
ses tradiert, verdeutlicht die Detaillierung den
in Oldenburg fließenden Übergang vom Spät-
klassizismus zur historisierenden Neurenais-
sance. Als Hauptfassade ist die nördliche
Traufseite mit einer rhythmischen Gliederung
der fünf Achsen gestaltet. Die drei Mittelach-
sen, im Obergeschoß durch eine ädikulaähn-
liche Einfassung ausgezeichnet, sind inner-
halb einer Putzquaderung im Erdgeschoß und
einer Lisenenrahmung im Obergeschoß zu-
sammengerückt und durch ein Frontispiz ab-
geschlossen. Der 1899 ausgeführte südliche
Erweiterungstrakt, dessen Hauptschauseite
dem Hafen zugewandt ist, lehnt sich in Glie-
derung und Dekor eng an den Ursprungsbau
an, erhält jedoch durch die Wahl des Man-
sarddaches eine gedrungenere Proportion.
STAUGRABEN
Die in den späten fünfziger Jahren des 19. Jh.
einsetzende Bebauung des Stadtgrabens
war 1867 (Hotes-Plan) fast bis zur Oster-
straße fortgeschritten. Er war ehemals eine
ruhige Wohnstraße, die auf der Westseite von
dem Grünstreifen des Haarenufers begrenzt
wurde. Erst mit dem Ausbau der Osttangente
1967 wurde sie durch eine Verbreiterung, die
eine Verengung des Flußbetts erforderte, und
den Durchbruch nördlich der Osterstraße zu
einer Hauptverkehrsstraße.
Eine zusammenhängende Gruppe von ein-
bzw. zweigeschossigen Wohnhäusern hat
sich am Südende des Staugrabens erhalten
(Nr. 1—5). Das zweigeschossige Haus Nr. 1
Staugraben 5,1907/08; Nr. 4
Staugraben 10, um 1874
Staugraben 5,1907/08
Staugraben 1,1909; Nr. 2,1865; Nr. 3
128
schließlich durch ein Zwerchhaus mit einem
in Neurenaissanceformen reich dekorierten
Volutengiebel bekrönt wurden. Als das Ge-
bäude 1928 die Stadt erwarb, wurde es zu ei-
ner Technikerschule umgebaut.
Das benachbarte Haus Nr. 33,1862 für einen
Kaufmann in spätklassizistischen Formen un-
ter einem Walmdach errichtet, besaß ur-
sprünglich eine in Oldenburg selten gewählte
Erschließungsform, die sich heute noch in der
vierachsigen Fassade widerspiegelt. Da die
westliche, von Lisenen gerahmte Achse brei-
ter als die übrigen drei ausgebildet wurde,
konnte der Eingang mittig angelegt werden.
Anstelle der beiden Fenster westlich des Ein-
gangs öffnete sich ursprünglich im Erdge-
schoß eine Durchfahrt. Ais jüngstes Gebäude
schließt das Wohn-/Geschäftshaus Nr. 35/37
(erb. 1907, Architekt J. Kahle) die Gruppe an
der westlichen Einmündung der Bleicher-
straße mit seinem bogenförmig ausgebilde-
ten Mitteltrakt ab, den ein Zwerchhaus mit ge-
schweiftem Giebel hervorhebt. Unter Rück-
bezug auf ein in architektonischer Hinsicht
vorbildhaft empfundenes 18. Jh. werden die
beiden Obergeschosse durch Kolossalpila-
ster gegliedert, so daß ein flaches Fassaden-
relief entsteht.
Gegenüber auf dem spitzwinkeligen Grund-
stück zwischen Hafen und Stau ließ sich der
Gastwirt Reiners anstelle eines Vorgängers
1887 ein zweigeschossiges Haus erbauen,
das seiner Lage die städtebauliche Wirkung
als Blickpunkt sowohl von Westen als auch
von der Kaiserstraße her gesehen verdankt
(Stau 34). Während die kubische Großform
den Typ des klassizistischen Walmdachhau-
ses tradiert, verdeutlicht die Detaillierung den
in Oldenburg fließenden Übergang vom Spät-
klassizismus zur historisierenden Neurenais-
sance. Als Hauptfassade ist die nördliche
Traufseite mit einer rhythmischen Gliederung
der fünf Achsen gestaltet. Die drei Mittelach-
sen, im Obergeschoß durch eine ädikulaähn-
liche Einfassung ausgezeichnet, sind inner-
halb einer Putzquaderung im Erdgeschoß und
einer Lisenenrahmung im Obergeschoß zu-
sammengerückt und durch ein Frontispiz ab-
geschlossen. Der 1899 ausgeführte südliche
Erweiterungstrakt, dessen Hauptschauseite
dem Hafen zugewandt ist, lehnt sich in Glie-
derung und Dekor eng an den Ursprungsbau
an, erhält jedoch durch die Wahl des Man-
sarddaches eine gedrungenere Proportion.
STAUGRABEN
Die in den späten fünfziger Jahren des 19. Jh.
einsetzende Bebauung des Stadtgrabens
war 1867 (Hotes-Plan) fast bis zur Oster-
straße fortgeschritten. Er war ehemals eine
ruhige Wohnstraße, die auf der Westseite von
dem Grünstreifen des Haarenufers begrenzt
wurde. Erst mit dem Ausbau der Osttangente
1967 wurde sie durch eine Verbreiterung, die
eine Verengung des Flußbetts erforderte, und
den Durchbruch nördlich der Osterstraße zu
einer Hauptverkehrsstraße.
Eine zusammenhängende Gruppe von ein-
bzw. zweigeschossigen Wohnhäusern hat
sich am Südende des Staugrabens erhalten
(Nr. 1—5). Das zweigeschossige Haus Nr. 1
Staugraben 5,1907/08; Nr. 4
Staugraben 10, um 1874
Staugraben 5,1907/08
Staugraben 1,1909; Nr. 2,1865; Nr. 3
128