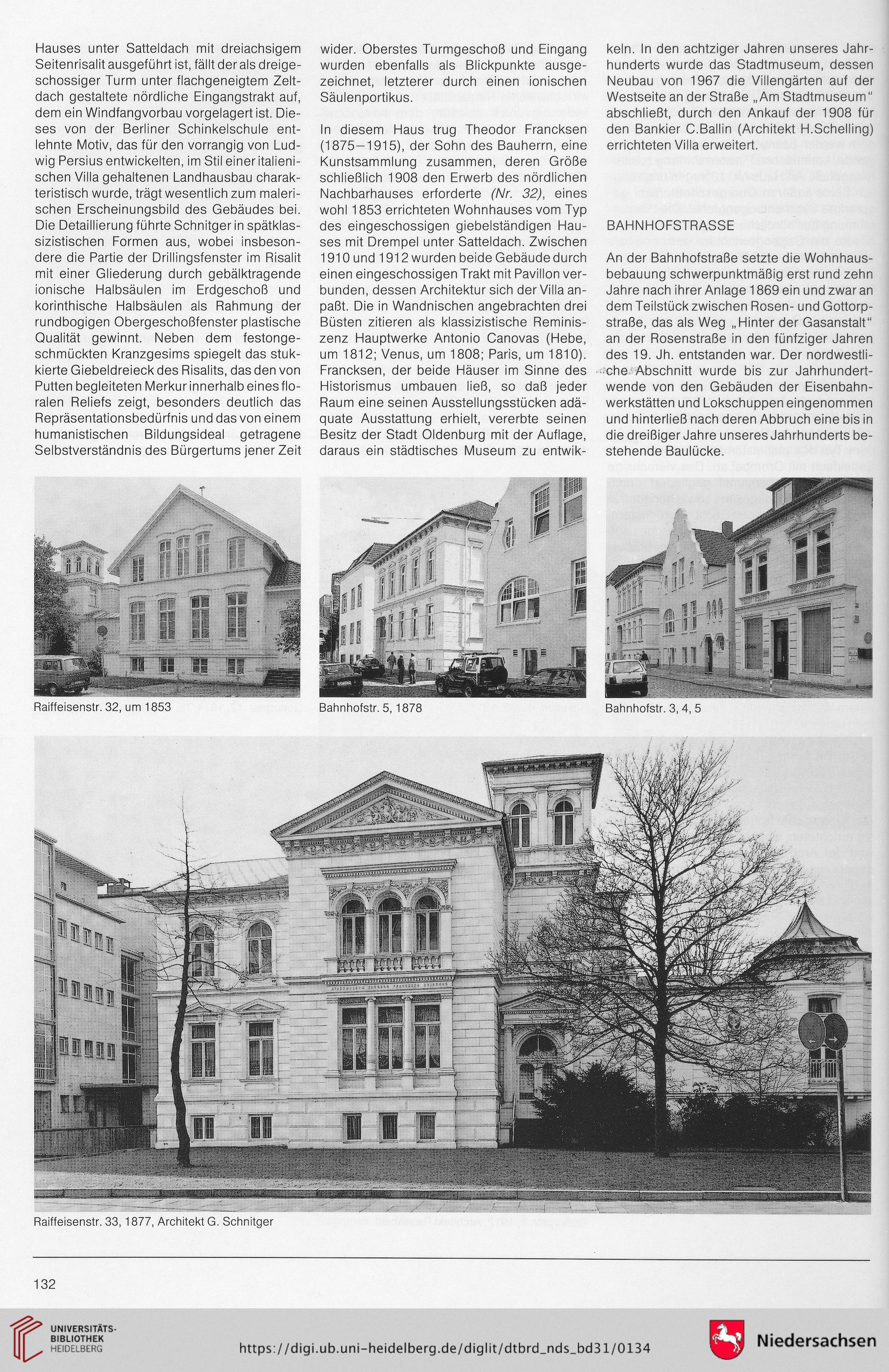Hauses unter Satteldach mit dreiachsigem
Seitenrisalit ausgeführt ist, fällt der als dreige-
schossiger Turm unter flachgeneigtem Zelt-
dach gestaltete nördliche Eingangstrakt auf,
dem ein Windfangvorbau vorgelagert ist. Die-
ses von der Berliner Schinkelschule ent-
lehnte Motiv, das für den vorrangig von Lud-
wig Persius entwickelten, im Stil einer italieni-
schen Villa gehaltenen Landhausbau charak-
teristisch wurde, trägt wesentlich zum maleri-
schen Erscheinungsbild des Gebäudes bei.
Die Detaillierung führte Schnitger in spätklas-
sizistischen Formen aus, wobei insbeson-
dere die Partie der Drillingsfenster im Risalit
mit einer Gliederung durch gebälktragende
ionische Halbsäulen im Erdgeschoß und
korinthische Halbsäulen als Rahmung der
rundbogigen Obergeschoßfenster plastische
Qualität gewinnt. Neben dem festonge-
schmückten Kranzgesims spiegelt das stuk-
kierte Giebeldreieck des Risalits, das den von
Putten begleiteten Merkurinnerhaibeines flo-
ralen Reliefs zeigt, besonders deutlich das
Repräsentationsbedürfnis und das von einem
humanistischen Bildungsideal getragene
Selbstverständnis des Bürgertums jener Zeit
wider. Oberstes Turmgeschoß und Eingang
wurden ebenfalls als Blickpunkte ausge-
zeichnet, letzterer durch einen ionischen
Säulenportikus.
In diesem Haus trug Theodor Francksen
(1875-1915), der Sohn des Bauherrn, eine
Kunstsammlung zusammen, deren Größe
schließlich 1908 den Erwerb des nördlichen
Nachbarhauses erforderte (Nr. 32), eines
wohl 1853 errichteten Wohnhauses vom Typ
des eingeschossigen giebelständigen Hau-
ses mit Drempel unter Satteldach. Zwischen
1910und 1912wurden beideGebäudedurch
einen eingeschossigen Trakt mit Pavillon ver-
bunden, dessen Architektur sich der Villa an-
paßt. Die in Wandnischen angebrachten drei
Büsten zitieren als klassizistische Reminis-
zenz Hauptwerke Antonio Canovas (Hebe,
um 1812; Venus, um 1808; Paris, um 1810).
Francksen, der beide Häuser im Sinne des
Historismus umbauen ließ, so daß jeder
Raum eine seinen Ausstellungsstücken adä-
quate Ausstattung erhielt, vererbte seinen
Besitz der Stadt Oldenburg mit der Auflage,
daraus ein städtisches Museum zu entwik-
keln. In den achtziger Jahren unseres Jahr-
hunderts wurde das Stadtmuseum, dessen
Neubau von 1967 die Villengärten auf der
Westseite an der Straße „Am Stadtmuseum“
abschließt, durch den Ankauf der 1908 für
den Bankier C.Ballin (Architekt H.Schelling)
errichteten Villa erweitert.
BAHNHOFSTRASSE
An der Bahnhofstraße setzte die Wohnhaus-
bebauung schwerpunktmäßig erst rund zehn
Jahre nach ihrer Anlage 1869 ein und zwar an
dem Teilstück zwischen Rosen- und Gottorp-
straße, das als Weg „Hinter der Gasanstalt“
an der Rosenstraße in den fünfziger Jahren
des 19. Jh. entstanden war. Der nordwestli-
■ che Abschnitt wurde bis zur Jahrhundert-
wende von den Gebäuden der Eisenbahn-
werkstätten und Lokschuppen eingenommen
und hinterließ nach deren Abbruch eine bis in
die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts be-
stehende Baulücke.
Raiffeisenstr. 32, um 1853
Bahnhofstr. 5, 1878
Bahnhofstr. 3, 4, 5
Raiffeisenstr. 33,1877, Architekt G. Schnitger
132
Seitenrisalit ausgeführt ist, fällt der als dreige-
schossiger Turm unter flachgeneigtem Zelt-
dach gestaltete nördliche Eingangstrakt auf,
dem ein Windfangvorbau vorgelagert ist. Die-
ses von der Berliner Schinkelschule ent-
lehnte Motiv, das für den vorrangig von Lud-
wig Persius entwickelten, im Stil einer italieni-
schen Villa gehaltenen Landhausbau charak-
teristisch wurde, trägt wesentlich zum maleri-
schen Erscheinungsbild des Gebäudes bei.
Die Detaillierung führte Schnitger in spätklas-
sizistischen Formen aus, wobei insbeson-
dere die Partie der Drillingsfenster im Risalit
mit einer Gliederung durch gebälktragende
ionische Halbsäulen im Erdgeschoß und
korinthische Halbsäulen als Rahmung der
rundbogigen Obergeschoßfenster plastische
Qualität gewinnt. Neben dem festonge-
schmückten Kranzgesims spiegelt das stuk-
kierte Giebeldreieck des Risalits, das den von
Putten begleiteten Merkurinnerhaibeines flo-
ralen Reliefs zeigt, besonders deutlich das
Repräsentationsbedürfnis und das von einem
humanistischen Bildungsideal getragene
Selbstverständnis des Bürgertums jener Zeit
wider. Oberstes Turmgeschoß und Eingang
wurden ebenfalls als Blickpunkte ausge-
zeichnet, letzterer durch einen ionischen
Säulenportikus.
In diesem Haus trug Theodor Francksen
(1875-1915), der Sohn des Bauherrn, eine
Kunstsammlung zusammen, deren Größe
schließlich 1908 den Erwerb des nördlichen
Nachbarhauses erforderte (Nr. 32), eines
wohl 1853 errichteten Wohnhauses vom Typ
des eingeschossigen giebelständigen Hau-
ses mit Drempel unter Satteldach. Zwischen
1910und 1912wurden beideGebäudedurch
einen eingeschossigen Trakt mit Pavillon ver-
bunden, dessen Architektur sich der Villa an-
paßt. Die in Wandnischen angebrachten drei
Büsten zitieren als klassizistische Reminis-
zenz Hauptwerke Antonio Canovas (Hebe,
um 1812; Venus, um 1808; Paris, um 1810).
Francksen, der beide Häuser im Sinne des
Historismus umbauen ließ, so daß jeder
Raum eine seinen Ausstellungsstücken adä-
quate Ausstattung erhielt, vererbte seinen
Besitz der Stadt Oldenburg mit der Auflage,
daraus ein städtisches Museum zu entwik-
keln. In den achtziger Jahren unseres Jahr-
hunderts wurde das Stadtmuseum, dessen
Neubau von 1967 die Villengärten auf der
Westseite an der Straße „Am Stadtmuseum“
abschließt, durch den Ankauf der 1908 für
den Bankier C.Ballin (Architekt H.Schelling)
errichteten Villa erweitert.
BAHNHOFSTRASSE
An der Bahnhofstraße setzte die Wohnhaus-
bebauung schwerpunktmäßig erst rund zehn
Jahre nach ihrer Anlage 1869 ein und zwar an
dem Teilstück zwischen Rosen- und Gottorp-
straße, das als Weg „Hinter der Gasanstalt“
an der Rosenstraße in den fünfziger Jahren
des 19. Jh. entstanden war. Der nordwestli-
■ che Abschnitt wurde bis zur Jahrhundert-
wende von den Gebäuden der Eisenbahn-
werkstätten und Lokschuppen eingenommen
und hinterließ nach deren Abbruch eine bis in
die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts be-
stehende Baulücke.
Raiffeisenstr. 32, um 1853
Bahnhofstr. 5, 1878
Bahnhofstr. 3, 4, 5
Raiffeisenstr. 33,1877, Architekt G. Schnitger
132