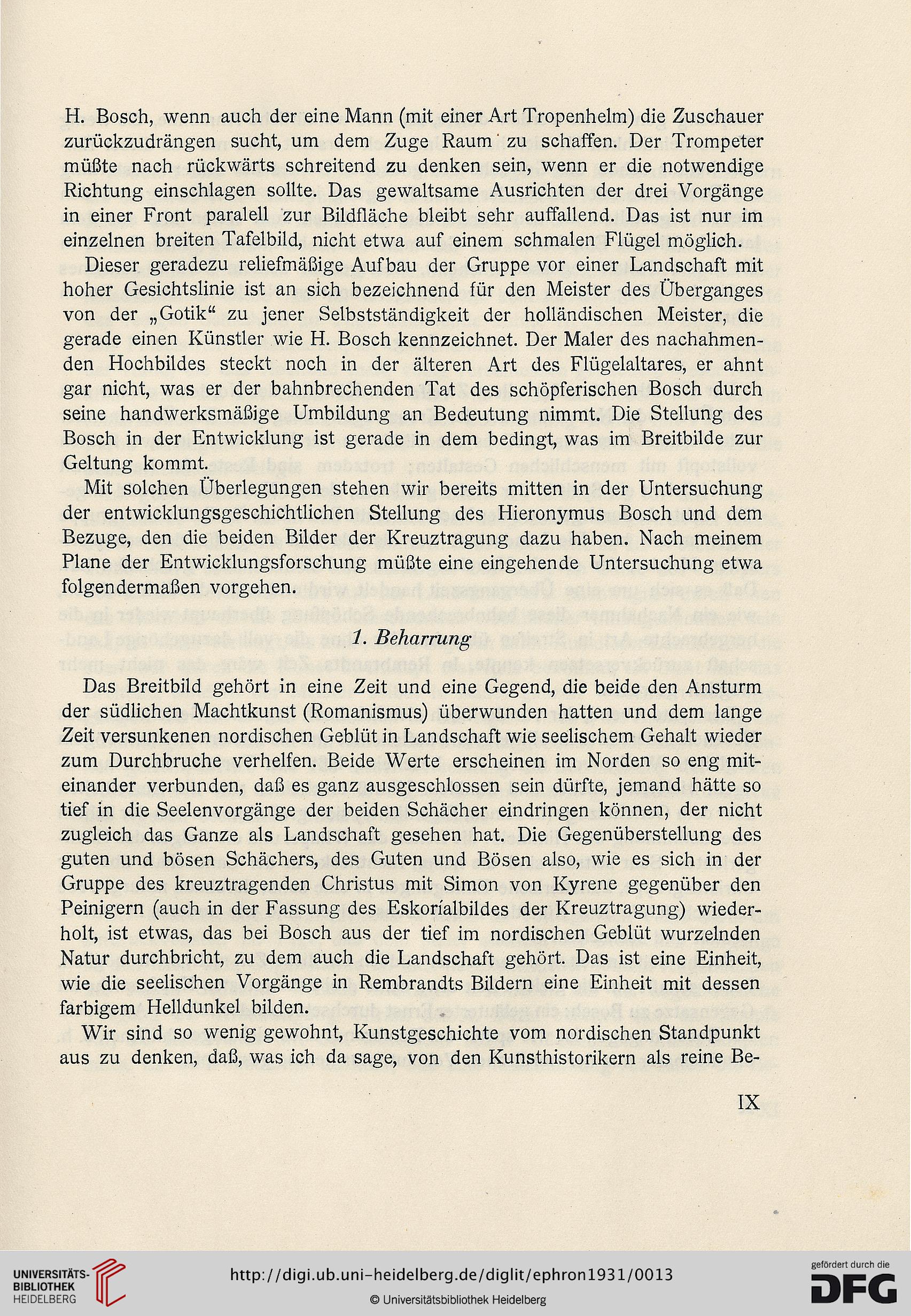H. Bosch, wenn auch der eine Mann (mit einer Art Tropenhelm) die Zuschauer
zurückzudrängen sucht, um dem Zuge Raum zu schaffen. Der Trompeter
müßte nach rückwärts schreitend zu denken sein, wenn er die notwendige
Richtung einschlagen sollte. Das gewaltsame Ausrichten der drei Vorgänge
in einer Front paralell zur Bildfläche bleibt sehr auffallend. Das ist nur im
einzelnen breiten Tafelbild, nicht etwa auf einem schmalen Flügel möglich.
Dieser geradezu reliefmäßige Aufbau der Gruppe vor einer Landschaft mit
hoher Gesichtslinie ist an sich bezeichnend für den Meister des Überganges
von der „Gotik“ zu jener Selbstständigkeit der holländischen Meister, die
gerade einen Künstler wie H. Bosch kennzeichnet. Der Maler des nachahmen-
den Hochbildes steckt noch in der älteren Art des Flügelaltares, er ahnt
gar nicht, was er der bahnbrechenden Tat des schöpferischen Bosch durch
seine handwerksmäßjge Umbildung an Bedeutung nimmt. Die Stellung des
Bosch in der Entwicklung ist gerade in dem bedingt, was im Breitbilde zur
Geltung kommt.
Mit solchen Überlegungen stehen wir bereits mitten in der Untersuchung
der entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Hieronymus Bosch und dem
Bezuge, den die beiden Bilder der Kreuztragung dazu haben. Nach meinem
Plane der Entwicklungsforschung müßte eine eingehende Untersuchung etwa
folgendermaßen vorgehen.
1. Beharrung
Das Breitbild gehört in eine Zeit und eine Gegend, die beide den Ansturm
der südlichen Machtkunst (Romanismus) überwunden hatten und dem lange
Zeit versunkenen nordischen Geblüt in Landschaft wie seelischem Gehalt wieder
zum Durchbruche verhelfen. Beide Werte erscheinen im Norden so eng mit-
einander verbunden, daß es ganz ausgeschlossen sein dürfte, jemand hätte so
tief in die Seelenvorgänge der beiden Schächer eindringen können, der nicht
zugleich das Ganze als Landschaft gesehen hat. Die Gegenüberstellung des
guten und bösen Schächers, des Guten und Bösen also, wie es sich in der
Gruppe des kreuztragenden Christus mit Simon von Kyrene gegenüber den
Peinigern (auch in der Fassung des Eskorialbildes der Kreuztragung) wieder-
holt, ist etwas, das bei Bosch aus der tief im nordischen Geblüt wurzelnden
Natur durchbricht, zu dem auch die Landschaft gehört. Das ist eine Einheit,
wie die seelischen Vorgänge in Rembrandts Bildern eine Einheit mit dessen
farbigem Helldunkel bilden.
Wir sind so wenig gewohnt, Kunstgeschichte vom nordischen Standpunkt
aus zu denken, daß, was ich da sage, von den Kunsthistorikern als reine Be-
IX
zurückzudrängen sucht, um dem Zuge Raum zu schaffen. Der Trompeter
müßte nach rückwärts schreitend zu denken sein, wenn er die notwendige
Richtung einschlagen sollte. Das gewaltsame Ausrichten der drei Vorgänge
in einer Front paralell zur Bildfläche bleibt sehr auffallend. Das ist nur im
einzelnen breiten Tafelbild, nicht etwa auf einem schmalen Flügel möglich.
Dieser geradezu reliefmäßige Aufbau der Gruppe vor einer Landschaft mit
hoher Gesichtslinie ist an sich bezeichnend für den Meister des Überganges
von der „Gotik“ zu jener Selbstständigkeit der holländischen Meister, die
gerade einen Künstler wie H. Bosch kennzeichnet. Der Maler des nachahmen-
den Hochbildes steckt noch in der älteren Art des Flügelaltares, er ahnt
gar nicht, was er der bahnbrechenden Tat des schöpferischen Bosch durch
seine handwerksmäßjge Umbildung an Bedeutung nimmt. Die Stellung des
Bosch in der Entwicklung ist gerade in dem bedingt, was im Breitbilde zur
Geltung kommt.
Mit solchen Überlegungen stehen wir bereits mitten in der Untersuchung
der entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Hieronymus Bosch und dem
Bezuge, den die beiden Bilder der Kreuztragung dazu haben. Nach meinem
Plane der Entwicklungsforschung müßte eine eingehende Untersuchung etwa
folgendermaßen vorgehen.
1. Beharrung
Das Breitbild gehört in eine Zeit und eine Gegend, die beide den Ansturm
der südlichen Machtkunst (Romanismus) überwunden hatten und dem lange
Zeit versunkenen nordischen Geblüt in Landschaft wie seelischem Gehalt wieder
zum Durchbruche verhelfen. Beide Werte erscheinen im Norden so eng mit-
einander verbunden, daß es ganz ausgeschlossen sein dürfte, jemand hätte so
tief in die Seelenvorgänge der beiden Schächer eindringen können, der nicht
zugleich das Ganze als Landschaft gesehen hat. Die Gegenüberstellung des
guten und bösen Schächers, des Guten und Bösen also, wie es sich in der
Gruppe des kreuztragenden Christus mit Simon von Kyrene gegenüber den
Peinigern (auch in der Fassung des Eskorialbildes der Kreuztragung) wieder-
holt, ist etwas, das bei Bosch aus der tief im nordischen Geblüt wurzelnden
Natur durchbricht, zu dem auch die Landschaft gehört. Das ist eine Einheit,
wie die seelischen Vorgänge in Rembrandts Bildern eine Einheit mit dessen
farbigem Helldunkel bilden.
Wir sind so wenig gewohnt, Kunstgeschichte vom nordischen Standpunkt
aus zu denken, daß, was ich da sage, von den Kunsthistorikern als reine Be-
IX