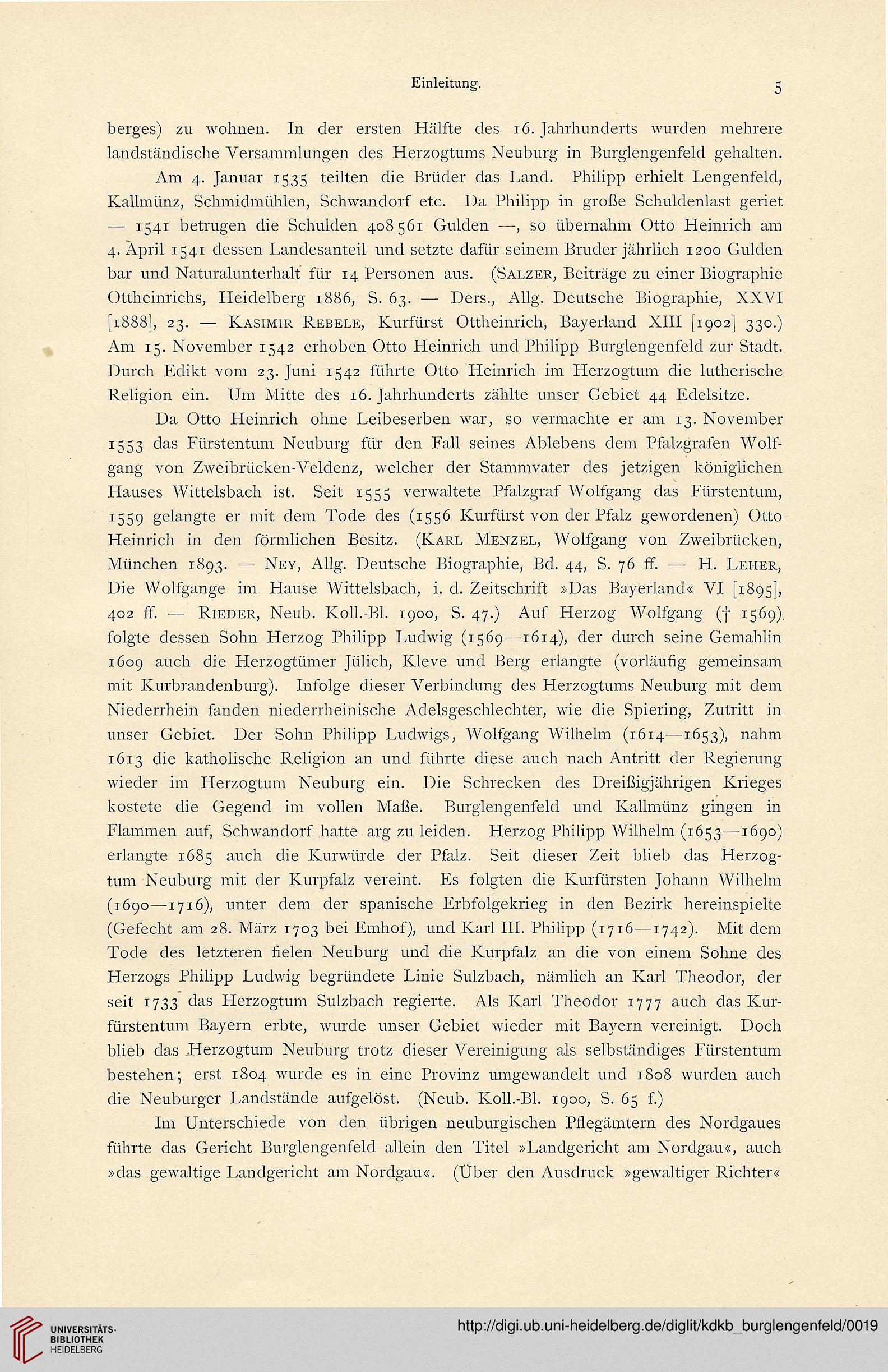Einleitung.
s
beiges) zu wohnen. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden mehrere
landständische Versammlungen des Herzogtums Neuburg in Burglengenfeld gehalten.
Am 4. Januar 1535 teilten die Brüder das Land. Philipp erhielt Lengenfeld,
Kallmünz, Schmidmühlen, Schwandorf etc. Da Philipp in große Schuldenlast geriet
— 1341 betrugen die Schulden 408361 Gulden —, so übernahm Otto Heinrich am
4. April 1541 dessen Landesanteil und setzte dafür seinem Bruder jährlich 1200 Gulden
bar und Naturalunterhalt für 14 Personen aus. (SALZER, Beiträge zu einer Biographie
Ottheinrichs, Heidelberg 1886, S. 63. — Ders., Allg. Deutsche Biographie, XXVI
[1888], 23. — KASIMIR REBELE, Kurfürst Ottheinrich, Bayerland XIII [1902] 330.)
Am 13. November 1342 erhoben Otto Heinrich und Philipp Burglengenfeld zur Stadt.
Durch Edikt vom 23. Juni 1542 führte Otto Heinrich im Herzogtum die lutherische
Religion ein. Um Mitte des 16. Jahrhunderts zählte unser Gebiet 44 Edelsitze.
Da Otto Heinrich ohne Leibeserben war, so vermachte er am 13. November
1333 das Fürstentum Neuburg für den Fall seines Ablebens dem Pfalzgrafen Wolf-
gang von Zweibrücken-Veldenz, welcher der Stammvater des jetzigen königlichen
Hauses Wittelsbach ist. Seit 1333 verwaltete Pfalzgraf Wolfgang das Fürstentum,
1559 gelangte er mit dem Tode des (1556 Kurfürst von der Pfalz gewordenen) Otto
Heinrich in den förmlichen Besitz. (KARL MENZEL, Wolfgang von Zweibrücken,
München 1893. — NEY, Allg. Deutsche Biographie, Bd. 44, S. 76 ff. — H. LEHER,
Die Wolfgange im Hause Wittelsbach, i. d. Zeitschrift »Das Bayerland« VI [1893],
402 ff. — RtEDER, Neub. Koll.-Bl. 1900, S. 47.) Auf Herzog Wolfgang (p 1569).
folgte dessen Sohn Herzog Philipp Ludwig (1369—1614), der durch seine Gemahlin
1609 auch die Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg erlangte (vorläufig gemeinsam
mit Kurbrandenburg). Infolge dieser Verbindung des Herzogtums Neuburg mit dem
Niederrhein fanden niederrheinische Adelsgeschlechter, wie die Spiering, Zutritt in
unser Gebiet. Der Sohn Philipp Ludwigs, Wolfgang Wilhelm (1614—1633), nahm
1613 die katholische Religion an und führte diese auch nach Antritt der Regierung
wieder im Herzogtum Neuburg ein. Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges
kostete die Gegend im vollen Maße. Burglengenfeld und Kallmünz gingen in
Flammen auf, Schwandorf hatte arg zu leiden. Herzog Philipp Wilhelm (1633—1690)
erlangte 168g auch die Kurwürde der Pfalz. Seit dieser Zeit blieb das Herzog-
tum Neuburg mit der Kurpfalz vereint. Es folgten die Kurfürsten Johann Wilhelm
(J690—1716), unter dem der spanische Erbfolgekrieg in den Bezirk hereinspielte
(Gefecht am 28. März 1703 bei Emhof), und Karl III. Philipp (1716—1742). Mit dem
Tode des letzteren fielen Neuburg und die Kurpfalz an die von einem Sohne des
Herzogs Philipp Ludwig begründete Linie Sulzbach, nämlich an Karl Theodor, der
seit 1733 das Herzogtum Sulzbach regierte. Als Karl Theodor 1777 auch das Kur-
fürstentum Bayern erbte, wurde unser Gebiet wieder mit Bayern vereinigt. Doch
blieb das Herzogtum Neuburg trotz dieser Vereinigung als selbständiges Fürstentum
bestehen; erst 1804 wurde es in eine Provinz umgewandelt und 1808 wurden auch
die Neuburger Landstände aufgelöst. (Neub. Koll.-Bl. 1900, S. 6g f.)
Im Unterschiede von den übrigen neuburgischen Pßegämtern des Nordgaues
führte das Gericht Burglengenfeld allein den Titel »Landgericht am Nordgau«, auch
»das gewaltige Landgericht am Nordgau«. (Uber den Ausdruck »gewaltiger Richter«
s
beiges) zu wohnen. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden mehrere
landständische Versammlungen des Herzogtums Neuburg in Burglengenfeld gehalten.
Am 4. Januar 1535 teilten die Brüder das Land. Philipp erhielt Lengenfeld,
Kallmünz, Schmidmühlen, Schwandorf etc. Da Philipp in große Schuldenlast geriet
— 1341 betrugen die Schulden 408361 Gulden —, so übernahm Otto Heinrich am
4. April 1541 dessen Landesanteil und setzte dafür seinem Bruder jährlich 1200 Gulden
bar und Naturalunterhalt für 14 Personen aus. (SALZER, Beiträge zu einer Biographie
Ottheinrichs, Heidelberg 1886, S. 63. — Ders., Allg. Deutsche Biographie, XXVI
[1888], 23. — KASIMIR REBELE, Kurfürst Ottheinrich, Bayerland XIII [1902] 330.)
Am 13. November 1342 erhoben Otto Heinrich und Philipp Burglengenfeld zur Stadt.
Durch Edikt vom 23. Juni 1542 führte Otto Heinrich im Herzogtum die lutherische
Religion ein. Um Mitte des 16. Jahrhunderts zählte unser Gebiet 44 Edelsitze.
Da Otto Heinrich ohne Leibeserben war, so vermachte er am 13. November
1333 das Fürstentum Neuburg für den Fall seines Ablebens dem Pfalzgrafen Wolf-
gang von Zweibrücken-Veldenz, welcher der Stammvater des jetzigen königlichen
Hauses Wittelsbach ist. Seit 1333 verwaltete Pfalzgraf Wolfgang das Fürstentum,
1559 gelangte er mit dem Tode des (1556 Kurfürst von der Pfalz gewordenen) Otto
Heinrich in den förmlichen Besitz. (KARL MENZEL, Wolfgang von Zweibrücken,
München 1893. — NEY, Allg. Deutsche Biographie, Bd. 44, S. 76 ff. — H. LEHER,
Die Wolfgange im Hause Wittelsbach, i. d. Zeitschrift »Das Bayerland« VI [1893],
402 ff. — RtEDER, Neub. Koll.-Bl. 1900, S. 47.) Auf Herzog Wolfgang (p 1569).
folgte dessen Sohn Herzog Philipp Ludwig (1369—1614), der durch seine Gemahlin
1609 auch die Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg erlangte (vorläufig gemeinsam
mit Kurbrandenburg). Infolge dieser Verbindung des Herzogtums Neuburg mit dem
Niederrhein fanden niederrheinische Adelsgeschlechter, wie die Spiering, Zutritt in
unser Gebiet. Der Sohn Philipp Ludwigs, Wolfgang Wilhelm (1614—1633), nahm
1613 die katholische Religion an und führte diese auch nach Antritt der Regierung
wieder im Herzogtum Neuburg ein. Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges
kostete die Gegend im vollen Maße. Burglengenfeld und Kallmünz gingen in
Flammen auf, Schwandorf hatte arg zu leiden. Herzog Philipp Wilhelm (1633—1690)
erlangte 168g auch die Kurwürde der Pfalz. Seit dieser Zeit blieb das Herzog-
tum Neuburg mit der Kurpfalz vereint. Es folgten die Kurfürsten Johann Wilhelm
(J690—1716), unter dem der spanische Erbfolgekrieg in den Bezirk hereinspielte
(Gefecht am 28. März 1703 bei Emhof), und Karl III. Philipp (1716—1742). Mit dem
Tode des letzteren fielen Neuburg und die Kurpfalz an die von einem Sohne des
Herzogs Philipp Ludwig begründete Linie Sulzbach, nämlich an Karl Theodor, der
seit 1733 das Herzogtum Sulzbach regierte. Als Karl Theodor 1777 auch das Kur-
fürstentum Bayern erbte, wurde unser Gebiet wieder mit Bayern vereinigt. Doch
blieb das Herzogtum Neuburg trotz dieser Vereinigung als selbständiges Fürstentum
bestehen; erst 1804 wurde es in eine Provinz umgewandelt und 1808 wurden auch
die Neuburger Landstände aufgelöst. (Neub. Koll.-Bl. 1900, S. 6g f.)
Im Unterschiede von den übrigen neuburgischen Pßegämtern des Nordgaues
führte das Gericht Burglengenfeld allein den Titel »Landgericht am Nordgau«, auch
»das gewaltige Landgericht am Nordgau«. (Uber den Ausdruck »gewaltiger Richter«