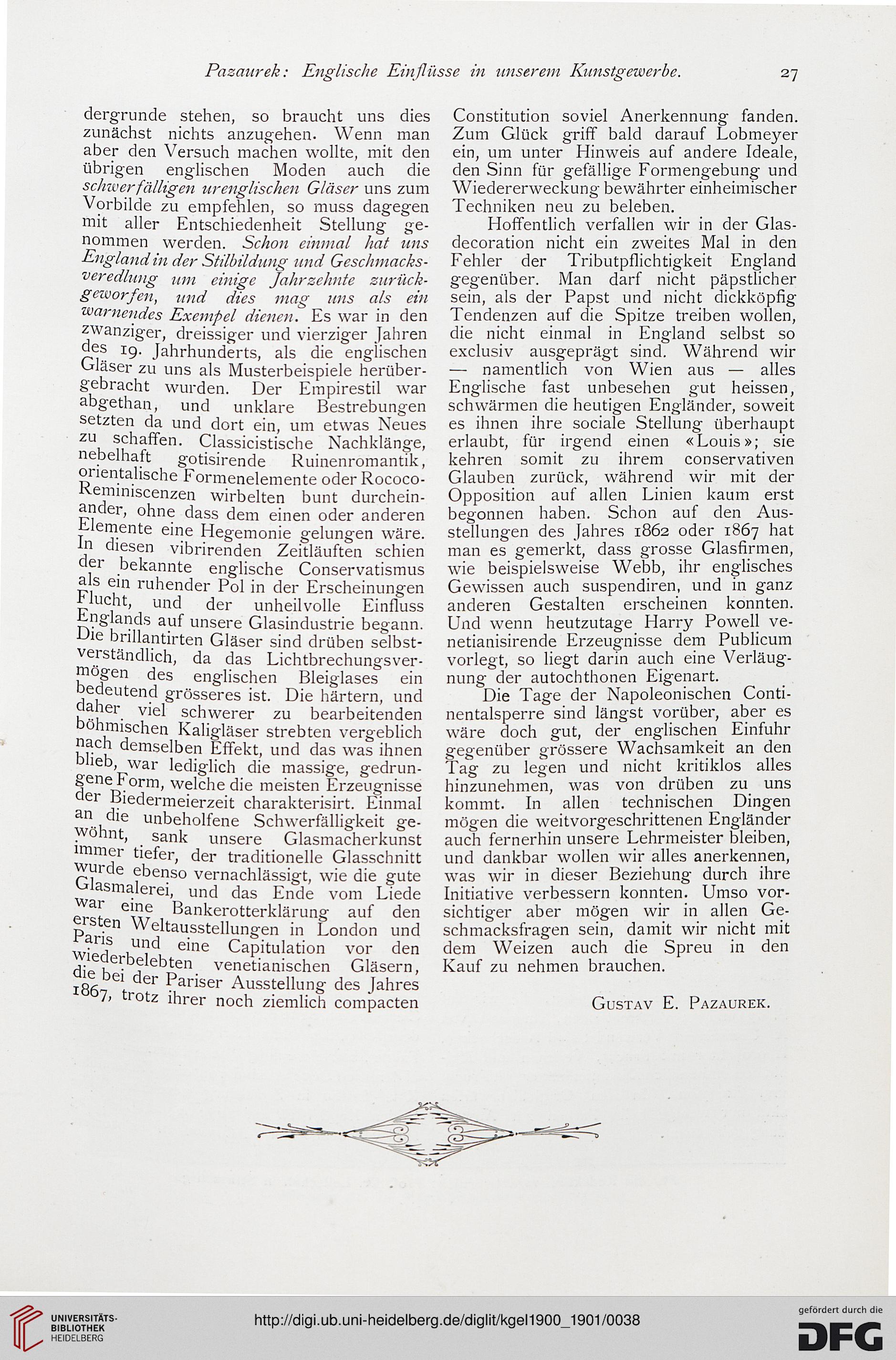Pazaurek: Englisclie Einflüsse in unserem Kunstgewerbe.
27
dergrunde stehen, so braucht uns dies
zunächst nichts anzugehen. Wenn man
aber den Versuch machen wollte, mit den
übrigen englischen Moden auch die
schwerfälligen urenglischen Gläser uns zum
Vorbilde zu empfehlen, so muss dagegen
mit aller Entschiedenheit Stellung ge-
nommen werden. Schon einmal hat uns
England in der Stilbildung und Geschmacks-
veredlung um einige Jahrzehnte zurück-
geworfen, und dies mag uns als ein
warnendes Excmpel dienen. Es war in den
zwanziger, dreissiger und vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts, als die englischen
Gläser zu uns als Musterbeispiele herüber-
gebracht wurden. Der Empirestil war
abgethan, und unklare Bestrebungen
setzten da und dort ein, um etwas Neues
zu schaffen. Classicistische Nachklänge,
nebelhaft gotisirende Ruinenromantik,
orientalische Eormenelemente oder Rococo-
Reminiscenzen wirbelten bunt durchein-
ander, ohne dass dem einen oder anderen
Elemente eine Hegemonie gelungen wäre.
In diesen vibrirenden Zeitläuften schien
der bekannte englische Conservatismus
als ein ruhender Pol in der Erscheinungen
Flucht, und der unheilvolle Einfluss
Englands auf unsere Glasindustrie begann.
Die brillantirten Gläser sind drüben selbst-
verständlich, da das Lichtbrechungsver-
mögen des englischen Bleiglases ein
bedeutend grösseres ist. Die härtern, und
daher viel schwerer zu bearbeitenden
böhmischen Kaligläser strebten vergeblich
nach demselben Effekt, und das was ihnen
blieb, war lediglich die massige, gedrun-
gene Form, welche die meisten Erzeugnisse
der Biedermeierzeit charakterisirt. Einmal
an die unbeholfene Schwerfälligkeit ge-
wöhnt, sank unsere Glasmacherkunst
immer tiefer, der traditionelle Glasschnitt
wurde ebenso vernachlässigt, wie die gute
Glasmalerei, und das Ende vom Liede
war eine Bankerotterklärung auf den
ersten Weltausstellungen in London und
Paris und eine Capitulation vor den
wiederbelebten venetianischen Gläsern,
die bei der Pariser Ausstellung des Jahres
To67, trotz ihrer noch ziemlich compacten
Constitution soviel Anerkennung fanden.
Zum Glück griff bald darauf Lobmeyer
ein, um unter Hinweis auf andere Ideale,
den Sinn für gefällige Formengebung und
Wiedererweckung bewährter einheimischer
Techniken neu zu beleben.
Hoffentlich verfallen wir in der Glas-
decoration nicht ein zweites Mal in den
Fehler der Tributpflichtigkeit England
gegenüber. Man darf nicht päpstlicher
sein, als der Papst und nicht dickköpfig
Tendenzen auf die Spitze treiben wollen,
die nicht einmal in England selbst so
exclusiv ausgeprägt sind. Während wir
— namentlich von Wien aus — alles
Englische fast unbesehen gut heissen,
schwärmen die heutigen Engländer, soweit
es ihnen ihre sociale Stellung überhaupt
erlaubt, für irgend einen «Louis»; sie
kehren somit zu ihrem conservativen
Glauben zurück, während wir mit der
Opposition auf allen Linien kaum erst
begonnen haben. Schon auf den Aus-
stellungen des Jahres 1862 oder 1867 hat
man es gemerkt, dass grosse Glasfirmen,
wie beispielsweise Webb, ihr englisches
Gewissen auch suspendiren, und in ganz
anderen Gestalten erscheinen konnten.
Und wenn heutzutage Harry Powell ve-
netianisirende Erzeugnisse dem Publicum
vorlegt, so liegt darin auch eine Verläug-
nung der autochthonen Eigenart.
Die Tage der Napoleonischen Conti-
nentalsperre sind längst vorüber, aber es
wäre doch gut, der englischen Einfuhr
gegenüber grössere Wachsamkeit an den
Tag zu legen und nicht kritiklos alles
hinzunehmen, was von drüben zu uns
kommt. In allen technischen Dingen
mögen die weitvorgeschrittenen Engländer
auch fernerhin unsere Lehrmeister bleiben,
und dankbar wollen wir alles anerkennen,
was wir in dieser Beziehung durch ihre
Initiative verbessern konnten. Umso vor-
sichtiger aber mögen wir in allen Ge-
schmacksfragen sein, damit wir nicht mit
dem Weizen auch die Spreu in den
Kauf zu nehmen brauchen.
Gustav E. Pazaurek.
27
dergrunde stehen, so braucht uns dies
zunächst nichts anzugehen. Wenn man
aber den Versuch machen wollte, mit den
übrigen englischen Moden auch die
schwerfälligen urenglischen Gläser uns zum
Vorbilde zu empfehlen, so muss dagegen
mit aller Entschiedenheit Stellung ge-
nommen werden. Schon einmal hat uns
England in der Stilbildung und Geschmacks-
veredlung um einige Jahrzehnte zurück-
geworfen, und dies mag uns als ein
warnendes Excmpel dienen. Es war in den
zwanziger, dreissiger und vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts, als die englischen
Gläser zu uns als Musterbeispiele herüber-
gebracht wurden. Der Empirestil war
abgethan, und unklare Bestrebungen
setzten da und dort ein, um etwas Neues
zu schaffen. Classicistische Nachklänge,
nebelhaft gotisirende Ruinenromantik,
orientalische Eormenelemente oder Rococo-
Reminiscenzen wirbelten bunt durchein-
ander, ohne dass dem einen oder anderen
Elemente eine Hegemonie gelungen wäre.
In diesen vibrirenden Zeitläuften schien
der bekannte englische Conservatismus
als ein ruhender Pol in der Erscheinungen
Flucht, und der unheilvolle Einfluss
Englands auf unsere Glasindustrie begann.
Die brillantirten Gläser sind drüben selbst-
verständlich, da das Lichtbrechungsver-
mögen des englischen Bleiglases ein
bedeutend grösseres ist. Die härtern, und
daher viel schwerer zu bearbeitenden
böhmischen Kaligläser strebten vergeblich
nach demselben Effekt, und das was ihnen
blieb, war lediglich die massige, gedrun-
gene Form, welche die meisten Erzeugnisse
der Biedermeierzeit charakterisirt. Einmal
an die unbeholfene Schwerfälligkeit ge-
wöhnt, sank unsere Glasmacherkunst
immer tiefer, der traditionelle Glasschnitt
wurde ebenso vernachlässigt, wie die gute
Glasmalerei, und das Ende vom Liede
war eine Bankerotterklärung auf den
ersten Weltausstellungen in London und
Paris und eine Capitulation vor den
wiederbelebten venetianischen Gläsern,
die bei der Pariser Ausstellung des Jahres
To67, trotz ihrer noch ziemlich compacten
Constitution soviel Anerkennung fanden.
Zum Glück griff bald darauf Lobmeyer
ein, um unter Hinweis auf andere Ideale,
den Sinn für gefällige Formengebung und
Wiedererweckung bewährter einheimischer
Techniken neu zu beleben.
Hoffentlich verfallen wir in der Glas-
decoration nicht ein zweites Mal in den
Fehler der Tributpflichtigkeit England
gegenüber. Man darf nicht päpstlicher
sein, als der Papst und nicht dickköpfig
Tendenzen auf die Spitze treiben wollen,
die nicht einmal in England selbst so
exclusiv ausgeprägt sind. Während wir
— namentlich von Wien aus — alles
Englische fast unbesehen gut heissen,
schwärmen die heutigen Engländer, soweit
es ihnen ihre sociale Stellung überhaupt
erlaubt, für irgend einen «Louis»; sie
kehren somit zu ihrem conservativen
Glauben zurück, während wir mit der
Opposition auf allen Linien kaum erst
begonnen haben. Schon auf den Aus-
stellungen des Jahres 1862 oder 1867 hat
man es gemerkt, dass grosse Glasfirmen,
wie beispielsweise Webb, ihr englisches
Gewissen auch suspendiren, und in ganz
anderen Gestalten erscheinen konnten.
Und wenn heutzutage Harry Powell ve-
netianisirende Erzeugnisse dem Publicum
vorlegt, so liegt darin auch eine Verläug-
nung der autochthonen Eigenart.
Die Tage der Napoleonischen Conti-
nentalsperre sind längst vorüber, aber es
wäre doch gut, der englischen Einfuhr
gegenüber grössere Wachsamkeit an den
Tag zu legen und nicht kritiklos alles
hinzunehmen, was von drüben zu uns
kommt. In allen technischen Dingen
mögen die weitvorgeschrittenen Engländer
auch fernerhin unsere Lehrmeister bleiben,
und dankbar wollen wir alles anerkennen,
was wir in dieser Beziehung durch ihre
Initiative verbessern konnten. Umso vor-
sichtiger aber mögen wir in allen Ge-
schmacksfragen sein, damit wir nicht mit
dem Weizen auch die Spreu in den
Kauf zu nehmen brauchen.
Gustav E. Pazaurek.