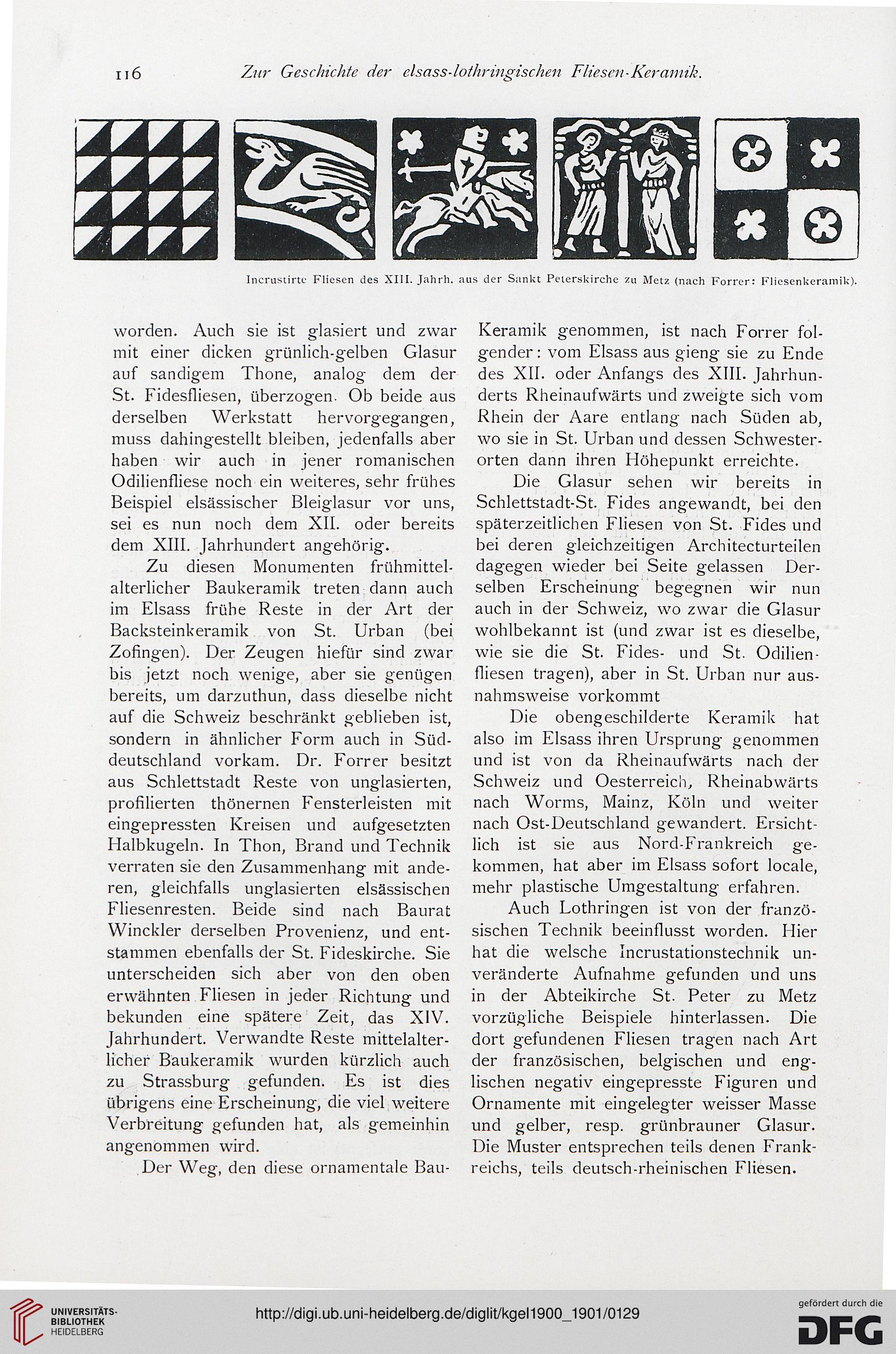ri6
Zur Geschichte der elsass-löthringischen Fliesen-Keramik.
Incrustirte Fliesen des XIII. Jahrb. aus der Sankt Peterskirche zu Metz (nach Forrer: Fliesenkeramik).
worden. Auch sie ist glasiert und zwar
mit einer dicken grünlich-gelben Glasur
auf sandigem Thone, analog dem der
St. Fidesfliesen, überzogen. Ob beide aus
derselben Werkstatt hervorgegangen,
muss dahingestellt bleiben, jedenfalls aber
haben wir auch in jener romanischen
Odilienfliese noch ein weiteres, sehr frühes
Beispiel elsässischer Bleiglasur vor uns,
sei es nun noch dem XII. oder bereits
dem XIII. Jahrhundert angehörig.
Zu diesen Monumenten frühmittel-
alterlicher Baukeramik treten dann auch
im Elsass frühe Reste in der Art der
Backsteinkeramik von St. Urban (bei
Zofingen). Der Zeugen hiefür sind zwar
bis jetzt noch wenige, aber sie genügen
bereits, um darzuthun, dass dieselbe nicht
auf die Schweiz beschränkt geblieben ist,
sondern in ähnlicher Form auch in Süd-
deutschland vorkam. Dr. Forrer besitzt
aus Schlettstadt Reste von unglasierten,
profilierten thönernen Fensterleisten mit
eingepressten Kreisen und aufgesetzten
Halbkugeln. In Thon, Brand und Technik
verraten sie den Zusammenhang mit ande-
ren, gleichfalls unglasierten elsässischen
Fliesenresten. Beide sind nach Baurat
Winckler derselben Provenienz, und ent-
stammen ebenfalls der St. Fideskirche. Sie
unterscheiden sich aber von den oben
erwähnten Fliesen in jeder Richtung und
bekunden eine spätere Zeit, das XIV.
Jahrhundert. Verwandte Reste mittelalter-
licher Baukeramik wurden kürzlich auch
zu Strassburg gefunden. Es ist dies
übrigens eine Erscheinung, die viel weitere
Verbreitung gefunden hat, als gemeinhin
angenommen wird.
Der Weg, den diese ornamentale Bau-
Keramik genommen, ist nach Forrer fol-
gender : vom Elsass aus gieng sie zu Ende
des XII. oder Anfangs des XIII. Jahrhun-
derts Rheinaufwärts und zweigte sich vom
Rhein der Aare entlang nach Süden ab,
wo sie in St. Urban und dessen Schwester-
orten dann ihren Höhepunkt erreichte.
Die Glasur sehen wir bereits in
Schlettstadt-St. Fides angewandt, bei den
späterzeitlichen Fliesen von St. Fides und
bei deren gleichzeitigen Architecturteilen
dagegen wieder bei Seite gelassen Der-
selben Erscheinung begegnen wir nun
auch in der Schweiz, wo zwar die Glasur
wohlbekannt ist (und zwar ist es dieselbe,
wie sie die St. Fides- und St. Odilien-
fliesen tragen), aber in St. Urban nur aus-
nahmsweise vorkommt
Die obengeschilderte Keramik hat
also im Elsass ihren Ursprung genommen
und ist von da Rheinaufwärts nach der
Schweiz und Oesterreich, Rheinabwärts
nach Worms, Mainz, Köln und weiter
nach Ost-Deutschland gewandert. Ersicht-
lich ist sie aus Nord-Frankreich ge-
kommen, hat aber im Elsass sofort locale,
mehr plastische Umgestaltung erfahren.
Auch Lothringen ist von der franzö-
sischen Technik beeinflusst worden. Hier
hat die welsche Incrustationstechnik un-
veränderte Aufnahme gefunden und uns
in der Abteikirche St. Peter zu Metz
vorzügliche Beispiele hinterlassen. Die
dort gefundenen Fliesen tragen nach Art
der französischen, belgischen und eng-
lischen negativ eingepresste Figuren und
Ornamente mit eingelegter weisser Masse
und gelber, resp. grünbrauner Glasur.
Die Muster entsprechen teils denen Frank-
reichs, teils deutsch-rheinischen Fliesen.
Zur Geschichte der elsass-löthringischen Fliesen-Keramik.
Incrustirte Fliesen des XIII. Jahrb. aus der Sankt Peterskirche zu Metz (nach Forrer: Fliesenkeramik).
worden. Auch sie ist glasiert und zwar
mit einer dicken grünlich-gelben Glasur
auf sandigem Thone, analog dem der
St. Fidesfliesen, überzogen. Ob beide aus
derselben Werkstatt hervorgegangen,
muss dahingestellt bleiben, jedenfalls aber
haben wir auch in jener romanischen
Odilienfliese noch ein weiteres, sehr frühes
Beispiel elsässischer Bleiglasur vor uns,
sei es nun noch dem XII. oder bereits
dem XIII. Jahrhundert angehörig.
Zu diesen Monumenten frühmittel-
alterlicher Baukeramik treten dann auch
im Elsass frühe Reste in der Art der
Backsteinkeramik von St. Urban (bei
Zofingen). Der Zeugen hiefür sind zwar
bis jetzt noch wenige, aber sie genügen
bereits, um darzuthun, dass dieselbe nicht
auf die Schweiz beschränkt geblieben ist,
sondern in ähnlicher Form auch in Süd-
deutschland vorkam. Dr. Forrer besitzt
aus Schlettstadt Reste von unglasierten,
profilierten thönernen Fensterleisten mit
eingepressten Kreisen und aufgesetzten
Halbkugeln. In Thon, Brand und Technik
verraten sie den Zusammenhang mit ande-
ren, gleichfalls unglasierten elsässischen
Fliesenresten. Beide sind nach Baurat
Winckler derselben Provenienz, und ent-
stammen ebenfalls der St. Fideskirche. Sie
unterscheiden sich aber von den oben
erwähnten Fliesen in jeder Richtung und
bekunden eine spätere Zeit, das XIV.
Jahrhundert. Verwandte Reste mittelalter-
licher Baukeramik wurden kürzlich auch
zu Strassburg gefunden. Es ist dies
übrigens eine Erscheinung, die viel weitere
Verbreitung gefunden hat, als gemeinhin
angenommen wird.
Der Weg, den diese ornamentale Bau-
Keramik genommen, ist nach Forrer fol-
gender : vom Elsass aus gieng sie zu Ende
des XII. oder Anfangs des XIII. Jahrhun-
derts Rheinaufwärts und zweigte sich vom
Rhein der Aare entlang nach Süden ab,
wo sie in St. Urban und dessen Schwester-
orten dann ihren Höhepunkt erreichte.
Die Glasur sehen wir bereits in
Schlettstadt-St. Fides angewandt, bei den
späterzeitlichen Fliesen von St. Fides und
bei deren gleichzeitigen Architecturteilen
dagegen wieder bei Seite gelassen Der-
selben Erscheinung begegnen wir nun
auch in der Schweiz, wo zwar die Glasur
wohlbekannt ist (und zwar ist es dieselbe,
wie sie die St. Fides- und St. Odilien-
fliesen tragen), aber in St. Urban nur aus-
nahmsweise vorkommt
Die obengeschilderte Keramik hat
also im Elsass ihren Ursprung genommen
und ist von da Rheinaufwärts nach der
Schweiz und Oesterreich, Rheinabwärts
nach Worms, Mainz, Köln und weiter
nach Ost-Deutschland gewandert. Ersicht-
lich ist sie aus Nord-Frankreich ge-
kommen, hat aber im Elsass sofort locale,
mehr plastische Umgestaltung erfahren.
Auch Lothringen ist von der franzö-
sischen Technik beeinflusst worden. Hier
hat die welsche Incrustationstechnik un-
veränderte Aufnahme gefunden und uns
in der Abteikirche St. Peter zu Metz
vorzügliche Beispiele hinterlassen. Die
dort gefundenen Fliesen tragen nach Art
der französischen, belgischen und eng-
lischen negativ eingepresste Figuren und
Ornamente mit eingelegter weisser Masse
und gelber, resp. grünbrauner Glasur.
Die Muster entsprechen teils denen Frank-
reichs, teils deutsch-rheinischen Fliesen.