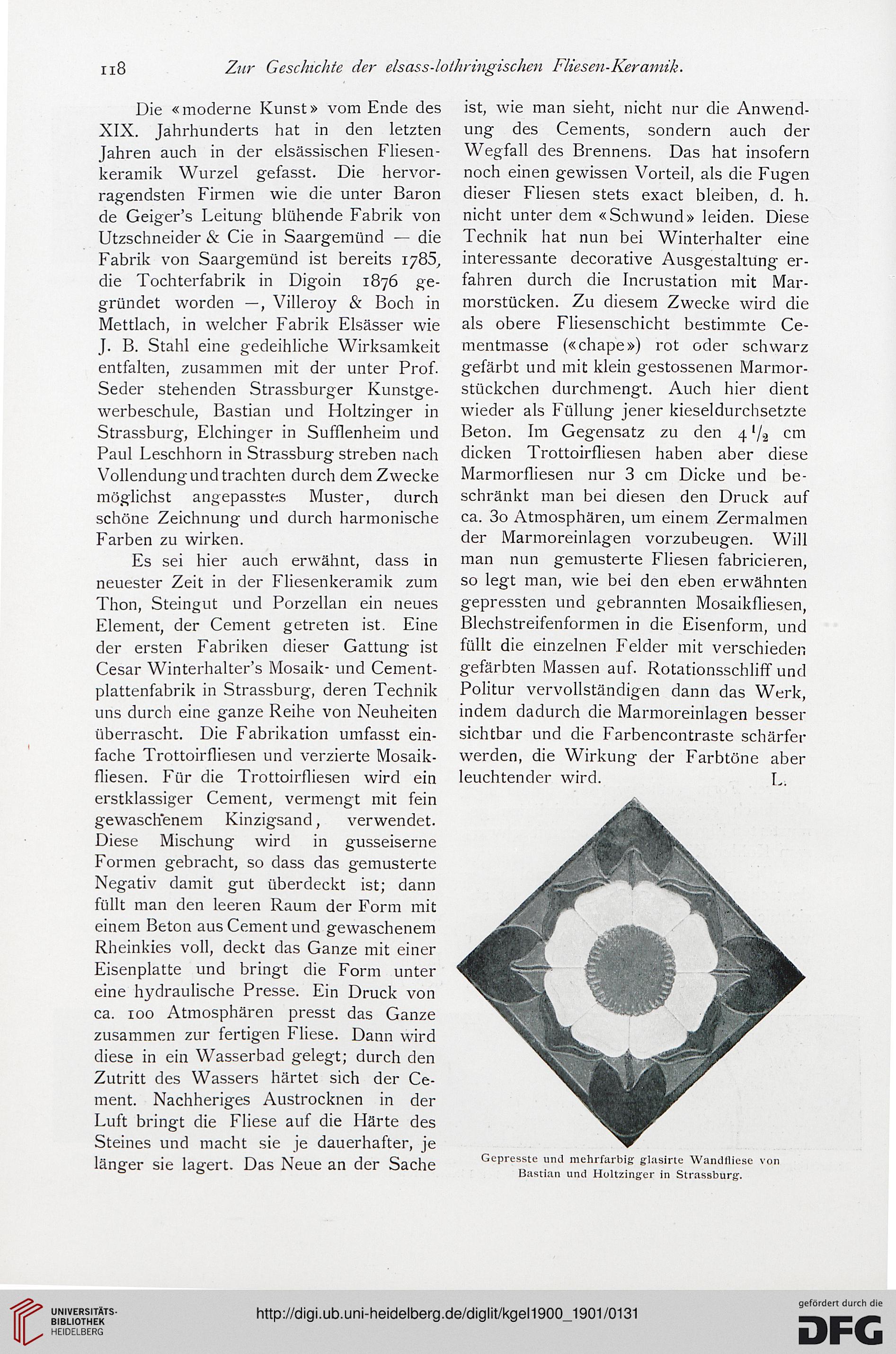n8
Zur Geschichte der elsass-lothringischen Fliesen-Keramik.
Die «moderne Kunst» vom Ende des
XIX. Jahrhunderts hat in den letzten
Jahren auch in der elsässischen Fliesen-
keramik Wurzel gefasst. Die hervor-
ragendsten Firmen wie die unter Baron
de Geiger's Leitung blühende Fabrik von
Utzschneider & Cie in Saargemünd — die
Fabrik von Saargemünd ist bereits 1785,
die Tochterfabrik in Digoin 1876 ge-
gründet worden —, Villeroy & Boch in
Mettlach, in welcher Fabrik Elsässer wie
J. B. Stahl eine gedeihliche Wirksamkeit
entfalten, zusammen mit der unter Prof.
Seder stehenden Strassburger Kunstge-
werbeschule, Bastian und Holtzinger in
Strassburg, Elchinger in Sufflenheim und
Paul Leschhorn in Strassburg streben nach
Vollendung und trachten durch dem Zwecke
möglichst angepasstes Muster, durch
schöne Zeichnung und durch harmonische
Farben zu wirken.
Es sei hier auch erwähnt, dass in
neuester Zeit in der Fliesenkeramik zum
Thon, Steingut und Porzellan ein neues
Element, der Cement getreten ist. Eine
der ersten Fabriken dieser Gattung ist
Cesar Winterhalter's Mosaik- und Cement-
plattenfabrik in Strassburg, deren Technik
uns durch eine ganze Reihe von Neuheiten
überrascht. Die Fabrikation umfasst ein-
fache Trottoirfliesen und verzierte Mosaik-
fliesen. Für die Trottoirfliesen wird ein
erstklassiger Cement, vermengt mit fein
gewaschenem Kinzigsand, verwendet.
Diese Mischung wird in gusseiserne
Formen gebracht, so dass das gemusterte
Negativ damit gut überdeckt ist; dann
füllt man den leeren Raum der Form mit
einem Beton aus Cement und gewaschenem
Rheinkies voll, deckt das Ganze mit einer
Eisenplatte und bringt die Form unter
eine hydraulische Presse. Ein Druck von
ca. 100 Atmosphären presst das Ganze
zusammen zur fertigen Fliese. Dann wird
diese in ein Wasserbad gelegt; durch den
Zutritt des Wassers härtet sich der Ce-
ment. Nachheriges Austrocknen in der
Luft bringt die Fliese auf die Härte des
Steines und macht sie je dauerhafter, je
länger sie lagert. Das Neue an der Sache
ist, wie man sieht, nicht nur die Anwend-
ung des Cements, sondern auch der
Wegfall des Brennens. Das hat insofern
noch einen gewissen Vorteil, als die Fugen
dieser Fliesen stets exact bleiben, d. h.
nicht unter dem «Schwund» leiden. Diese
Technik hat nun bei Winterhalter eine
interessante decorative Ausgestaltung er-
fahren durch die Incrustation mit Mar-
morstücken. Zu diesem Zwecke wird die
als obere Fliesenschicht bestimmte Ce-
mentmasse («chape») rot oder schwarz
gefärbt und mit klein gestossenen Marmor-
stückchen durchmengt. Auch hier dient
wieder als Füllung jener kieseldurchsetzte
Beton. Im Gegensatz zu den 4 '/-2 cm
dicken Trottoirfliesen haben aber diese
Marmorfliesen nur 3 cm Dicke und be-
schränkt man bei diesen den Druck auf
ca. 3o Atmosphären, um einem Zermalmen
der Marmoreinlagen vorzubeugen. Will
man nun gemusterte Fliesen fabricieren,
so legt man, wie bei den eben erwähnten
gepressten und gebrannten Mosaikfliesen,
Blechstreifenformen in die Eisenform, und
füllt die einzelnen Felder mit verschieden
gefärbten Massen auf. Rotationsschliff und
Politur vervollständigen dann das Werk,
indem dadurch die Marmoreinlagen besser
sichtbar und die Farbencontraste schärfer
werden, die Wirkung der Farbtöne aber
leuchtender wird. Li
Gcpresste und mehrfarbig glasirte Wandfliese von
Bastian und Holtzinger in Strassburg.
Zur Geschichte der elsass-lothringischen Fliesen-Keramik.
Die «moderne Kunst» vom Ende des
XIX. Jahrhunderts hat in den letzten
Jahren auch in der elsässischen Fliesen-
keramik Wurzel gefasst. Die hervor-
ragendsten Firmen wie die unter Baron
de Geiger's Leitung blühende Fabrik von
Utzschneider & Cie in Saargemünd — die
Fabrik von Saargemünd ist bereits 1785,
die Tochterfabrik in Digoin 1876 ge-
gründet worden —, Villeroy & Boch in
Mettlach, in welcher Fabrik Elsässer wie
J. B. Stahl eine gedeihliche Wirksamkeit
entfalten, zusammen mit der unter Prof.
Seder stehenden Strassburger Kunstge-
werbeschule, Bastian und Holtzinger in
Strassburg, Elchinger in Sufflenheim und
Paul Leschhorn in Strassburg streben nach
Vollendung und trachten durch dem Zwecke
möglichst angepasstes Muster, durch
schöne Zeichnung und durch harmonische
Farben zu wirken.
Es sei hier auch erwähnt, dass in
neuester Zeit in der Fliesenkeramik zum
Thon, Steingut und Porzellan ein neues
Element, der Cement getreten ist. Eine
der ersten Fabriken dieser Gattung ist
Cesar Winterhalter's Mosaik- und Cement-
plattenfabrik in Strassburg, deren Technik
uns durch eine ganze Reihe von Neuheiten
überrascht. Die Fabrikation umfasst ein-
fache Trottoirfliesen und verzierte Mosaik-
fliesen. Für die Trottoirfliesen wird ein
erstklassiger Cement, vermengt mit fein
gewaschenem Kinzigsand, verwendet.
Diese Mischung wird in gusseiserne
Formen gebracht, so dass das gemusterte
Negativ damit gut überdeckt ist; dann
füllt man den leeren Raum der Form mit
einem Beton aus Cement und gewaschenem
Rheinkies voll, deckt das Ganze mit einer
Eisenplatte und bringt die Form unter
eine hydraulische Presse. Ein Druck von
ca. 100 Atmosphären presst das Ganze
zusammen zur fertigen Fliese. Dann wird
diese in ein Wasserbad gelegt; durch den
Zutritt des Wassers härtet sich der Ce-
ment. Nachheriges Austrocknen in der
Luft bringt die Fliese auf die Härte des
Steines und macht sie je dauerhafter, je
länger sie lagert. Das Neue an der Sache
ist, wie man sieht, nicht nur die Anwend-
ung des Cements, sondern auch der
Wegfall des Brennens. Das hat insofern
noch einen gewissen Vorteil, als die Fugen
dieser Fliesen stets exact bleiben, d. h.
nicht unter dem «Schwund» leiden. Diese
Technik hat nun bei Winterhalter eine
interessante decorative Ausgestaltung er-
fahren durch die Incrustation mit Mar-
morstücken. Zu diesem Zwecke wird die
als obere Fliesenschicht bestimmte Ce-
mentmasse («chape») rot oder schwarz
gefärbt und mit klein gestossenen Marmor-
stückchen durchmengt. Auch hier dient
wieder als Füllung jener kieseldurchsetzte
Beton. Im Gegensatz zu den 4 '/-2 cm
dicken Trottoirfliesen haben aber diese
Marmorfliesen nur 3 cm Dicke und be-
schränkt man bei diesen den Druck auf
ca. 3o Atmosphären, um einem Zermalmen
der Marmoreinlagen vorzubeugen. Will
man nun gemusterte Fliesen fabricieren,
so legt man, wie bei den eben erwähnten
gepressten und gebrannten Mosaikfliesen,
Blechstreifenformen in die Eisenform, und
füllt die einzelnen Felder mit verschieden
gefärbten Massen auf. Rotationsschliff und
Politur vervollständigen dann das Werk,
indem dadurch die Marmoreinlagen besser
sichtbar und die Farbencontraste schärfer
werden, die Wirkung der Farbtöne aber
leuchtender wird. Li
Gcpresste und mehrfarbig glasirte Wandfliese von
Bastian und Holtzinger in Strassburg.