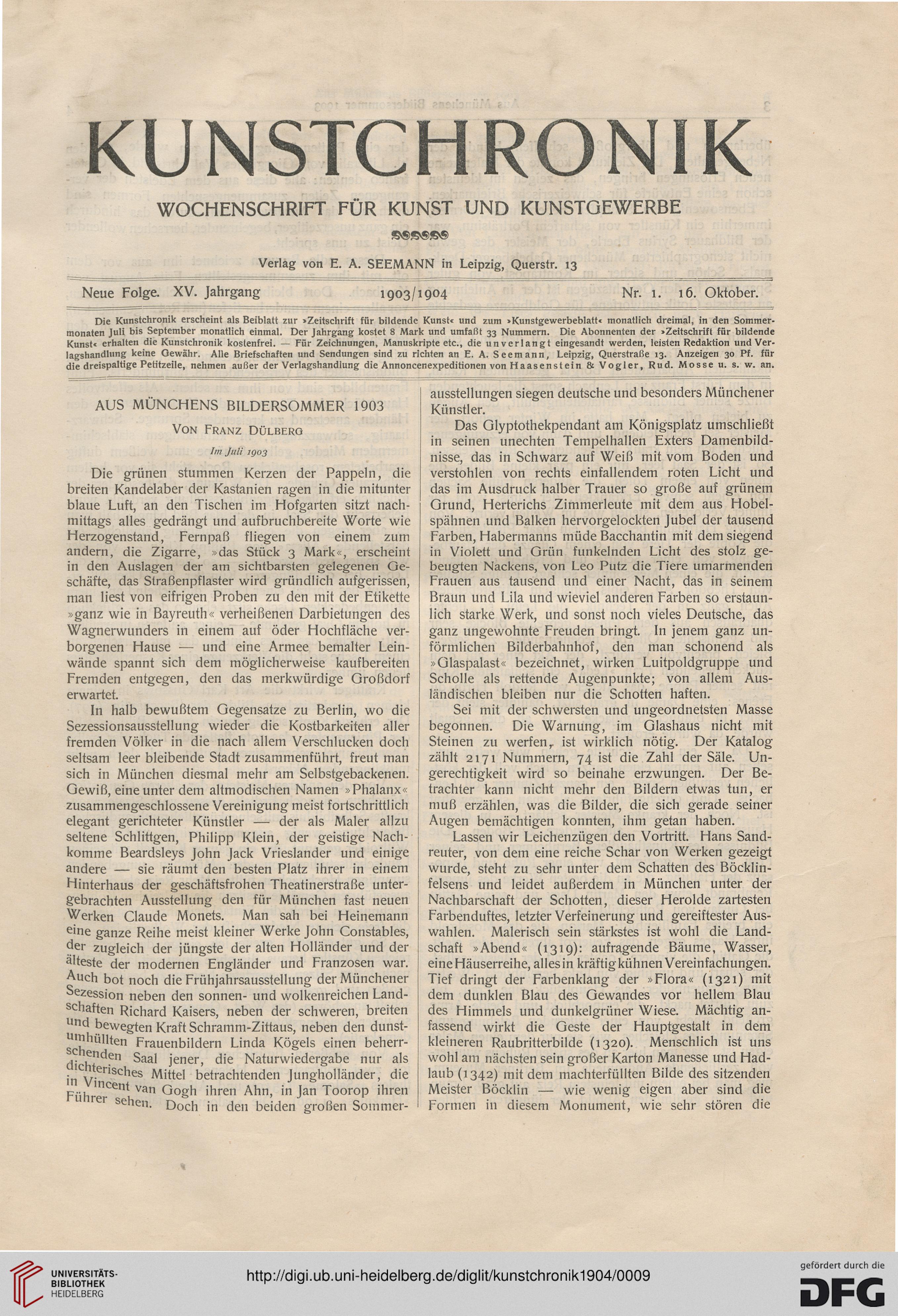KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang
1903/1904
Nr. 1. 16. Oktober.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
lagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
AUS MÜNCHENS BILDERSOMMER 1903
Von Franz Dolberg
im Juli jgo3
Die grünen stummen Kerzen der Pappeln, die
breiten Kandelaber der Kastanien ragen in die mitunter
blaue Luft, an den Tischen im Hofgarten sitzt nach-
mittags alles gedrängt und aufbruchbereite Worte wie
Herzogenstand, Fernpaß fliegen von einem zum
andern, die Zigarre, »das Stück 3 Mark«, erscheint
in den Auslagen der am sichtbarsten gelegenen Ge-
schäfte, das Straßenpflaster wird gründlich aufgerissen,
man liest von eifrigen Proben zu den mit der Etikette
»ganz wie in Bayreuth« verheißenen Darbietungen des
Wagnerwunders in einem auf öder Hochfläche ver-
borgenen Hause — und eine Armee bemalter Lein-
wände spannt sich dem möglicherweise kaufbereiten
Fremden entgegen, den das merkwürdige Großdorf
erwartet.
In halb bewußtem Gegensatze zu Berlin, wo die
Sezessionsausstellung wieder die Kostbarkeiten aller
fremden Völker in die nach allem Verschlucken doch
seltsam leer bleibende Stadt zusammenführt, freut man
sich in München diesmal mehr am Selbstgebackenen.
Gewiß, eine unter dem altmodischen Namen »Phalanx«
zusammengeschlossene Vereinigung meist fortschrittlich
elegant gerichteter Künstler — der als Maler allzu
seltene Schlittgen, Philipp Klein, der geistige Nach-
komme Beardsleys John Jack Vrieslander und einige
andere — sie räumt den besten Platz ihrer in einem
Hinterhaus der geschäftsfrohen Theatinerstraße unter-
gebrachten Ausstellung den für München fast neuen
Werken Claude Monets. Man sah bei Heinemann
eine ganze Reihe meist kleiner Werke John Constables,
der zugleich der jüngste der alten Holländer und der
älteste der modernen Engländer und Franzosen war.
Auch bot noch die Frühjahrsausstellung der Münchener
Sezession neben den sonnen- und wolkenreichen Land-
schaften Richard Kaisers, neben der schweren, breiten
Und bewegten Kraft Schramm-Zittaus, neben den dunst-
""ihüllten Frauenbildern Linda Kögels einen beherr-
di m"^611 ^aa' iener> d'e Naturwiedergabe nur als
inVincent65 M'tte' betrachtenden JunghoIländer> die
van Gogh ihren Ahn, in Jan Toorop ihren
Führer uug» iiiicn hihi, 111 jau i<j<jiu|j
er sener>- Doch in den beiden großen So
111 mer-
ausstellungen siegen deutsche und besonders Münchener
Künstler.
Das Glyptothekpendant am Königsplatz umschließt
in seinen unechten Tempelhallen Exters Damenbild-
nisse, das in Schwarz auf Weiß mit vom Boden und
verstohlen von rechts einfallendem roten Licht und
das im Ausdruck halber Trauer so große auf grünem
Grund, Herterichs Zimmerleute mit dem aus Hobel-
spähnen und Balken hervorgelockten Jubel der tausend
Farben, Habermanns müde Bacchantin mit dem siegend
in Violett und Grün funkelnden Licht des stolz ge-
beugten Nackens, von Leo Putz die Tiere umarmenden
Frauen aus tausend und einer Nacht, das in seinem
Braun und Lila und wieviel anderen Farben so erstaun-
lich starke Werk, und sonst noch vieles Deutsche, das
ganz ungewohnte Freuden bringt. In jenem ganz un-
förmlichen Bilderbahnhof, den man schonend als
»Glaspalast« bezeichnet, wirken Luitpoldgruppe und
Scholle als rettende Augenpunkte; von allem Aus-
ländischen bleiben nur die Schotten haften.
Sei mit der schwersten und ungeordnetsten Masse
begonnen. Die Warnung, im Glashaus nicht mit
Steinen zu werfen r ist wirklich nötig. Der Katalog
zählt 2171 Nummern, 74 ist die Zahl der Säle. Un-
gerechtigkeit wird so beinahe erzwungen. Der Be-
trachter kann nicht mehr den Bildern etwas tun, er
muß erzählen, was die Bilder, die sich gerade seiner
Augen bemächtigen konnten, ihm getan haben.
Lassen wir Leichenzügen den Vortritt. Hans Sand-
reuter, von dem eine reiche Schar von Werken gezeigt
wurde, steht zu sehr unter dem Schatten des Böcklin-
felsens und leidet außerdem in München unter der
Nachbarschaft der Schotten, dieser Herolde zartesten
Farbenduftes, letzter Verfeinerung und gereiftester Aus-
wahlen. Malerisch sein stärkstes ist wohl die Land-
schaft »Abend« (1319): aufragende Bäume, Wasser,
eine Häuserreihe, alles in kräftig kühnen Vereinfachungen.
Tief dringt der Farbenklang der »Flora« (1321) mit
dem dunklen Blau des Gewandes vor hellem Blau
des Himmels und dunkelgrüner Wiese. Mächtig an-
fassend wirkt die Geste der Hauptgestalt in dem
kleineren Raubritterbilde (1320). Menschlich ist uns
wohl am nächsten sein großer Karton Manesse und Had-
laub (1342) mit dem machterfüllten Bilde des sitzenden
Meister Böcklin — wie wenig eigen aber sind die
Formen in diesem Monument, wie sehr stören die
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang
1903/1904
Nr. 1. 16. Oktober.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
lagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
AUS MÜNCHENS BILDERSOMMER 1903
Von Franz Dolberg
im Juli jgo3
Die grünen stummen Kerzen der Pappeln, die
breiten Kandelaber der Kastanien ragen in die mitunter
blaue Luft, an den Tischen im Hofgarten sitzt nach-
mittags alles gedrängt und aufbruchbereite Worte wie
Herzogenstand, Fernpaß fliegen von einem zum
andern, die Zigarre, »das Stück 3 Mark«, erscheint
in den Auslagen der am sichtbarsten gelegenen Ge-
schäfte, das Straßenpflaster wird gründlich aufgerissen,
man liest von eifrigen Proben zu den mit der Etikette
»ganz wie in Bayreuth« verheißenen Darbietungen des
Wagnerwunders in einem auf öder Hochfläche ver-
borgenen Hause — und eine Armee bemalter Lein-
wände spannt sich dem möglicherweise kaufbereiten
Fremden entgegen, den das merkwürdige Großdorf
erwartet.
In halb bewußtem Gegensatze zu Berlin, wo die
Sezessionsausstellung wieder die Kostbarkeiten aller
fremden Völker in die nach allem Verschlucken doch
seltsam leer bleibende Stadt zusammenführt, freut man
sich in München diesmal mehr am Selbstgebackenen.
Gewiß, eine unter dem altmodischen Namen »Phalanx«
zusammengeschlossene Vereinigung meist fortschrittlich
elegant gerichteter Künstler — der als Maler allzu
seltene Schlittgen, Philipp Klein, der geistige Nach-
komme Beardsleys John Jack Vrieslander und einige
andere — sie räumt den besten Platz ihrer in einem
Hinterhaus der geschäftsfrohen Theatinerstraße unter-
gebrachten Ausstellung den für München fast neuen
Werken Claude Monets. Man sah bei Heinemann
eine ganze Reihe meist kleiner Werke John Constables,
der zugleich der jüngste der alten Holländer und der
älteste der modernen Engländer und Franzosen war.
Auch bot noch die Frühjahrsausstellung der Münchener
Sezession neben den sonnen- und wolkenreichen Land-
schaften Richard Kaisers, neben der schweren, breiten
Und bewegten Kraft Schramm-Zittaus, neben den dunst-
""ihüllten Frauenbildern Linda Kögels einen beherr-
di m"^611 ^aa' iener> d'e Naturwiedergabe nur als
inVincent65 M'tte' betrachtenden JunghoIländer> die
van Gogh ihren Ahn, in Jan Toorop ihren
Führer uug» iiiicn hihi, 111 jau i<j<jiu|j
er sener>- Doch in den beiden großen So
111 mer-
ausstellungen siegen deutsche und besonders Münchener
Künstler.
Das Glyptothekpendant am Königsplatz umschließt
in seinen unechten Tempelhallen Exters Damenbild-
nisse, das in Schwarz auf Weiß mit vom Boden und
verstohlen von rechts einfallendem roten Licht und
das im Ausdruck halber Trauer so große auf grünem
Grund, Herterichs Zimmerleute mit dem aus Hobel-
spähnen und Balken hervorgelockten Jubel der tausend
Farben, Habermanns müde Bacchantin mit dem siegend
in Violett und Grün funkelnden Licht des stolz ge-
beugten Nackens, von Leo Putz die Tiere umarmenden
Frauen aus tausend und einer Nacht, das in seinem
Braun und Lila und wieviel anderen Farben so erstaun-
lich starke Werk, und sonst noch vieles Deutsche, das
ganz ungewohnte Freuden bringt. In jenem ganz un-
förmlichen Bilderbahnhof, den man schonend als
»Glaspalast« bezeichnet, wirken Luitpoldgruppe und
Scholle als rettende Augenpunkte; von allem Aus-
ländischen bleiben nur die Schotten haften.
Sei mit der schwersten und ungeordnetsten Masse
begonnen. Die Warnung, im Glashaus nicht mit
Steinen zu werfen r ist wirklich nötig. Der Katalog
zählt 2171 Nummern, 74 ist die Zahl der Säle. Un-
gerechtigkeit wird so beinahe erzwungen. Der Be-
trachter kann nicht mehr den Bildern etwas tun, er
muß erzählen, was die Bilder, die sich gerade seiner
Augen bemächtigen konnten, ihm getan haben.
Lassen wir Leichenzügen den Vortritt. Hans Sand-
reuter, von dem eine reiche Schar von Werken gezeigt
wurde, steht zu sehr unter dem Schatten des Böcklin-
felsens und leidet außerdem in München unter der
Nachbarschaft der Schotten, dieser Herolde zartesten
Farbenduftes, letzter Verfeinerung und gereiftester Aus-
wahlen. Malerisch sein stärkstes ist wohl die Land-
schaft »Abend« (1319): aufragende Bäume, Wasser,
eine Häuserreihe, alles in kräftig kühnen Vereinfachungen.
Tief dringt der Farbenklang der »Flora« (1321) mit
dem dunklen Blau des Gewandes vor hellem Blau
des Himmels und dunkelgrüner Wiese. Mächtig an-
fassend wirkt die Geste der Hauptgestalt in dem
kleineren Raubritterbilde (1320). Menschlich ist uns
wohl am nächsten sein großer Karton Manesse und Had-
laub (1342) mit dem machterfüllten Bilde des sitzenden
Meister Böcklin — wie wenig eigen aber sind die
Formen in diesem Monument, wie sehr stören die