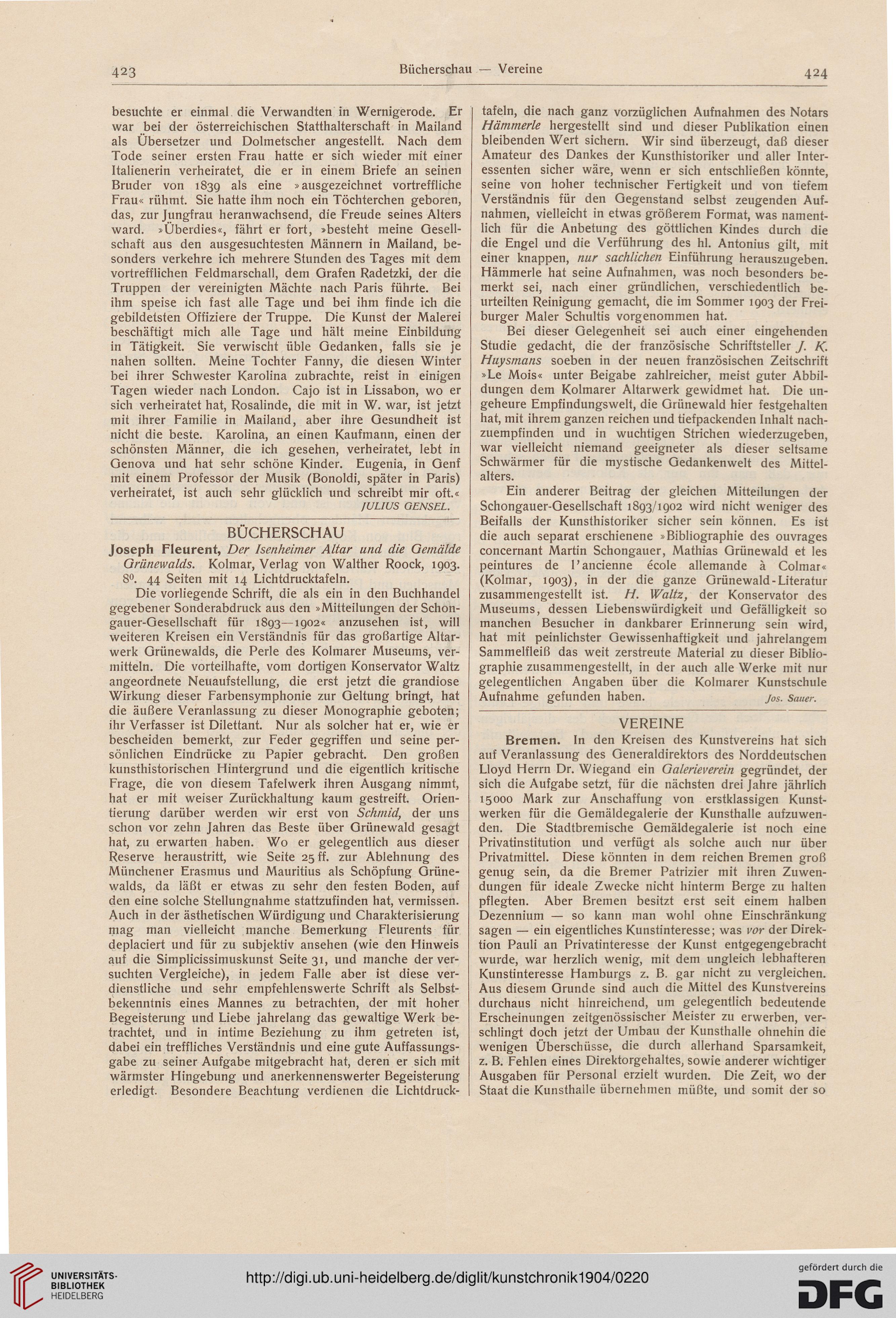423
Bücherschau — Vereine
424
besuchte er einmal die Verwandten in Wernigerode. Er
war bei der österreichischen Statthalterschaft in Mailand
als Übersetzer und Dolmetscher angestellt. Nach dem
Tode seiner ersten Frau hatte er sich wieder mit einer
Italienerin verheiratet, die er in einem Briefe an seinen
Bruder von 1839 als eine »ausgezeichnet vortreffliche
Frau« rühmt. Sie hatte ihm noch ein Töchterchen geboren,
das, zur Jungfrau heranwachsend, die Freude seines Alters
ward. »Überdies«, fährt er fort, »besteht meine Gesell-
schaft aus den ausgesuchtesten Männern in Mailand, be-
sonders verkehre ich mehrere Stunden des Tages mit dem
vortrefflichen Feldmarschall, dem Grafen Radetzki, der die
Truppen der vereinigten Mächte nach Paris führte. Bei
ihm speise ich fast alle Tage und bei ihm finde ich die
gebildetsten Offiziere der Truppe. Die Kunst der Malerei
beschäftigt mich alle Tage und hält meine Einbildung
in Tätigkeit. Sie verwischt üble Gedanken, falls sie je
nahen sollten. Meine Tochter Fanny, die diesen Winter
bei ihrer Schwester Karolina zubrachte, reist in einigen
Tagen wieder nach London. Cajo ist in Lissabon, wo er
sich verheiratet hat, Rosalinde, die mit in W. war, ist jetzt
mit ihrer Familie in Mailand, aber ihre Gesundheit ist
nicht die beste. Karolina, an einen Kaufmann, einen der
schönsten Männer, die ich gesehen, verheiratet, lebt in
Genova und hat sehr schöne Kinder. Eugenia, in Genf
mit einem Professor der Musik (Bonoldi, später in Paris)
verheiratet, ist auch sehr glücklich und schreibt mir oft.«
JULIUS OENSEL.
BÜCHERSCHAU
Joseph Fleurent, Der Isenheimer Altar und die Gemälde
Grunewalds. Kolmar, Verlag von Walther Roock, 1903.
8°. 44 Seiten mit 14 Lichtdrucktafeln.
Die vorliegende Schrift, die als ein in den Buchhandel
gegebener Sonderabdruck aus den »Mitteilungen der Schon-
gauer-Gesellschaft für 1893—1902« anzusehen ist, will
weiteren Kreisen ein Verständnis für das großartige Altar-
werk Grünewalds, die Perle des Kolmarer Museums, ver-
mitteln. Die vorteilhafte, vom dortigen Konservator Waltz
angeordnete Neuaufstellung, die erst jetzt die grandiose
Wirkung dieser Farbensymphonie zur Geltung bringt, hat
die äußere Veranlassung zu dieser Monographie geboten;
ihr Verfasser ist Dilettant. Nur als solcher hat er, wie er
bescheiden bemerkt, zur Feder gegriffen und seine per-
sönlichen Eindrücke zu Papier gebracht. Den großen
kunsthistorischen Hintergrund und die eigentlich kritische
Frage, die von diesem Tafelwerk ihren Ausgang nimmt,
hat er mit weiser Zurückhaltung kaum gestreift. Orien-
tierung darüber werden wir erst von Schmid, der uns
schon vor zehn Jahren das Beste über Grünewald gesagt
hat, zu erwarten haben. Wo er gelegentlich aus dieser
Reserve heraustritt, wie Seite 25 ff. zur Ablehnung des
Münchener Erasmus und Mauritius als Schöpfung Grüne-
walds, da läßt er etwas zu sehr den festen Boden, auf
den eine solche Stellungnahme stattzufinden hat, vermissen.
Auch in der ästhetischen Würdigung und Charakterisierung
mag man vielleicht manche Bemerkung Fleurents für
deplaciert und für zu subjektiv ansehen (wie den Hinweis
auf die Simplicissimuskunst Seite 31, und manche der ver-
suchten Vergleiche), in jedem Falle aber ist diese ver-
dienstliche und sehr empfehlenswerte Schrift als Selbst-
bekenntnis eines Mannes zu betrachten, der mit hoher
Begeisterung und Liebe jahrelang das gewaltige Werk be-
trachtet, und in intime Beziehung zu ihm getreten ist,
dabei ein treffliches Verständnis und eine gute Auffassungs-
gabe zu seiner Aufgabe mitgebracht hat, deren er sich mit
wärmster Hingebung und anerkennenswerter Begeisterung
erledigt. Besondere Beachtung verdienen die Lichtdruck-
tafeln, die nach ganz vorzüglichen Aufnahmen des Notars
Hämmerte hergestellt sind und dieser Publikation einen
bleibenden Wert sichern. Wir sind überzeugt, daß dieser
Amateur des Dankes der Kunsthistoriker und aller Inter-
essenten sicher wäre, wenn er sich entschließen könnte,
seine von hoher technischer Fertigkeit und von tiefem
Verständnis für den Gegenstand selbst zeugenden Auf-
nahmen, vielleicht in etwas größerem Format, was nament-
lich für die Anbetung des göttlichen Kindes durch die
die Engel und die Verführung des hl. Antonius gilt, mit
einer knappen, nur sachlichen Einführung herauszugeben.
Hämmerte hat seine Aufnahmen, was noch besonders be-
merkt sei, nach einer gründlichen, verschiedentlich be-
urteilten Reinigung gemacht, die im Sommer 1903 der Frei-
burger Maler Schultis vorgenommen hat.
Bei dieser Gelegenheit sei auch einer eingehenden
Studie gedacht, die der französische Schriftsteller J. f(.
Huysmans soeben in der neuen französischen Zeitschrift
»Le Mois« unter Beigabe zahlreicher, meist guter Abbil-
dungen dem Kolmarer Altarwerk gewidmet hat. Die un-
geheure Empfindungswelt, die Grünewald hier festgehalten
hat, mit ihrem ganzen reichen und tiefpackenden Inhalt nach-
zuempfinden und in wuchtigen Strichen wiederzugeben,
war vielleicht niemand geeigneter als dieser seltsame
Schwärmer für die mystische Gedankenwelt des Mittel-
alters.
Ein anderer Beitrag der gleichen Mitteilungen der
Schongauer-Gesellschaft 1893/1902 wird nicht weniger des
Beifalls der Kunsthistoriker sicher sein können. Es ist
die auch separat erschienene »Bibliographie des ouvrages
concernant Martin Schongauer, Mathias Grünewald et les
peintures de l'ancienne ecole allemande ä Colmar«
(Kolmar, 1903), in der die ganze Grünewald-Literatur
zusammengestellt ist. H. Waltz, der Konservator des
Museums, dessen Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit so
manchen Besucher in dankbarer Erinnerung sein wird,
hat mit peinlichster Gewissenhaftigkeit und jahrelangem
Sammelfleiß das weit zerstreute Material zu dieser Biblio-
graphie zusammengestellt, in der auch alle Werke mit nur
gelegentlichen Angaben über die Kolmarer Kunstschule
Aufnahme gefunden haben. jos. Sauer.
VEREINE
Bremen. In den Kreisen des Kunstvereins hat sich
auf Veranlassung des Generaldirektors des Norddeutschen
Lloyd Herrn Dr. Wiegand ein Galerieverein gegründet, der
sich die Aufgabe setzt, für die nächsten drei Jahre jährlich
15000 Mark zur Anschaffung von erstklassigen Kunst-
werken für die Gemäldegalerie der Kunsthalle aufzuwen-
den. Die Stadtbremische Gemäldegalerie ist noch eine
Privatinstitution und verfügt als solche auch nur über
Privatmittel. Diese könnten in dem reichen Bremen groß
genug sein, da die Bremer Patrizier mit ihren Zuwen-
dungen für ideale Zwecke nicht hinterm Berge zu halten
pflegten. Aber Bremen besitzt erst seit einem halben
Dezennium — so kann man wohl ohne Einschränkung
sagen — ein eigentliches Kunstinteresse; was vor der Direk-
tion Pauli an Privatinteresse der Kunst entgegengebracht
wurde, war herzlich wenig, mit dem ungleich lebhafteren
Kunstinteresse Hamburgs z. B. gar nicht zu vergleichen.
Aus diesem Grunde sind auch die Mittel des Kunstvereins
durchaus nicht hinreichend, um gelegentlich bedeutende
Erscheinungen zeitgenössischer Meister zu erwerben, ver-
schlingt doch jetzt der Umbau der Kunsthalle ohnehin die
wenigen Überschüsse, die durch allerhand Sparsamkeit,
z. B. Fehlen eines Direktorgehaltes, sowie anderer wichtiger
Ausgaben für Personal erzielt wurden. Die Zeit, wo der
Staat die Kunsthalle übernehmen müßte, und somit der so
Bücherschau — Vereine
424
besuchte er einmal die Verwandten in Wernigerode. Er
war bei der österreichischen Statthalterschaft in Mailand
als Übersetzer und Dolmetscher angestellt. Nach dem
Tode seiner ersten Frau hatte er sich wieder mit einer
Italienerin verheiratet, die er in einem Briefe an seinen
Bruder von 1839 als eine »ausgezeichnet vortreffliche
Frau« rühmt. Sie hatte ihm noch ein Töchterchen geboren,
das, zur Jungfrau heranwachsend, die Freude seines Alters
ward. »Überdies«, fährt er fort, »besteht meine Gesell-
schaft aus den ausgesuchtesten Männern in Mailand, be-
sonders verkehre ich mehrere Stunden des Tages mit dem
vortrefflichen Feldmarschall, dem Grafen Radetzki, der die
Truppen der vereinigten Mächte nach Paris führte. Bei
ihm speise ich fast alle Tage und bei ihm finde ich die
gebildetsten Offiziere der Truppe. Die Kunst der Malerei
beschäftigt mich alle Tage und hält meine Einbildung
in Tätigkeit. Sie verwischt üble Gedanken, falls sie je
nahen sollten. Meine Tochter Fanny, die diesen Winter
bei ihrer Schwester Karolina zubrachte, reist in einigen
Tagen wieder nach London. Cajo ist in Lissabon, wo er
sich verheiratet hat, Rosalinde, die mit in W. war, ist jetzt
mit ihrer Familie in Mailand, aber ihre Gesundheit ist
nicht die beste. Karolina, an einen Kaufmann, einen der
schönsten Männer, die ich gesehen, verheiratet, lebt in
Genova und hat sehr schöne Kinder. Eugenia, in Genf
mit einem Professor der Musik (Bonoldi, später in Paris)
verheiratet, ist auch sehr glücklich und schreibt mir oft.«
JULIUS OENSEL.
BÜCHERSCHAU
Joseph Fleurent, Der Isenheimer Altar und die Gemälde
Grunewalds. Kolmar, Verlag von Walther Roock, 1903.
8°. 44 Seiten mit 14 Lichtdrucktafeln.
Die vorliegende Schrift, die als ein in den Buchhandel
gegebener Sonderabdruck aus den »Mitteilungen der Schon-
gauer-Gesellschaft für 1893—1902« anzusehen ist, will
weiteren Kreisen ein Verständnis für das großartige Altar-
werk Grünewalds, die Perle des Kolmarer Museums, ver-
mitteln. Die vorteilhafte, vom dortigen Konservator Waltz
angeordnete Neuaufstellung, die erst jetzt die grandiose
Wirkung dieser Farbensymphonie zur Geltung bringt, hat
die äußere Veranlassung zu dieser Monographie geboten;
ihr Verfasser ist Dilettant. Nur als solcher hat er, wie er
bescheiden bemerkt, zur Feder gegriffen und seine per-
sönlichen Eindrücke zu Papier gebracht. Den großen
kunsthistorischen Hintergrund und die eigentlich kritische
Frage, die von diesem Tafelwerk ihren Ausgang nimmt,
hat er mit weiser Zurückhaltung kaum gestreift. Orien-
tierung darüber werden wir erst von Schmid, der uns
schon vor zehn Jahren das Beste über Grünewald gesagt
hat, zu erwarten haben. Wo er gelegentlich aus dieser
Reserve heraustritt, wie Seite 25 ff. zur Ablehnung des
Münchener Erasmus und Mauritius als Schöpfung Grüne-
walds, da läßt er etwas zu sehr den festen Boden, auf
den eine solche Stellungnahme stattzufinden hat, vermissen.
Auch in der ästhetischen Würdigung und Charakterisierung
mag man vielleicht manche Bemerkung Fleurents für
deplaciert und für zu subjektiv ansehen (wie den Hinweis
auf die Simplicissimuskunst Seite 31, und manche der ver-
suchten Vergleiche), in jedem Falle aber ist diese ver-
dienstliche und sehr empfehlenswerte Schrift als Selbst-
bekenntnis eines Mannes zu betrachten, der mit hoher
Begeisterung und Liebe jahrelang das gewaltige Werk be-
trachtet, und in intime Beziehung zu ihm getreten ist,
dabei ein treffliches Verständnis und eine gute Auffassungs-
gabe zu seiner Aufgabe mitgebracht hat, deren er sich mit
wärmster Hingebung und anerkennenswerter Begeisterung
erledigt. Besondere Beachtung verdienen die Lichtdruck-
tafeln, die nach ganz vorzüglichen Aufnahmen des Notars
Hämmerte hergestellt sind und dieser Publikation einen
bleibenden Wert sichern. Wir sind überzeugt, daß dieser
Amateur des Dankes der Kunsthistoriker und aller Inter-
essenten sicher wäre, wenn er sich entschließen könnte,
seine von hoher technischer Fertigkeit und von tiefem
Verständnis für den Gegenstand selbst zeugenden Auf-
nahmen, vielleicht in etwas größerem Format, was nament-
lich für die Anbetung des göttlichen Kindes durch die
die Engel und die Verführung des hl. Antonius gilt, mit
einer knappen, nur sachlichen Einführung herauszugeben.
Hämmerte hat seine Aufnahmen, was noch besonders be-
merkt sei, nach einer gründlichen, verschiedentlich be-
urteilten Reinigung gemacht, die im Sommer 1903 der Frei-
burger Maler Schultis vorgenommen hat.
Bei dieser Gelegenheit sei auch einer eingehenden
Studie gedacht, die der französische Schriftsteller J. f(.
Huysmans soeben in der neuen französischen Zeitschrift
»Le Mois« unter Beigabe zahlreicher, meist guter Abbil-
dungen dem Kolmarer Altarwerk gewidmet hat. Die un-
geheure Empfindungswelt, die Grünewald hier festgehalten
hat, mit ihrem ganzen reichen und tiefpackenden Inhalt nach-
zuempfinden und in wuchtigen Strichen wiederzugeben,
war vielleicht niemand geeigneter als dieser seltsame
Schwärmer für die mystische Gedankenwelt des Mittel-
alters.
Ein anderer Beitrag der gleichen Mitteilungen der
Schongauer-Gesellschaft 1893/1902 wird nicht weniger des
Beifalls der Kunsthistoriker sicher sein können. Es ist
die auch separat erschienene »Bibliographie des ouvrages
concernant Martin Schongauer, Mathias Grünewald et les
peintures de l'ancienne ecole allemande ä Colmar«
(Kolmar, 1903), in der die ganze Grünewald-Literatur
zusammengestellt ist. H. Waltz, der Konservator des
Museums, dessen Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit so
manchen Besucher in dankbarer Erinnerung sein wird,
hat mit peinlichster Gewissenhaftigkeit und jahrelangem
Sammelfleiß das weit zerstreute Material zu dieser Biblio-
graphie zusammengestellt, in der auch alle Werke mit nur
gelegentlichen Angaben über die Kolmarer Kunstschule
Aufnahme gefunden haben. jos. Sauer.
VEREINE
Bremen. In den Kreisen des Kunstvereins hat sich
auf Veranlassung des Generaldirektors des Norddeutschen
Lloyd Herrn Dr. Wiegand ein Galerieverein gegründet, der
sich die Aufgabe setzt, für die nächsten drei Jahre jährlich
15000 Mark zur Anschaffung von erstklassigen Kunst-
werken für die Gemäldegalerie der Kunsthalle aufzuwen-
den. Die Stadtbremische Gemäldegalerie ist noch eine
Privatinstitution und verfügt als solche auch nur über
Privatmittel. Diese könnten in dem reichen Bremen groß
genug sein, da die Bremer Patrizier mit ihren Zuwen-
dungen für ideale Zwecke nicht hinterm Berge zu halten
pflegten. Aber Bremen besitzt erst seit einem halben
Dezennium — so kann man wohl ohne Einschränkung
sagen — ein eigentliches Kunstinteresse; was vor der Direk-
tion Pauli an Privatinteresse der Kunst entgegengebracht
wurde, war herzlich wenig, mit dem ungleich lebhafteren
Kunstinteresse Hamburgs z. B. gar nicht zu vergleichen.
Aus diesem Grunde sind auch die Mittel des Kunstvereins
durchaus nicht hinreichend, um gelegentlich bedeutende
Erscheinungen zeitgenössischer Meister zu erwerben, ver-
schlingt doch jetzt der Umbau der Kunsthalle ohnehin die
wenigen Überschüsse, die durch allerhand Sparsamkeit,
z. B. Fehlen eines Direktorgehaltes, sowie anderer wichtiger
Ausgaben für Personal erzielt wurden. Die Zeit, wo der
Staat die Kunsthalle übernehmen müßte, und somit der so