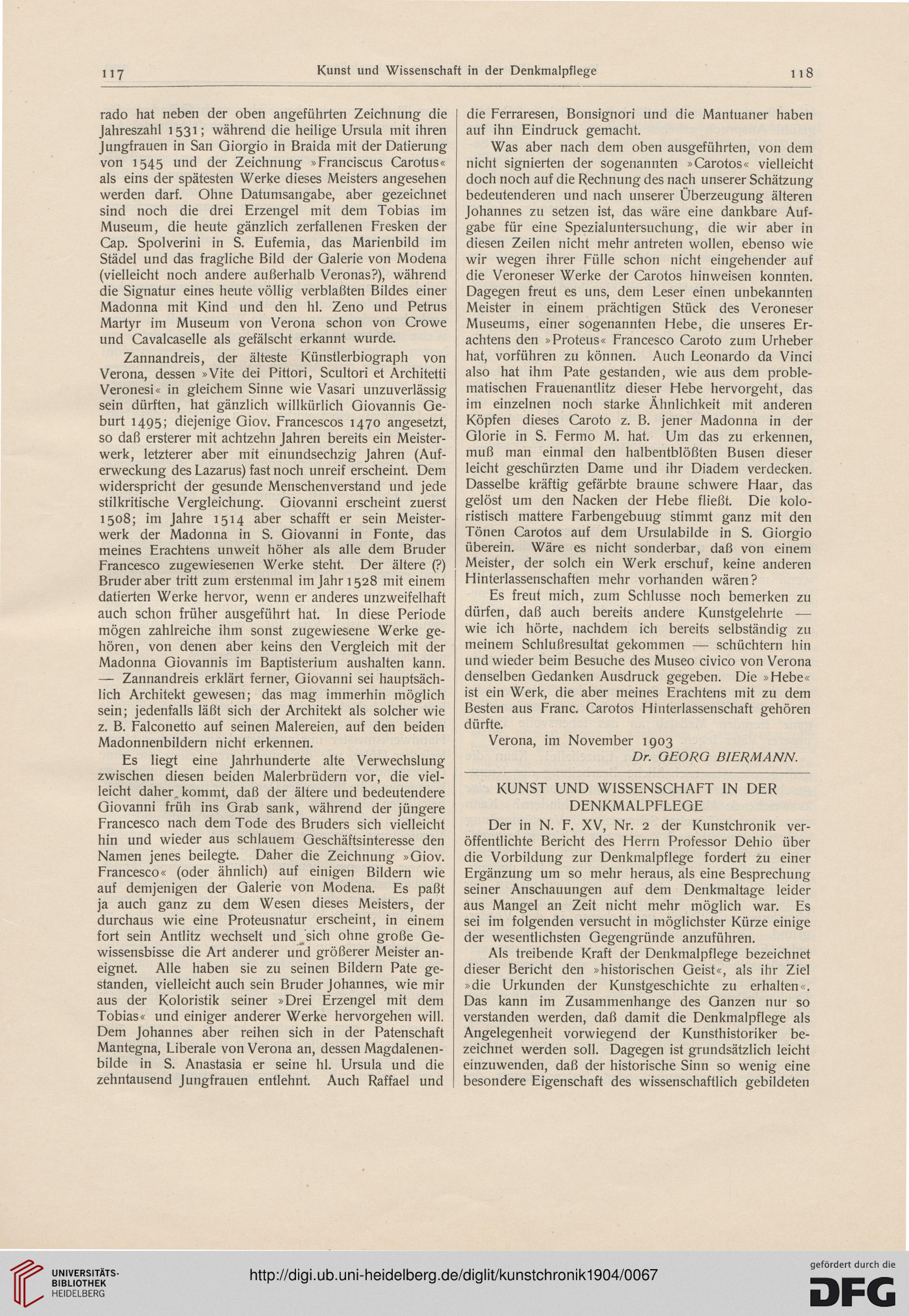117
Kunst und Wissenschaft in der Denkmalpflege
118
rado hat neben der oben angeführten Zeichnung die
Jahreszahl 1531; während die heilige Ursula mit ihren
Jungfrauen in San Giorgio in Braida mit der Datierung
von 1545 und der Zeichnung »Franciscus Carotus«
als eins der spätesten Werke dieses Meisters angesehen
werden darf. Ohne Datumsangabe, aber gezeichnet
sind noch die drei Erzengel mit dem Tobias im
Museum, die heute gänzlich zerfallenen Fresken der
Cap. Spolverini in S. Eufemia, das Marienbild im
Städel und das fragliche Bild der Galerie von Modena
(vielleicht noch andere außerhalb Veronas?), während
die Signatur eines heute völlig verblaßten Bildes einer
Madonna mit Kind und den hl. Zeno und Petrus
Martyr im Museum von Verona schon von Crowe
und Cavalcaselle als gefälscht erkannt wurde.
Zannandreis, der älteste Künstlerbiograph von
Verona, dessen »Vite dei Pittori, Scultori et Architetti
Veronesi« in gleichem Sinne wie Vasari unzuverlässig
sein dürften, hat gänzlich willkürlich Giovannis Ge-
burt 1495; diejenige Giov. Francescos 1470 angesetzt,
so daß ersterer mit achtzehn Jahren bereits ein Meister-
werk, letzterer aber mit einundsechzig Jahren (Auf-
erweckung des Lazarus) fast noch unreif erscheint. Dem
widerspricht der gesunde Menschenverstand und jede
stilkritische Vergleichung. Giovanni erscheint zuerst
1508; im Jahre 1514 aber schafft er sein Meister-
werk der Madonna in S. Giovanni in Fönte, das
meines Erachtens unweit höher als alle dem Bruder
Francesco zugewiesenen Werke steht. Der ältere (?)
Bruder aber tritt zum erstenmal im Jahr 1528 mit einem
datierten Werke hervor, wenn er anderes unzweifelhaft
auch schon früher ausgeführt hat. In diese Periode
mögen zahlreiche ihm sonst zugewiesene Werke ge-
hören, von denen aber keins den Vergleich mit der
Madonna Giovannis im Baptisterium aushalten kann.
— Zannandreis erklärt ferner, Giovanni sei hauptsäch-
lich Architekt gewesen; das mag immerhin möglich
sein; jedenfalls läßt sich der Architekt als solcher wie
z. B. Falconetto auf seinen Malereien, auf den beiden
Madonnenbildern nicht erkennen.
Es liegt eine Jahrhunderte alte Verwechslung
zwischen diesen beiden Malerbrüdern vor, die viel-
leicht daher, kommt, daß der ältere und bedeutendere
Giovanni früh ins Grab sank, während der jüngere
Francesco nach dem Tode des Bruders sich vielleicht
hin und wieder aus schlauem Geschäftsinteresse den
Namen jenes beilegte. Daher die Zeichnung »Giov.
Francesco« (oder ähnlich) auf einigen Bildern wie
auf demjenigen der Galerie von Modena. Es paßt
ja auch ganz zu dem Wesen dieses Meisters, der
durchaus wie eine Proteusnatur erscheint, in einem
fort sein Antlitz wechselt und m sich ohne große Ge-
wissensbisse die Art anderer und größerer Meister an-
eignet. Alle haben sie zu seinen Bildern Pate ge-
standen, vielleicht auch sein Bruder Johannes, wie mir
aus der Koloristik seiner »Drei Erzengel mit dem
Tobias« und einiger anderer Werke hervorgehen will.
Dem Johannes aber reihen sich in der Patenschaft
Mantegna, Liberale von Verona an, dessen Magdalenen-
bilde in S. Anastasia er seine hl. Ursula und die
zehntausend Jungfrauen entlehnt. Auch Raffael und
die Ferraresen, Bonsignori und die Mantuaner haben
auf ihn Eindruck gemacht.
Was aber nach dem oben ausgeführten, von dem
nicht signierten der sogenannten »Carotos« vielleicht
doch noch auf die Rechnung des nach unserer Schätzung
bedeutenderen und nach unserer Überzeugung älteren
Johannes zu setzen ist, das wäre eine dankbare Auf-
gabe für eine Spezialuntersuchung, die wir aber in
diesen Zeilen nicht mehr antreten wollen, ebenso wie
wir wegen ihrer Fülle schon nicht eingehender auf
die Veroneser Werke der Carotos hinweisen konnten.
Dagegen freut es uns, dem Leser einen unbekannten
Meister in einem prächtigen Stück des Veroneser
Museums, einer sogenannten Hebe, die unseres Er-
achtens den »Proteus« Francesco Caroto zum Urheber
hat, vorführen zu können. Auch Leonardo da Vinci
also hat ihm Pate gestanden, wie aus dem proble-
matischen Frauenantlitz dieser Hebe hervorgeht, das
im einzelnen noch starke Ähnlichkeit mit anderen
Köpfen dieses Caroto z. B. jener Madonna in der
Glorie in S. Fermo M. hat. Um das zu erkennen,
muß man einmal den halbentblößten Busen dieser
leicht geschürzten Dame und ihr Diadem verdecken.
Dasselbe kräftig gefärbte braune schwere Haar, das
gelöst um den Nacken der Hebe fließt. Die kolo-
ristisch mattere Farbengebuug stimmt ganz mit den
Tönen Carotos auf dem Ursulabilde in S. Giorgio
überein. Wäre es nicht sonderbar, daß von einem
Meister, der solch ein Werk erschuf, keine anderen
Hinterlassenschaften mehr vorhanden wären?
Es freut mich, zum Schlüsse noch bemerken zu
dürfen, daß auch bereits andere Kunstgelehrte —
wie ich hörte, nachdem ich bereits selbständig zu
meinem Schlußresultat gekommen — schüchtern hin
und wieder beim Besuche des Museo civico von Verona
denselben Gedanken Ausdruck gegeben. Die »Hebe«
ist ein Werk, die aber meines Erachtens mit zu dem
Besten aus Franc. Carotos Hinterlassenschaft gehören
dürfte.
Verona, im November 1903
Dr. GEORG BIERMANN.
KUNST UND WISSENSCHAFT IN DER
DENKMALPFLEGE
Der in N. F. XV, Nr. 2 der Kunstchronik ver-
öffentlichte Bericht des Herrn Professor Dehio über
die Vorbildung zur Denkmalpflege fordert zu einer
Ergänzung um so mehr heraus, als eine Besprechung
seiner Anschauungen auf dem Denkmaltage leider
aus Mangel an Zeit nicht mehr möglich war. Es
sei im folgenden versucht in möglichster Kürze einige
der wesentlichsten Gegengründe anzuführen.
Als treibende Kraft der Denkmalpflege bezeichnet
dieser Bericht den »historischen Geist«, als ihr Ziel
»die Urkunden der Kunstgeschichte zu erhalten«.
Das kann im Zusammenhange des Ganzen nur so
verstanden werden, daß damit die Denkmalpflege als
Angelegenheit vorwiegend der Kunsthistoriker be-
zeichnet werden soll. Dagegen ist grundsätzlich leicht
einzuwenden, daß der historische Sinn so wenig eine
besondere Eigenschaft des wissenschaftlich gebildeten
Kunst und Wissenschaft in der Denkmalpflege
118
rado hat neben der oben angeführten Zeichnung die
Jahreszahl 1531; während die heilige Ursula mit ihren
Jungfrauen in San Giorgio in Braida mit der Datierung
von 1545 und der Zeichnung »Franciscus Carotus«
als eins der spätesten Werke dieses Meisters angesehen
werden darf. Ohne Datumsangabe, aber gezeichnet
sind noch die drei Erzengel mit dem Tobias im
Museum, die heute gänzlich zerfallenen Fresken der
Cap. Spolverini in S. Eufemia, das Marienbild im
Städel und das fragliche Bild der Galerie von Modena
(vielleicht noch andere außerhalb Veronas?), während
die Signatur eines heute völlig verblaßten Bildes einer
Madonna mit Kind und den hl. Zeno und Petrus
Martyr im Museum von Verona schon von Crowe
und Cavalcaselle als gefälscht erkannt wurde.
Zannandreis, der älteste Künstlerbiograph von
Verona, dessen »Vite dei Pittori, Scultori et Architetti
Veronesi« in gleichem Sinne wie Vasari unzuverlässig
sein dürften, hat gänzlich willkürlich Giovannis Ge-
burt 1495; diejenige Giov. Francescos 1470 angesetzt,
so daß ersterer mit achtzehn Jahren bereits ein Meister-
werk, letzterer aber mit einundsechzig Jahren (Auf-
erweckung des Lazarus) fast noch unreif erscheint. Dem
widerspricht der gesunde Menschenverstand und jede
stilkritische Vergleichung. Giovanni erscheint zuerst
1508; im Jahre 1514 aber schafft er sein Meister-
werk der Madonna in S. Giovanni in Fönte, das
meines Erachtens unweit höher als alle dem Bruder
Francesco zugewiesenen Werke steht. Der ältere (?)
Bruder aber tritt zum erstenmal im Jahr 1528 mit einem
datierten Werke hervor, wenn er anderes unzweifelhaft
auch schon früher ausgeführt hat. In diese Periode
mögen zahlreiche ihm sonst zugewiesene Werke ge-
hören, von denen aber keins den Vergleich mit der
Madonna Giovannis im Baptisterium aushalten kann.
— Zannandreis erklärt ferner, Giovanni sei hauptsäch-
lich Architekt gewesen; das mag immerhin möglich
sein; jedenfalls läßt sich der Architekt als solcher wie
z. B. Falconetto auf seinen Malereien, auf den beiden
Madonnenbildern nicht erkennen.
Es liegt eine Jahrhunderte alte Verwechslung
zwischen diesen beiden Malerbrüdern vor, die viel-
leicht daher, kommt, daß der ältere und bedeutendere
Giovanni früh ins Grab sank, während der jüngere
Francesco nach dem Tode des Bruders sich vielleicht
hin und wieder aus schlauem Geschäftsinteresse den
Namen jenes beilegte. Daher die Zeichnung »Giov.
Francesco« (oder ähnlich) auf einigen Bildern wie
auf demjenigen der Galerie von Modena. Es paßt
ja auch ganz zu dem Wesen dieses Meisters, der
durchaus wie eine Proteusnatur erscheint, in einem
fort sein Antlitz wechselt und m sich ohne große Ge-
wissensbisse die Art anderer und größerer Meister an-
eignet. Alle haben sie zu seinen Bildern Pate ge-
standen, vielleicht auch sein Bruder Johannes, wie mir
aus der Koloristik seiner »Drei Erzengel mit dem
Tobias« und einiger anderer Werke hervorgehen will.
Dem Johannes aber reihen sich in der Patenschaft
Mantegna, Liberale von Verona an, dessen Magdalenen-
bilde in S. Anastasia er seine hl. Ursula und die
zehntausend Jungfrauen entlehnt. Auch Raffael und
die Ferraresen, Bonsignori und die Mantuaner haben
auf ihn Eindruck gemacht.
Was aber nach dem oben ausgeführten, von dem
nicht signierten der sogenannten »Carotos« vielleicht
doch noch auf die Rechnung des nach unserer Schätzung
bedeutenderen und nach unserer Überzeugung älteren
Johannes zu setzen ist, das wäre eine dankbare Auf-
gabe für eine Spezialuntersuchung, die wir aber in
diesen Zeilen nicht mehr antreten wollen, ebenso wie
wir wegen ihrer Fülle schon nicht eingehender auf
die Veroneser Werke der Carotos hinweisen konnten.
Dagegen freut es uns, dem Leser einen unbekannten
Meister in einem prächtigen Stück des Veroneser
Museums, einer sogenannten Hebe, die unseres Er-
achtens den »Proteus« Francesco Caroto zum Urheber
hat, vorführen zu können. Auch Leonardo da Vinci
also hat ihm Pate gestanden, wie aus dem proble-
matischen Frauenantlitz dieser Hebe hervorgeht, das
im einzelnen noch starke Ähnlichkeit mit anderen
Köpfen dieses Caroto z. B. jener Madonna in der
Glorie in S. Fermo M. hat. Um das zu erkennen,
muß man einmal den halbentblößten Busen dieser
leicht geschürzten Dame und ihr Diadem verdecken.
Dasselbe kräftig gefärbte braune schwere Haar, das
gelöst um den Nacken der Hebe fließt. Die kolo-
ristisch mattere Farbengebuug stimmt ganz mit den
Tönen Carotos auf dem Ursulabilde in S. Giorgio
überein. Wäre es nicht sonderbar, daß von einem
Meister, der solch ein Werk erschuf, keine anderen
Hinterlassenschaften mehr vorhanden wären?
Es freut mich, zum Schlüsse noch bemerken zu
dürfen, daß auch bereits andere Kunstgelehrte —
wie ich hörte, nachdem ich bereits selbständig zu
meinem Schlußresultat gekommen — schüchtern hin
und wieder beim Besuche des Museo civico von Verona
denselben Gedanken Ausdruck gegeben. Die »Hebe«
ist ein Werk, die aber meines Erachtens mit zu dem
Besten aus Franc. Carotos Hinterlassenschaft gehören
dürfte.
Verona, im November 1903
Dr. GEORG BIERMANN.
KUNST UND WISSENSCHAFT IN DER
DENKMALPFLEGE
Der in N. F. XV, Nr. 2 der Kunstchronik ver-
öffentlichte Bericht des Herrn Professor Dehio über
die Vorbildung zur Denkmalpflege fordert zu einer
Ergänzung um so mehr heraus, als eine Besprechung
seiner Anschauungen auf dem Denkmaltage leider
aus Mangel an Zeit nicht mehr möglich war. Es
sei im folgenden versucht in möglichster Kürze einige
der wesentlichsten Gegengründe anzuführen.
Als treibende Kraft der Denkmalpflege bezeichnet
dieser Bericht den »historischen Geist«, als ihr Ziel
»die Urkunden der Kunstgeschichte zu erhalten«.
Das kann im Zusammenhange des Ganzen nur so
verstanden werden, daß damit die Denkmalpflege als
Angelegenheit vorwiegend der Kunsthistoriker be-
zeichnet werden soll. Dagegen ist grundsätzlich leicht
einzuwenden, daß der historische Sinn so wenig eine
besondere Eigenschaft des wissenschaftlich gebildeten