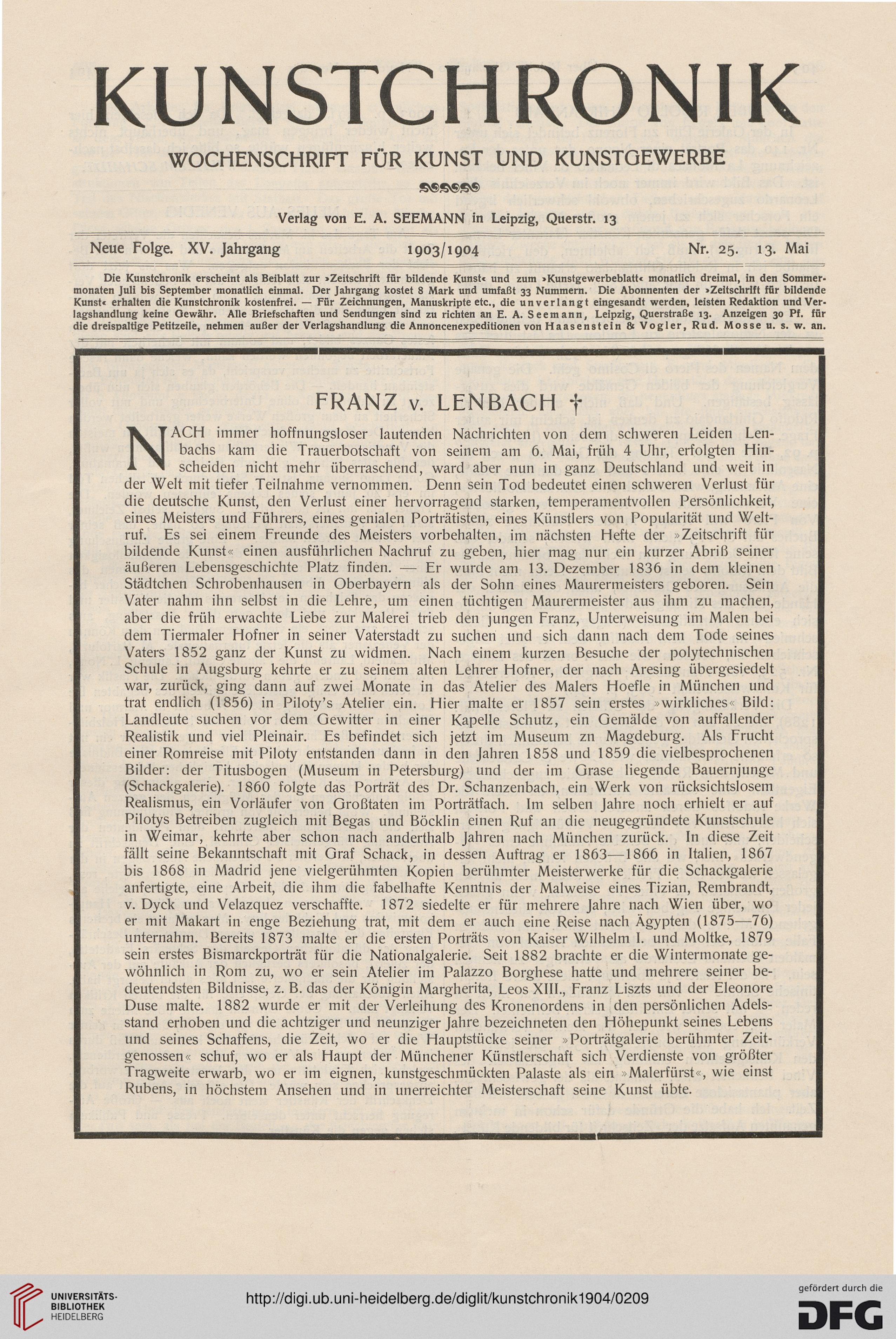KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang 1903/1904 Nr. 25. 13. Mai
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst< und zum >Kunstgewerbeblatt< monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
lagshandlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein 81 Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
FRANZ v. LENBACH f
NACH immer hoffnungsloser lautenden Nachrichten von dem schweren Leiden Len-
nachs kam die Trauerbotschaft von seinem am 6. Mai, früh 4 Uhr, erfolgten Hin-
scheiden nicht mehr überraschend, ward aber nun in ganz Deutschland und weit in
der Welt mit tiefer Teilnahme vernommen. Denn sein Tod bedeutet einen schweren Verlust für
die deutsche Kunst, den Verlust einer hervorragend starken, temperamentvollen Persönlichkeit,
eines Meisters und Führers, eines genialen Porträtisten, eines Künstlers von Popularität und Welt-
ruf. Es sei einem Freunde des Meisters vorbehalten, im nächsten Hefte der »Zeitschrift für
bildende Kunst« einen ausführlichen Nachruf zu geben, hier mag nur ein kurzer Abriß seiner
äußeren Lebensgeschichte Platz finden. — Er wurde am 13. Dezember 1836 in dem kleinen
Städtchen Schrobenhausen in Oberbayern als der Sohn eines Maurermeisters geboren. Sein
Vater nahm ihn selbst in die Lehre, um einen tüchtigen Maurermeister aus ihm zu machen,
aber die früh erwachte Liebe zur Malerei trieb den jungen Franz, Unterweisung im Malen bei
dem Tiermaler Hofner in seiner Vaterstadt zu suchen und sich dann nach dem Tode seines
Vaters 1852 ganz der Kunst zu widmen. Nach einem kurzen Besuche der polytechnischen
Schule in Augsburg kehrte er zu seinem alten Lehrer Hofner, der nach Aresing übergesiedelt
war, zurück, ging dann auf zwei Monate in das Atelier des Malers Hoefle in München und
trat endlich (1856) in Piloty's Atelier ein. Hier malte er 1857 sein erstes »wirkliches« Bild:
Landleute suchen vor dem Gewitter in einer Kapelle Schutz, ein Gemälde von auffallender
Realistik und viel Pleinair. Es befindet sich jetzt im Museum zn Magdeburg. Als Frucht
einer Romreise mit Piloty entstanden dann in den Jahren 1858 und 1859 die vielbesprochenen
Bilder: der Titusbogen (Museum in Petersburg) und der im Grase liegende Bauernjunge
(Schackgalerie). 1860 folgte das Porträt des Dr. Schanzenbach, ein Werk von rücksichtslosem
Realismus, ein Vorläufer von Großtaten im Porträtfach. Im selben Jahre noch erhielt er auf
Pilotys Betreiben zugleich mit Begas und Böcklin einen Ruf an die neugegründete Kunstschule
in Weimar, kehrte aber schon nach anderthalb Jahren nach München zurück. In diese Zeit
fällt seine Bekanntschaft mit Graf Schack, in dessen Auftrag er 1863—1866 in Italien, 1867
bis 1868 in Madrid jene vielgerühmten Kopien berühmter Meisterwerke für die Schackgalerie
anfertigte, eine Arbeit, die ihm die fabelhafte Kenntnis der Malweise eines Tizian, Rembrandt,
v. Dyck und Velazquez verschaffte. 1872 siedelte er für mehrere Jahre nach Wien über, wo
er mit Makart in enge Beziehung trat, mit dem er auch eine Reise nach Ägypten (1875—76)
unternahm. Bereits 1873 malte er die ersten Porträts von Kaiser Wilhelm I. und Moltke, 1879
sein erstes Bismarckporträt für die Nationalgalerie. Seit 1882 brachte er die Wintermonate ge-
wöhnlich in Rom zu, wo er sein Atelier im Palazzo Borghese hatte und mehrere seiner be-
deutendsten Bildnisse, z. B. das der Königin Margherita, Leos XIII., Franz Liszts und der Eleonore
Duse malte. 1882 wurde er mit der Verleihung des Kronenordens in den persönlichen Adels-
stand erhoben und die achtziger und neunziger Jahre bezeichneten den Höhepunkt seines Lebens
und seines Schaffens, die Zeit, wo er die Hauptstücke seiner »»Porträtgalerie berühmter Zeit-
genossen« schuf, wo er als Haupt der Münchener Künstlerschaft sich Verdienste von größter
Tragweite erwarb, wo er im eignen, kunstgeschmückten Palaste als ein »Malerfürst«, wie einst
Rubens, in höchstem Ansehen und in unerreichter Meisterschaft seine Kunst übte.
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang 1903/1904 Nr. 25. 13. Mai
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst< und zum >Kunstgewerbeblatt< monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
lagshandlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein 81 Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
FRANZ v. LENBACH f
NACH immer hoffnungsloser lautenden Nachrichten von dem schweren Leiden Len-
nachs kam die Trauerbotschaft von seinem am 6. Mai, früh 4 Uhr, erfolgten Hin-
scheiden nicht mehr überraschend, ward aber nun in ganz Deutschland und weit in
der Welt mit tiefer Teilnahme vernommen. Denn sein Tod bedeutet einen schweren Verlust für
die deutsche Kunst, den Verlust einer hervorragend starken, temperamentvollen Persönlichkeit,
eines Meisters und Führers, eines genialen Porträtisten, eines Künstlers von Popularität und Welt-
ruf. Es sei einem Freunde des Meisters vorbehalten, im nächsten Hefte der »Zeitschrift für
bildende Kunst« einen ausführlichen Nachruf zu geben, hier mag nur ein kurzer Abriß seiner
äußeren Lebensgeschichte Platz finden. — Er wurde am 13. Dezember 1836 in dem kleinen
Städtchen Schrobenhausen in Oberbayern als der Sohn eines Maurermeisters geboren. Sein
Vater nahm ihn selbst in die Lehre, um einen tüchtigen Maurermeister aus ihm zu machen,
aber die früh erwachte Liebe zur Malerei trieb den jungen Franz, Unterweisung im Malen bei
dem Tiermaler Hofner in seiner Vaterstadt zu suchen und sich dann nach dem Tode seines
Vaters 1852 ganz der Kunst zu widmen. Nach einem kurzen Besuche der polytechnischen
Schule in Augsburg kehrte er zu seinem alten Lehrer Hofner, der nach Aresing übergesiedelt
war, zurück, ging dann auf zwei Monate in das Atelier des Malers Hoefle in München und
trat endlich (1856) in Piloty's Atelier ein. Hier malte er 1857 sein erstes »wirkliches« Bild:
Landleute suchen vor dem Gewitter in einer Kapelle Schutz, ein Gemälde von auffallender
Realistik und viel Pleinair. Es befindet sich jetzt im Museum zn Magdeburg. Als Frucht
einer Romreise mit Piloty entstanden dann in den Jahren 1858 und 1859 die vielbesprochenen
Bilder: der Titusbogen (Museum in Petersburg) und der im Grase liegende Bauernjunge
(Schackgalerie). 1860 folgte das Porträt des Dr. Schanzenbach, ein Werk von rücksichtslosem
Realismus, ein Vorläufer von Großtaten im Porträtfach. Im selben Jahre noch erhielt er auf
Pilotys Betreiben zugleich mit Begas und Böcklin einen Ruf an die neugegründete Kunstschule
in Weimar, kehrte aber schon nach anderthalb Jahren nach München zurück. In diese Zeit
fällt seine Bekanntschaft mit Graf Schack, in dessen Auftrag er 1863—1866 in Italien, 1867
bis 1868 in Madrid jene vielgerühmten Kopien berühmter Meisterwerke für die Schackgalerie
anfertigte, eine Arbeit, die ihm die fabelhafte Kenntnis der Malweise eines Tizian, Rembrandt,
v. Dyck und Velazquez verschaffte. 1872 siedelte er für mehrere Jahre nach Wien über, wo
er mit Makart in enge Beziehung trat, mit dem er auch eine Reise nach Ägypten (1875—76)
unternahm. Bereits 1873 malte er die ersten Porträts von Kaiser Wilhelm I. und Moltke, 1879
sein erstes Bismarckporträt für die Nationalgalerie. Seit 1882 brachte er die Wintermonate ge-
wöhnlich in Rom zu, wo er sein Atelier im Palazzo Borghese hatte und mehrere seiner be-
deutendsten Bildnisse, z. B. das der Königin Margherita, Leos XIII., Franz Liszts und der Eleonore
Duse malte. 1882 wurde er mit der Verleihung des Kronenordens in den persönlichen Adels-
stand erhoben und die achtziger und neunziger Jahre bezeichneten den Höhepunkt seines Lebens
und seines Schaffens, die Zeit, wo er die Hauptstücke seiner »»Porträtgalerie berühmter Zeit-
genossen« schuf, wo er als Haupt der Münchener Künstlerschaft sich Verdienste von größter
Tragweite erwarb, wo er im eignen, kunstgeschmückten Palaste als ein »Malerfürst«, wie einst
Rubens, in höchstem Ansehen und in unerreichter Meisterschaft seine Kunst übte.