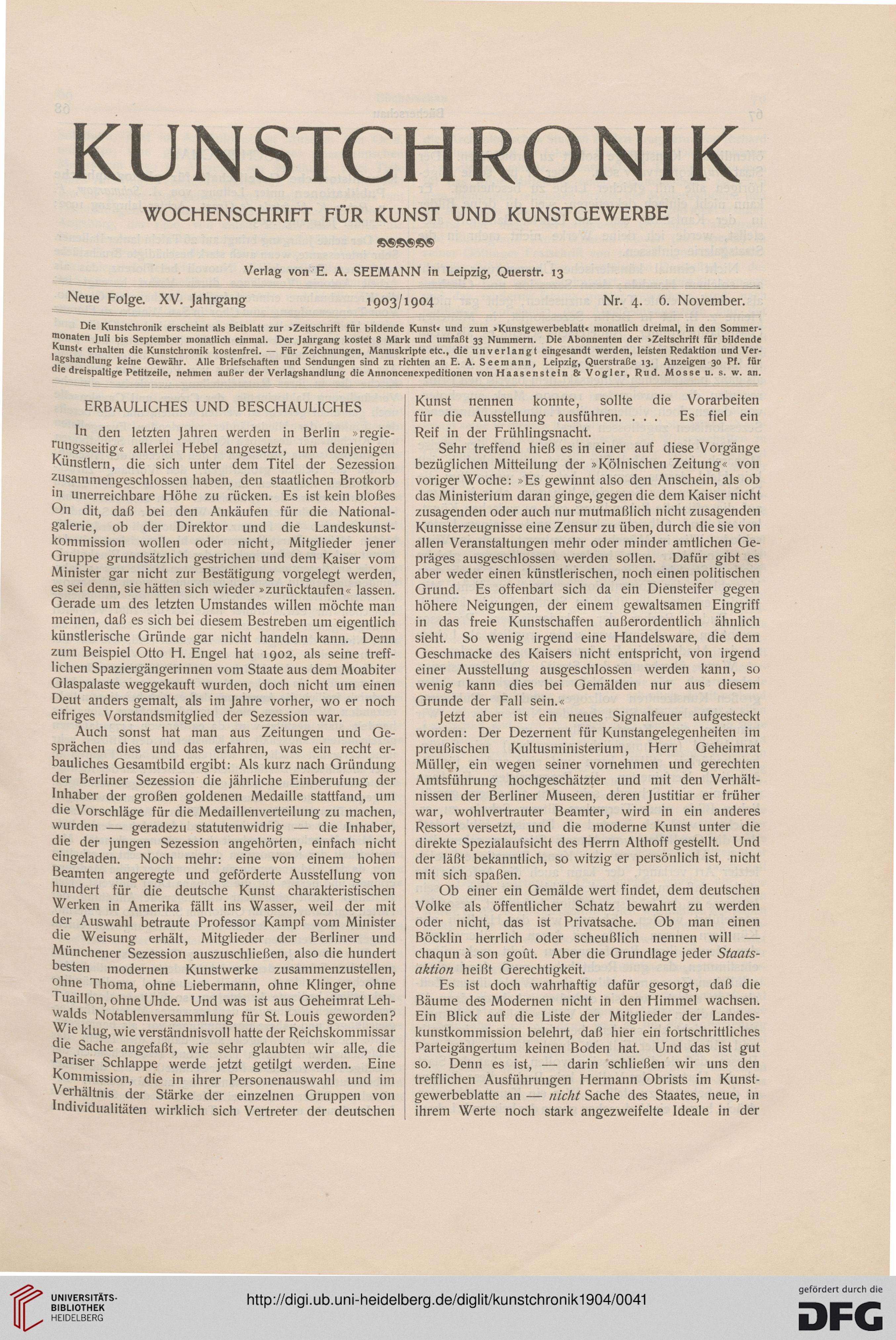KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang 1903/1904 Nr. 4. 6. November.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst« und zum >Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
m°naten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
Jägshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
O'e dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haas enstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
ERBAULICHES UNO BESCHAULICHES
In den letzten Jahren werden in Berlin »regie-
rungsseitig« allerlei Hebel angesetzt, um denjenigen
Künstlern, die sich unter dem Titel der Sezession
zusammengeschlossen haben, den staatlichen Brotkorb
■n unerreichbare Höhe zu rücken. Es ist kein bloßes
On dit, daß bei den Ankäufen für die National-
galerie, ob der Direktor und die Landeskunst-
kommission wollen oder nicht, Mitglieder jener
Gruppe grundsätzlich gestrichen und dem Kaiser vom
Minister gar nicht zur Bestätigung vorgelegt werden,
es sei denn, sie hätten sich wieder »zurücktaufen« lassen.
Oerade um des letzten Umstandes willen möchte man
meinen, daß es sich bei diesem Bestreben um eigentlich
künstlerische Gründe gar nicht handeln kann. Denn
zum Beispiel Otto H. Engel hat 1902, als seine treff-
lichen Spaziergängerinnen vom Staate aus dem Moabiter
Glaspalaste weggekauft wurden, doch nicht um einen
Deut anders gemalt, als im Jahre vorher, wo er noch
eifriges Vorstandsmitglied der Sezession war.
Auch sonst hat man aus Zeitungen und Ge-
sprächen dies und das erfahren, was ein recht er-
bauliches Gesamtbild ergibt: Als kurz nach Gründung
der Berliner Sezession die jährliche Einberufung der
Inhaber der großen goldenen Medaille stattfand, um
die Vorschläge für die Medaillenverteilung zu machen,
wurden — geradezu statutenwidrig — die Inhaber,
die der jungen Sezession angehörten, einfach nicht
eingeladen. Noch mehr: eine von einem hohen
Beamten angeregte und geförderte Ausstellung von
hundert für die deutsche Kunst charakteristischen
Werken in Amerika fällt ins Wasser, weil der mit
der Auswahl betraute Professor Kampf vom Minister
die Weisung erhält, Mitglieder der Berliner und
Münchener Sezession auszuschließen, also die hundert
besten modernen Kunstwerke zusammenzustellen,
ohne Thoma, ohne Liebermann, ohne Klinger, ohne
Tuaillon, ohne Uhde. Und was ist aus Geheimrat Leh-
walds Notablenversammlung für St. Louis geworden?
Wie klug, wie verständnisvoll hatte der Reichskommissar
die Sache angefaßt, wie sehr glaubten wir alle, die
Pariser Schlappe werde jetzt getilgt werden. Eine
Konimission, die in ihrer Personenauswahl und im
Verhältnis der Stärke der einzelnen Gruppen von
Individualitäten wirklich sich Vertreter der deutschen
Kunst nennen konnte, sollte die Vorarbeiten
für die Ausstellung ausführen. ... Es fiel ein
Reif in der Frühlingsnacht.
Sehr treffend hieß es in einer auf diese Vorgänge
bezüglichen Mitteilung der »Kölnischen Zeitung« von
voriger Woche: »Es gewinnt also den Anschein, als ob
das Ministerium daran ginge, gegen die dem Kaiser nicht
zusagenden oder auch nur mutmaßlich nicht zusagenden
Kunsterzeugnisse eine Zensur zu üben, durch die sie von
allen Veranstaltungen mehr oder minder amtlichen Ge-
präges ausgeschlossen werden sollen. Dafür gibt es
aber weder einen künstlerischen, noch einen politischen
Grund. Es offenbart sich da ein Diensteifer gegen
höhere Neigungen, der einem gewaltsamen Eingriff
in das freie Kunstschaffen außerordentlich ähnlich
sieht. So wenig irgend eine Handelsware, die dem
Geschmacke des Kaisers nicht entspricht, von irgend
einer Ausstellung ausgeschlossen werden kann, so
wenig kann dies bei Gemälden nur aus diesem
Grunde der Fall sein.«
Jetzt aber ist ein neues Signalfeuer aufgesteckt
worden: Der Dezernent für Kunstangelegenheiten im
preußischen Kultusministerium, Herr Geheimrat
Müller, ein wegen seiner vornehmen und gerechten
Amtsführung hochgeschätzter und mit den Verhält-
nissen der Berliner Museen, deren Justitiar er früher
war, wohlvertrauter Beamter, wird in ein anderes
Ressort versetzt, und die moderne Kunst unter die
direkte Spezialaufsicht des Herrn Althoff gestellt. Und
der läßt bekanntlich, so witzig er persönlich ist, nicht
mit sich spaßen.
Ob einer ein Gemälde wert findet, dem deutschen
Volke als öffentlicher Schatz bewahrt zu werden
oder nicht, das ist Privatsache. Ob man einen
Böcklin herrlich oder scheußlich nennen will —
chaqun ä son goüt. Aber die Grundlage jeder Staats-
aktion heißt Gerechtigkeit.
Es ist doch wahrhaftig dafür gesorgt, daß die
Bäume des Modernen nicht in den Himmel wachsen.
Ein Blick auf die Liste der Mitglieder der Landes-
kunstkommission belehrt, daß hier ein fortschrittliches
Parteigängertum keinen Boden hat. Und das ist gut
so. Denn es ist, — darin schließen wir uns den
trefflichen Ausführungen Hermann Obrists im Kunst-
gewerbeblatte an — nicht Sache des Staates, neue, in
ihrem Werte noch stark angezweifelte Ideale in der
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang 1903/1904 Nr. 4. 6. November.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst« und zum >Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
m°naten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
Jägshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
O'e dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haas enstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
ERBAULICHES UNO BESCHAULICHES
In den letzten Jahren werden in Berlin »regie-
rungsseitig« allerlei Hebel angesetzt, um denjenigen
Künstlern, die sich unter dem Titel der Sezession
zusammengeschlossen haben, den staatlichen Brotkorb
■n unerreichbare Höhe zu rücken. Es ist kein bloßes
On dit, daß bei den Ankäufen für die National-
galerie, ob der Direktor und die Landeskunst-
kommission wollen oder nicht, Mitglieder jener
Gruppe grundsätzlich gestrichen und dem Kaiser vom
Minister gar nicht zur Bestätigung vorgelegt werden,
es sei denn, sie hätten sich wieder »zurücktaufen« lassen.
Oerade um des letzten Umstandes willen möchte man
meinen, daß es sich bei diesem Bestreben um eigentlich
künstlerische Gründe gar nicht handeln kann. Denn
zum Beispiel Otto H. Engel hat 1902, als seine treff-
lichen Spaziergängerinnen vom Staate aus dem Moabiter
Glaspalaste weggekauft wurden, doch nicht um einen
Deut anders gemalt, als im Jahre vorher, wo er noch
eifriges Vorstandsmitglied der Sezession war.
Auch sonst hat man aus Zeitungen und Ge-
sprächen dies und das erfahren, was ein recht er-
bauliches Gesamtbild ergibt: Als kurz nach Gründung
der Berliner Sezession die jährliche Einberufung der
Inhaber der großen goldenen Medaille stattfand, um
die Vorschläge für die Medaillenverteilung zu machen,
wurden — geradezu statutenwidrig — die Inhaber,
die der jungen Sezession angehörten, einfach nicht
eingeladen. Noch mehr: eine von einem hohen
Beamten angeregte und geförderte Ausstellung von
hundert für die deutsche Kunst charakteristischen
Werken in Amerika fällt ins Wasser, weil der mit
der Auswahl betraute Professor Kampf vom Minister
die Weisung erhält, Mitglieder der Berliner und
Münchener Sezession auszuschließen, also die hundert
besten modernen Kunstwerke zusammenzustellen,
ohne Thoma, ohne Liebermann, ohne Klinger, ohne
Tuaillon, ohne Uhde. Und was ist aus Geheimrat Leh-
walds Notablenversammlung für St. Louis geworden?
Wie klug, wie verständnisvoll hatte der Reichskommissar
die Sache angefaßt, wie sehr glaubten wir alle, die
Pariser Schlappe werde jetzt getilgt werden. Eine
Konimission, die in ihrer Personenauswahl und im
Verhältnis der Stärke der einzelnen Gruppen von
Individualitäten wirklich sich Vertreter der deutschen
Kunst nennen konnte, sollte die Vorarbeiten
für die Ausstellung ausführen. ... Es fiel ein
Reif in der Frühlingsnacht.
Sehr treffend hieß es in einer auf diese Vorgänge
bezüglichen Mitteilung der »Kölnischen Zeitung« von
voriger Woche: »Es gewinnt also den Anschein, als ob
das Ministerium daran ginge, gegen die dem Kaiser nicht
zusagenden oder auch nur mutmaßlich nicht zusagenden
Kunsterzeugnisse eine Zensur zu üben, durch die sie von
allen Veranstaltungen mehr oder minder amtlichen Ge-
präges ausgeschlossen werden sollen. Dafür gibt es
aber weder einen künstlerischen, noch einen politischen
Grund. Es offenbart sich da ein Diensteifer gegen
höhere Neigungen, der einem gewaltsamen Eingriff
in das freie Kunstschaffen außerordentlich ähnlich
sieht. So wenig irgend eine Handelsware, die dem
Geschmacke des Kaisers nicht entspricht, von irgend
einer Ausstellung ausgeschlossen werden kann, so
wenig kann dies bei Gemälden nur aus diesem
Grunde der Fall sein.«
Jetzt aber ist ein neues Signalfeuer aufgesteckt
worden: Der Dezernent für Kunstangelegenheiten im
preußischen Kultusministerium, Herr Geheimrat
Müller, ein wegen seiner vornehmen und gerechten
Amtsführung hochgeschätzter und mit den Verhält-
nissen der Berliner Museen, deren Justitiar er früher
war, wohlvertrauter Beamter, wird in ein anderes
Ressort versetzt, und die moderne Kunst unter die
direkte Spezialaufsicht des Herrn Althoff gestellt. Und
der läßt bekanntlich, so witzig er persönlich ist, nicht
mit sich spaßen.
Ob einer ein Gemälde wert findet, dem deutschen
Volke als öffentlicher Schatz bewahrt zu werden
oder nicht, das ist Privatsache. Ob man einen
Böcklin herrlich oder scheußlich nennen will —
chaqun ä son goüt. Aber die Grundlage jeder Staats-
aktion heißt Gerechtigkeit.
Es ist doch wahrhaftig dafür gesorgt, daß die
Bäume des Modernen nicht in den Himmel wachsen.
Ein Blick auf die Liste der Mitglieder der Landes-
kunstkommission belehrt, daß hier ein fortschrittliches
Parteigängertum keinen Boden hat. Und das ist gut
so. Denn es ist, — darin schließen wir uns den
trefflichen Ausführungen Hermann Obrists im Kunst-
gewerbeblatte an — nicht Sache des Staates, neue, in
ihrem Werte noch stark angezweifelte Ideale in der