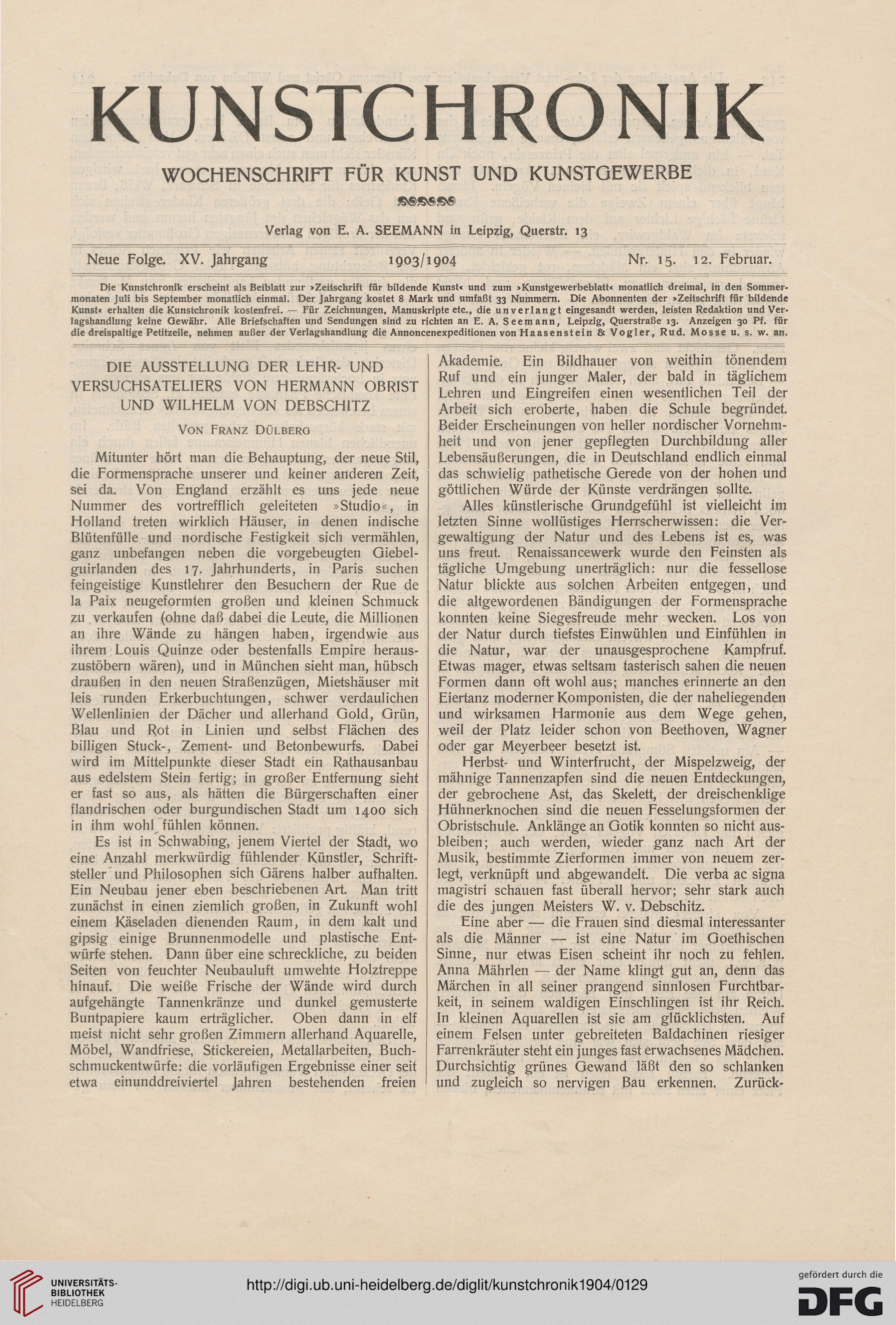KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang 1903/1904 Nr. 15. 12. Februar.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
lagshandlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haas enstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
DIE AUSSTELLUNG DER LEHR- UND
VERSUCHSATELIERS VON HERMANN OBRIST
UND WILHELM VON DEBSCHITZ
Von Franz Dülberg
Mitunter hört man die Behauptung, der neue Stil,
die Formensprache unserer und keiner anderen Zeit,
sei da. Von England erzählt es uns j"ede neue
Nummer des vortrefflich geleiteten »Studio«, in
Holland treten wirklich Häuser, in denen indische
Blütenfülle und nordische Festigkeit sich vermählen,
ganz unbefangen neben die vorgebeugten Giebel-
guirlanden des 17. Jahrhunderts, in Paris suchen
feingeistige Kunstlehrer den Besuchern der Rue de
la Paix neugeformten großen und kleinen Schmuck
zu verkaufen (ohne daß dabei die Leute, die Millionen
an ihre Wände zu hängen haben, irgendwie aus
ihrem Louis Quinze oder bestenfalls Empire heraus-
zustöbern wären), und in München sieht man, hübsch
draußen in den neuen Straßenzügen, Mietshäuser mit
leis runden Erkerbuchtungen, schwer verdaulichen
Wellenlinien der Dächer und allerhand Gold, Grün,
Blau und Rot in Linien und selbst Flächen des
billigen Stuck-, Zement- und Betonbewurfs. Dabei
wird im Mittelpunkte dieser Stadt ein Rathausanbau
aus edelstem Stein fertig; in großer Entfernung sieht
er fast so aus, als hätten die Bürgerschaften einer
flandrischen oder burgundischen Stadt um 1400 sich
in ihm wohl fühlen können.
Es ist in Schwabing, jenem Viertel der Stadt, wo
eine Anzahl merkwürdig fühlender Künstler, Schrift-
steller und Philosophen sich Gärens halber aufhalten.
Ein Neubau jener eben beschriebenen Art. Man tritt
zunächst in einen ziemlich großen, in Zukunft wohl
einem Käseladen dienenden Raum, in dem kalt und
gipsig einige Brunnenmodelle und plastische Ent-
würfe stehen. Dann über eine schreckliche, zu beiden
Seiten von feuchter Neubauluft umwehte Holztreppe
hinauf. Die weiße Frische der Wände wird durch
aufgehängte Tannenkränze und dunkel gemusterte
Buntpapiere kaum erträglicher. Oben dann in elf
meist nicht sehr großen Zimmern allerhand Aquarelle,
Möbel, Wandfriese, Stickereien, Metallarbeiten, Buch-
schmuckentwürfe: die vorläufigen Ergebnisse einer seit
etwa einunddreiviertel Jahren bestehenden freien
Akademie. Ein Bildhauer von weithin tönendem
Ruf und ein junger Maler, der bald in täglichem
Lehren und Eingreifen einen wesentlichen Teil der
Arbeit sich eroberte, haben die Schule begründet.
Beider Erscheinungen von heller nordischer Vornehm-
heit und von jener gepflegten Durchbildung aller
Lebensäußerungen, die in Deutschland endlich einmal
das schwielig pathetische Gerede von der hohen und
göttlichen Würde der Künste verdrängen sollte.
Alles künstlerische Grundgefühl ist vielleicht im
letzten Sinne wollüstiges Herrscherwissen: die Ver-
gewaltigung der Natur und des Lebens ist es, was
uns freut. Renaissancewerk wurde den Feinsten als
tägliche Umgebung unerträglich: nur die fessellose
Natur blickte aus solchen Arbeiten entgegen, und
die altgewordenen Bändigungen der Formensprache
konnten keine Siegesfreude mehr wecken. Los von
der Natur durch tiefstes Einwühlen und Einfühlen in
die Natur, war der unausgesprochene Kampfruf.
Etwas mager, etwas seltsam tasterisch sahen die neuen
Formen dann oft wohl aus; manches erinnerte an den
Eiertanz moderner Komponisten, die der naheliegenden
und wirksamen Harmonie aus dem Wege gehen,
weil der Platz leider schon von Beethoven, Wagner
oder gar Meyerbeer besetzt ist.
Herbst- und Winterfrucht, der Mispelzweig, der
mähnige Tannenzapfen sind die neuen Entdeckungen,
der gebrochene Ast, das Skelett, der dreischenklige
Hühnerknochen sind die neuen Fesselungsformen der
Obristschule. Anklänge an Gotik konnten so nicht aus-
bleiben; auch werden, wieder ganz nach Art der
Musik, bestimmte Zierformen immer von neuem zer-
legt, verknüpft und abgewandelt. Die verba ac signa
magistri schauen fast überall hervor; sehr stark auch
die des jungen Meisters W. v. Debschitz.
Eine aber — die Frauen sind diesmal interessanter
als die Männer — ist eine Natur im Goethischen
Sinne, nur etwas Eisen scheint ihr noch zu fehlen.
Anna Mährlen — der Name klingt gut an, denn das
Märchen in all seiner prangend sinnlosen Furchtbar-
keit, in seinem waldigen Einschlingen ist ihr Reich.
In kleinen Aquarellen ist sie am glücklichsten. Auf
einem Felsen unter gebreiteten Baldachinen riesiger
Farrenkräuter steht ein junges fast erwachsenes Mädchen.
Durchsichtig grünes Gewand läßt den so schlanken
und zugleich so nervigen Bau erkennen. Zurück-
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstr. 13
Neue Folge. XV. Jahrgang 1903/1904 Nr. 15. 12. Februar.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte etc., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und Ver-
lagshandlung keine Oewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13. Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haas enstein & Vogler, Rud. Mosse u. s. w. an.
DIE AUSSTELLUNG DER LEHR- UND
VERSUCHSATELIERS VON HERMANN OBRIST
UND WILHELM VON DEBSCHITZ
Von Franz Dülberg
Mitunter hört man die Behauptung, der neue Stil,
die Formensprache unserer und keiner anderen Zeit,
sei da. Von England erzählt es uns j"ede neue
Nummer des vortrefflich geleiteten »Studio«, in
Holland treten wirklich Häuser, in denen indische
Blütenfülle und nordische Festigkeit sich vermählen,
ganz unbefangen neben die vorgebeugten Giebel-
guirlanden des 17. Jahrhunderts, in Paris suchen
feingeistige Kunstlehrer den Besuchern der Rue de
la Paix neugeformten großen und kleinen Schmuck
zu verkaufen (ohne daß dabei die Leute, die Millionen
an ihre Wände zu hängen haben, irgendwie aus
ihrem Louis Quinze oder bestenfalls Empire heraus-
zustöbern wären), und in München sieht man, hübsch
draußen in den neuen Straßenzügen, Mietshäuser mit
leis runden Erkerbuchtungen, schwer verdaulichen
Wellenlinien der Dächer und allerhand Gold, Grün,
Blau und Rot in Linien und selbst Flächen des
billigen Stuck-, Zement- und Betonbewurfs. Dabei
wird im Mittelpunkte dieser Stadt ein Rathausanbau
aus edelstem Stein fertig; in großer Entfernung sieht
er fast so aus, als hätten die Bürgerschaften einer
flandrischen oder burgundischen Stadt um 1400 sich
in ihm wohl fühlen können.
Es ist in Schwabing, jenem Viertel der Stadt, wo
eine Anzahl merkwürdig fühlender Künstler, Schrift-
steller und Philosophen sich Gärens halber aufhalten.
Ein Neubau jener eben beschriebenen Art. Man tritt
zunächst in einen ziemlich großen, in Zukunft wohl
einem Käseladen dienenden Raum, in dem kalt und
gipsig einige Brunnenmodelle und plastische Ent-
würfe stehen. Dann über eine schreckliche, zu beiden
Seiten von feuchter Neubauluft umwehte Holztreppe
hinauf. Die weiße Frische der Wände wird durch
aufgehängte Tannenkränze und dunkel gemusterte
Buntpapiere kaum erträglicher. Oben dann in elf
meist nicht sehr großen Zimmern allerhand Aquarelle,
Möbel, Wandfriese, Stickereien, Metallarbeiten, Buch-
schmuckentwürfe: die vorläufigen Ergebnisse einer seit
etwa einunddreiviertel Jahren bestehenden freien
Akademie. Ein Bildhauer von weithin tönendem
Ruf und ein junger Maler, der bald in täglichem
Lehren und Eingreifen einen wesentlichen Teil der
Arbeit sich eroberte, haben die Schule begründet.
Beider Erscheinungen von heller nordischer Vornehm-
heit und von jener gepflegten Durchbildung aller
Lebensäußerungen, die in Deutschland endlich einmal
das schwielig pathetische Gerede von der hohen und
göttlichen Würde der Künste verdrängen sollte.
Alles künstlerische Grundgefühl ist vielleicht im
letzten Sinne wollüstiges Herrscherwissen: die Ver-
gewaltigung der Natur und des Lebens ist es, was
uns freut. Renaissancewerk wurde den Feinsten als
tägliche Umgebung unerträglich: nur die fessellose
Natur blickte aus solchen Arbeiten entgegen, und
die altgewordenen Bändigungen der Formensprache
konnten keine Siegesfreude mehr wecken. Los von
der Natur durch tiefstes Einwühlen und Einfühlen in
die Natur, war der unausgesprochene Kampfruf.
Etwas mager, etwas seltsam tasterisch sahen die neuen
Formen dann oft wohl aus; manches erinnerte an den
Eiertanz moderner Komponisten, die der naheliegenden
und wirksamen Harmonie aus dem Wege gehen,
weil der Platz leider schon von Beethoven, Wagner
oder gar Meyerbeer besetzt ist.
Herbst- und Winterfrucht, der Mispelzweig, der
mähnige Tannenzapfen sind die neuen Entdeckungen,
der gebrochene Ast, das Skelett, der dreischenklige
Hühnerknochen sind die neuen Fesselungsformen der
Obristschule. Anklänge an Gotik konnten so nicht aus-
bleiben; auch werden, wieder ganz nach Art der
Musik, bestimmte Zierformen immer von neuem zer-
legt, verknüpft und abgewandelt. Die verba ac signa
magistri schauen fast überall hervor; sehr stark auch
die des jungen Meisters W. v. Debschitz.
Eine aber — die Frauen sind diesmal interessanter
als die Männer — ist eine Natur im Goethischen
Sinne, nur etwas Eisen scheint ihr noch zu fehlen.
Anna Mährlen — der Name klingt gut an, denn das
Märchen in all seiner prangend sinnlosen Furchtbar-
keit, in seinem waldigen Einschlingen ist ihr Reich.
In kleinen Aquarellen ist sie am glücklichsten. Auf
einem Felsen unter gebreiteten Baldachinen riesiger
Farrenkräuter steht ein junges fast erwachsenes Mädchen.
Durchsichtig grünes Gewand läßt den so schlanken
und zugleich so nervigen Bau erkennen. Zurück-