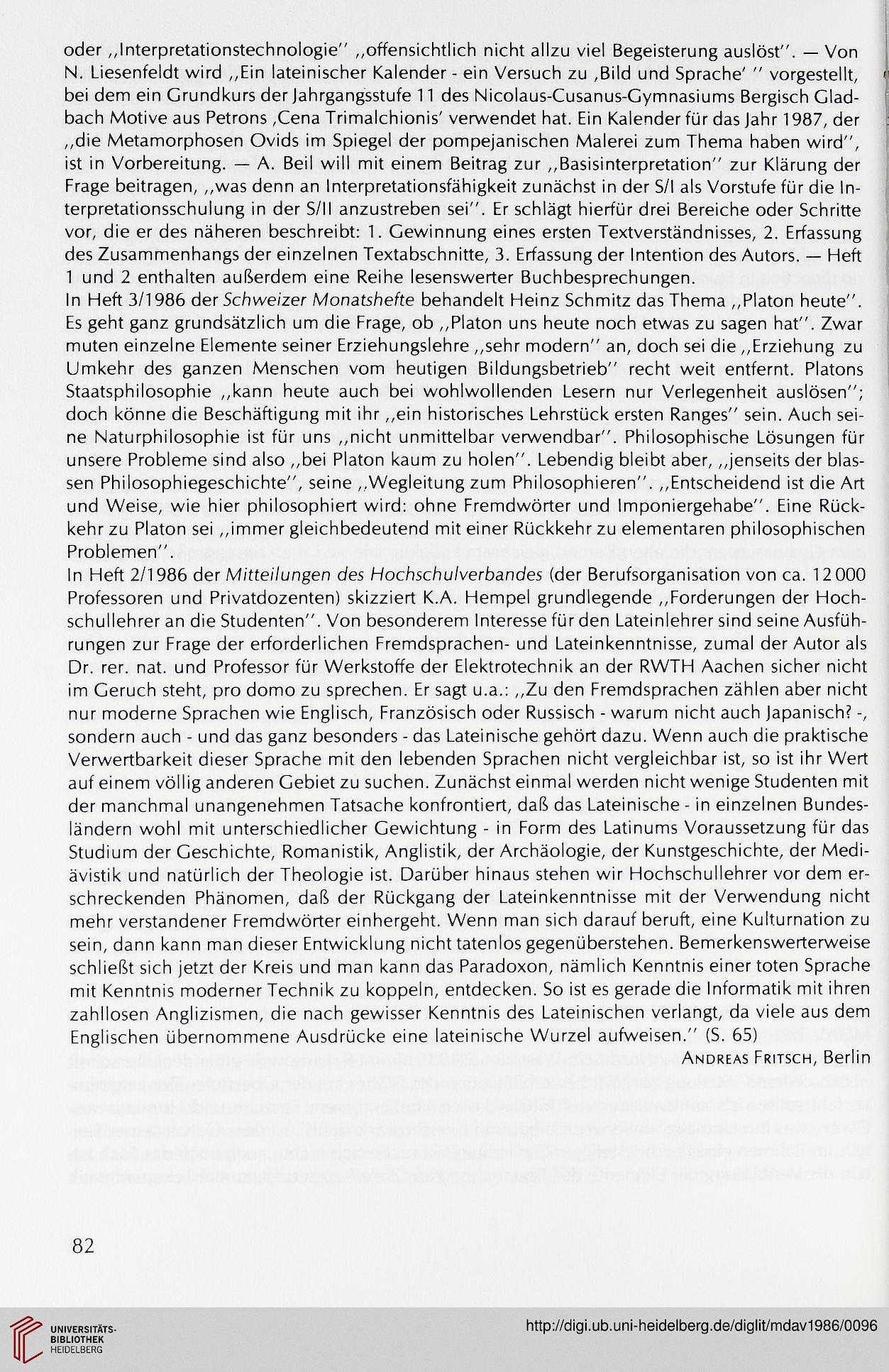oder ,,!nterpretationstechnologie" ^offensichtlich nicht allzu viel Begeisterung auslöst". — Von
N. Liesenfeldt wird ,,Ein lateinischer Kalender - ein Versuch zu ,Bild und Sprache' " vorgestellt,
bei dem ein Grundkurs der Jahrgangsstufe 11 des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums Bergisch Glad-
bach Motive aus Petrons ,Cena Trimalchionis' verwendet hat. Ein Kalender für das Jahr 1987, der
,,die Metamorphosen Ovids im Spiegel der pompejanischen Malerei zum Thema haben wird",
ist in Vorbereitung. — A. Beil will mit einem Beitrag zur ,,Basisinterpretation" zur Klärung der
Frage beitragen, ,,was denn an Interpretationsfähigkeit zunächst in der S/l als Vorstufe für die In-
terpretationsschulung in der S/Il anzustreben sei". Er schlägt hierfür drei Bereiche oder Schritte
vor, die er des näheren beschreibt: 1. Gewinnung eines ersten Textverständnisses, 2. Erfassung
des Zusammenhangs der einzelnen Textabschnitte, 3. Erfassung der Intention des Autors. — Heft
1 und 2 enthalten außerdem eine Reihe lesenswerter Buchbesprechungen.
In Heft 3/1986 der Schweizer Monatshefte behandelt Heinz Schmitz das Thema ,,Platon heute".
Es geht ganz grundsätzlich um die Frage, ob ,,Platon uns heute noch etwas zu sagen hat". Zwar
muten einzelne Elemente seiner Erziehungslehre ,,sehr modern" an, doch sei die ,,Erziehung zu
Umkehr des ganzen Menschen vom heutigen Bildungsbetrieb" recht weit entfernt. Platons
Staatsphilosophie ,,kann heute auch bei wohlwollenden Lesern nur Verlegenheit auslösen";
doch könne die Beschäftigung mit ihr ,,ein historisches Lehrstück ersten Ranges" sein. Auch sei-
ne Naturphilosophie ist für uns ,,nicht unmittelbar verwendbar". Philosophische Lösungen für
unsere Probleme sind also ,,bei Platon kaum zu holen". Lebendig bleibt aber, ,jenseits der blas-
sen Philosophiegeschichte", seine ,,Wegleitung zum Philosophieren". ,,Entscheidend ist die Art
und Weise, wie hier philosophiert wird: ohne Fremdwörter und Imponiergehabe". Eine Rück-
kehr zu Platon sei ,,immer gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu elementaren philosophischen
Problemen".
In Heft 2/1986 der Mittei/ungen des Hochschu/verbandes (der Berufsorganisation von ca. 12 000
Professoren und Privatdozenten) skizziert K.A. Hempel grundlegende ,,Forderungen der Hoch-
schullehrer an die Studenten". Von besonderem Interesse für den Lateinlehrer sind seine Ausfüh-
rungen zur Frage der erforderlichen Fremdsprachen- und Lateinkenntnisse, zumal der Autor als
Dr. rer. nat. und Professor für Werkstoffe der Elektrotechnik an der RWTH Aachen sicher nicht
im Geruch steht, pro domo zu sprechen. Er sagt u.a.: ,,Zu den Fremdsprachen zählen aber nicht
nur moderne Sprachen wie Englisch, Französisch oder Russisch - warum nicht auch Japanisch? -,
sondern auch - und das ganz besonders - das Lateinische gehört dazu. Wenn auch die praktische
Verwertbarkeit dieser Sprache mit den lebenden Sprachen nicht vergleichbar ist, so ist ihr Wert
auf einem völlig anderen Gebiet zu suchen. Zunächst einmal werden nicht wenige Studenten mit
der manchmal unangenehmen Tatsache konfrontiert, daß das Lateinische - in einzelnen Bundes-
ländern wohl mit unterschiedlicher Gewichtung - in Form des Latinums Voraussetzung für das
Studium der Geschichte, Romanistik, Anglistik, der Archäologie, der Kunstgeschichte, der Medi-
ävistik und natürlich der Theologie ist. Darüber hinaus stehen wir Hochschullehrer vor dem er-
schreckenden Phänomen, daß der Rückgang der Lateinkenntnisse mit der Verwendung nicht
mehr verstandener Fremdwörter einhergeht. Wenn man sich darauf beruft, eine Kuiturnation zu
sein, dann kann man dieser Entwicklung nicht tatenlos gegenüberstehen. Bemerkenswerterweise
schließt sich jetzt der Kreis und man kann das Paradoxon, nämlich Kenntnis einer toten Sprache
mit Kenntnis moderner Technik zu koppeln, entdecken. So ist es gerade die Informatik mit ihren
zahllosen Anglizismen, die nach gewisser Kenntnis des Lateinischen verlangt, da viele aus dem
Englischen übernommene Ausdrücke eine lateinische Wurzel aufweisen." (S. 65)
ANDREAS FRITSCH, Berlin
82
N. Liesenfeldt wird ,,Ein lateinischer Kalender - ein Versuch zu ,Bild und Sprache' " vorgestellt,
bei dem ein Grundkurs der Jahrgangsstufe 11 des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums Bergisch Glad-
bach Motive aus Petrons ,Cena Trimalchionis' verwendet hat. Ein Kalender für das Jahr 1987, der
,,die Metamorphosen Ovids im Spiegel der pompejanischen Malerei zum Thema haben wird",
ist in Vorbereitung. — A. Beil will mit einem Beitrag zur ,,Basisinterpretation" zur Klärung der
Frage beitragen, ,,was denn an Interpretationsfähigkeit zunächst in der S/l als Vorstufe für die In-
terpretationsschulung in der S/Il anzustreben sei". Er schlägt hierfür drei Bereiche oder Schritte
vor, die er des näheren beschreibt: 1. Gewinnung eines ersten Textverständnisses, 2. Erfassung
des Zusammenhangs der einzelnen Textabschnitte, 3. Erfassung der Intention des Autors. — Heft
1 und 2 enthalten außerdem eine Reihe lesenswerter Buchbesprechungen.
In Heft 3/1986 der Schweizer Monatshefte behandelt Heinz Schmitz das Thema ,,Platon heute".
Es geht ganz grundsätzlich um die Frage, ob ,,Platon uns heute noch etwas zu sagen hat". Zwar
muten einzelne Elemente seiner Erziehungslehre ,,sehr modern" an, doch sei die ,,Erziehung zu
Umkehr des ganzen Menschen vom heutigen Bildungsbetrieb" recht weit entfernt. Platons
Staatsphilosophie ,,kann heute auch bei wohlwollenden Lesern nur Verlegenheit auslösen";
doch könne die Beschäftigung mit ihr ,,ein historisches Lehrstück ersten Ranges" sein. Auch sei-
ne Naturphilosophie ist für uns ,,nicht unmittelbar verwendbar". Philosophische Lösungen für
unsere Probleme sind also ,,bei Platon kaum zu holen". Lebendig bleibt aber, ,jenseits der blas-
sen Philosophiegeschichte", seine ,,Wegleitung zum Philosophieren". ,,Entscheidend ist die Art
und Weise, wie hier philosophiert wird: ohne Fremdwörter und Imponiergehabe". Eine Rück-
kehr zu Platon sei ,,immer gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu elementaren philosophischen
Problemen".
In Heft 2/1986 der Mittei/ungen des Hochschu/verbandes (der Berufsorganisation von ca. 12 000
Professoren und Privatdozenten) skizziert K.A. Hempel grundlegende ,,Forderungen der Hoch-
schullehrer an die Studenten". Von besonderem Interesse für den Lateinlehrer sind seine Ausfüh-
rungen zur Frage der erforderlichen Fremdsprachen- und Lateinkenntnisse, zumal der Autor als
Dr. rer. nat. und Professor für Werkstoffe der Elektrotechnik an der RWTH Aachen sicher nicht
im Geruch steht, pro domo zu sprechen. Er sagt u.a.: ,,Zu den Fremdsprachen zählen aber nicht
nur moderne Sprachen wie Englisch, Französisch oder Russisch - warum nicht auch Japanisch? -,
sondern auch - und das ganz besonders - das Lateinische gehört dazu. Wenn auch die praktische
Verwertbarkeit dieser Sprache mit den lebenden Sprachen nicht vergleichbar ist, so ist ihr Wert
auf einem völlig anderen Gebiet zu suchen. Zunächst einmal werden nicht wenige Studenten mit
der manchmal unangenehmen Tatsache konfrontiert, daß das Lateinische - in einzelnen Bundes-
ländern wohl mit unterschiedlicher Gewichtung - in Form des Latinums Voraussetzung für das
Studium der Geschichte, Romanistik, Anglistik, der Archäologie, der Kunstgeschichte, der Medi-
ävistik und natürlich der Theologie ist. Darüber hinaus stehen wir Hochschullehrer vor dem er-
schreckenden Phänomen, daß der Rückgang der Lateinkenntnisse mit der Verwendung nicht
mehr verstandener Fremdwörter einhergeht. Wenn man sich darauf beruft, eine Kuiturnation zu
sein, dann kann man dieser Entwicklung nicht tatenlos gegenüberstehen. Bemerkenswerterweise
schließt sich jetzt der Kreis und man kann das Paradoxon, nämlich Kenntnis einer toten Sprache
mit Kenntnis moderner Technik zu koppeln, entdecken. So ist es gerade die Informatik mit ihren
zahllosen Anglizismen, die nach gewisser Kenntnis des Lateinischen verlangt, da viele aus dem
Englischen übernommene Ausdrücke eine lateinische Wurzel aufweisen." (S. 65)
ANDREAS FRITSCH, Berlin
82