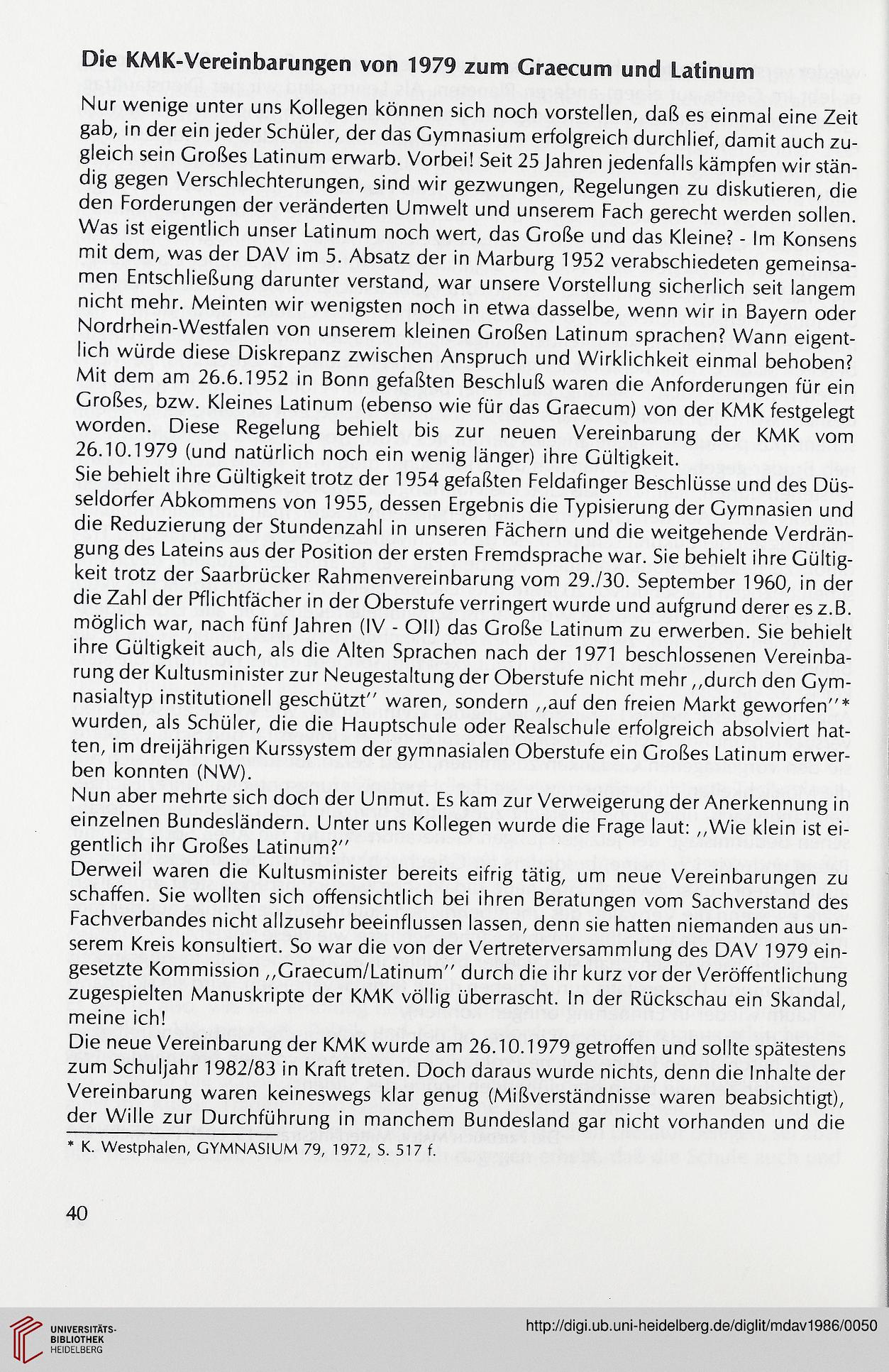Die KMK-Vereinbarungen von 1979 zum Graecum und Latinum
Nur wenige unter uns Koltegen können sich noch vorstellen, daß es einmal eine Zeit
gab, in der ein jeder Schüler, der das Gymnasium erfolgreich durchlief, damit auch zu-
gleich sein Großes Latinum erwarb. Vorbei! Seit 25 Jahren jedenfalls kämpfen wir stän-
dig gegen Verschlechterungen, sind wir gezwungen, Regelungen zu diskutieren, die
den Forderungen der veränderten Umwelt und unserem Fach gerecht werden sollen.
Was ist eigentlich unser Latinum noch wert, das Große und das Kleine? - Im Konsens
mit dem, was der DAV im 5. Absatz der in Marburg 1952 verabschiedeten gemeinsa-
men Entschließung darunter verstand, war unsere Vorstellung sicherlich seit langem
nicht mehr. Meinten wir wenigsten noch in etwa dasselbe, wenn wir in Bayern oder
Nordrhein-Westfalen von unserem kleinen Großen Latinum sprachen? Wann eigent-
lich würde diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit einmal behoben?
Mit dem am 26.6.1952 in Bonn gefaßten Beschluß waren die Anforderungen für ein
Großes, bzw. Kleines Latinum (ebenso wie für das Graecum) von der KMK festgelegt
worden. Diese Regelung behielt bis zur neuen Vereinbarung der KMK vom
26.10.1979 (und natürlich noch ein wenig länger) ihre Gültigkeit.
Sie behielt ihre Gültigkeit trotz der 1954 gefaßten Feldafinger Beschlüsse und des Düs-
seldorfer Abkommens von 1955, dessen Ergebnis die Typisierung der Gymnasien und
die Reduzierung der Stundenzahl in unseren Fächern und die weitgehende Verdrän-
gung des Lateins aus der Position der ersten Fremdsprache war. Sie behielt ihre Gültig-
keit trotz der Saarbrücker Rahmenvereinbarung vom 29./30. September 1960, in der
die Zahl der Pflichtfächer in der Oberstufe verringert wurde und aufgrund derer es z.B.
möglich war, nach fünf Jahren (IV - Oll) das Große Latinum zu erwerben. Sie behielt
ihre Gültigkeit auch, als die Alten Sprachen nach der 1971 beschlossenen Vereinba-
rung der Kultusminister zur Neugestaltung der Oberstufe nicht mehr,,durch den Gym-
nasialtyp institutionell geschützt" waren, sondern ,,auf den freien Markt geworfen"*
wurden, als Schüler, die die Hauptschule oder Realschule erfolgreich absolviert hat-
ten, im dreijährigen Kurssystem der gymnasialen Oberstufe ein Großes Latinum erwer-
ben konnten (NW).
Nun aber mehrte sich doch der Unmut. Es kam zur Verweigerung der Anerkennung in
einzelnen Bundesländern. Unter uns Kollegen wurde die Frage laut: ,,Wie klein ist ei-
gentlich ihr Großes Latinum?"
Derweil waren die Kultusminister bereits eifrig tätig, um neue Vereinbarungen zu
schaffen. Sie wollten sich offensichtlich bei ihren Beratungen vom Sachverstand des
Fachverbandes nicht allzusehr beeinflussen lassen, denn sie hatten niemanden aus un-
serem Kreis konsultiert. So war die von der Vertreterversammlung des DAV 1979 ein-
gesetzte Kommission ,,Graecum/Latinum" durch die ihr kurz vor der Veröffentlichung
zugespielten Manuskripte der KMK völlig überrascht. In der Rückschau ein Skandal,
meine ich!
Die neue Vereinbarung der KMK wurde am 26.10.1979 getroffen und sollte spätestens
zum Schuljahr 1982/83 in Kraft treten. Doch daraus wurde nichts, denn die Inhalte der
Vereinbarung waren keineswegs klar genug (Mißverständnisse waren beabsichtigt),
der Wille zur Durchführung in manchem Bundesland gar nicht vorhanden und die
* K. Westphalen, GYMNASIUM 79, 1972, S. 517 f.
40
Nur wenige unter uns Koltegen können sich noch vorstellen, daß es einmal eine Zeit
gab, in der ein jeder Schüler, der das Gymnasium erfolgreich durchlief, damit auch zu-
gleich sein Großes Latinum erwarb. Vorbei! Seit 25 Jahren jedenfalls kämpfen wir stän-
dig gegen Verschlechterungen, sind wir gezwungen, Regelungen zu diskutieren, die
den Forderungen der veränderten Umwelt und unserem Fach gerecht werden sollen.
Was ist eigentlich unser Latinum noch wert, das Große und das Kleine? - Im Konsens
mit dem, was der DAV im 5. Absatz der in Marburg 1952 verabschiedeten gemeinsa-
men Entschließung darunter verstand, war unsere Vorstellung sicherlich seit langem
nicht mehr. Meinten wir wenigsten noch in etwa dasselbe, wenn wir in Bayern oder
Nordrhein-Westfalen von unserem kleinen Großen Latinum sprachen? Wann eigent-
lich würde diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit einmal behoben?
Mit dem am 26.6.1952 in Bonn gefaßten Beschluß waren die Anforderungen für ein
Großes, bzw. Kleines Latinum (ebenso wie für das Graecum) von der KMK festgelegt
worden. Diese Regelung behielt bis zur neuen Vereinbarung der KMK vom
26.10.1979 (und natürlich noch ein wenig länger) ihre Gültigkeit.
Sie behielt ihre Gültigkeit trotz der 1954 gefaßten Feldafinger Beschlüsse und des Düs-
seldorfer Abkommens von 1955, dessen Ergebnis die Typisierung der Gymnasien und
die Reduzierung der Stundenzahl in unseren Fächern und die weitgehende Verdrän-
gung des Lateins aus der Position der ersten Fremdsprache war. Sie behielt ihre Gültig-
keit trotz der Saarbrücker Rahmenvereinbarung vom 29./30. September 1960, in der
die Zahl der Pflichtfächer in der Oberstufe verringert wurde und aufgrund derer es z.B.
möglich war, nach fünf Jahren (IV - Oll) das Große Latinum zu erwerben. Sie behielt
ihre Gültigkeit auch, als die Alten Sprachen nach der 1971 beschlossenen Vereinba-
rung der Kultusminister zur Neugestaltung der Oberstufe nicht mehr,,durch den Gym-
nasialtyp institutionell geschützt" waren, sondern ,,auf den freien Markt geworfen"*
wurden, als Schüler, die die Hauptschule oder Realschule erfolgreich absolviert hat-
ten, im dreijährigen Kurssystem der gymnasialen Oberstufe ein Großes Latinum erwer-
ben konnten (NW).
Nun aber mehrte sich doch der Unmut. Es kam zur Verweigerung der Anerkennung in
einzelnen Bundesländern. Unter uns Kollegen wurde die Frage laut: ,,Wie klein ist ei-
gentlich ihr Großes Latinum?"
Derweil waren die Kultusminister bereits eifrig tätig, um neue Vereinbarungen zu
schaffen. Sie wollten sich offensichtlich bei ihren Beratungen vom Sachverstand des
Fachverbandes nicht allzusehr beeinflussen lassen, denn sie hatten niemanden aus un-
serem Kreis konsultiert. So war die von der Vertreterversammlung des DAV 1979 ein-
gesetzte Kommission ,,Graecum/Latinum" durch die ihr kurz vor der Veröffentlichung
zugespielten Manuskripte der KMK völlig überrascht. In der Rückschau ein Skandal,
meine ich!
Die neue Vereinbarung der KMK wurde am 26.10.1979 getroffen und sollte spätestens
zum Schuljahr 1982/83 in Kraft treten. Doch daraus wurde nichts, denn die Inhalte der
Vereinbarung waren keineswegs klar genug (Mißverständnisse waren beabsichtigt),
der Wille zur Durchführung in manchem Bundesland gar nicht vorhanden und die
* K. Westphalen, GYMNASIUM 79, 1972, S. 517 f.
40