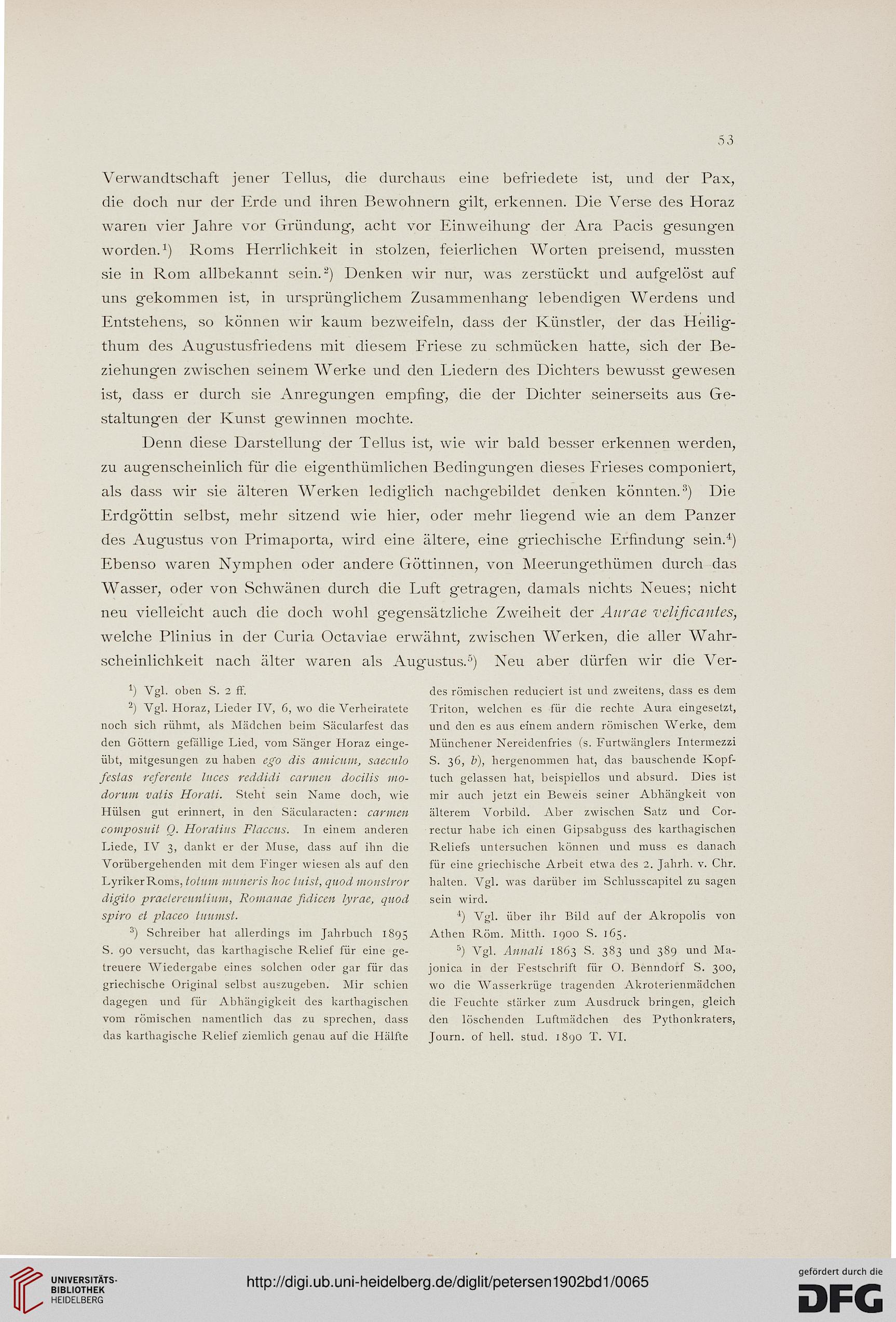53
Verwandtschaft jener Tellus, die durchaus eine befriedete ist, und der Pax,
die doch nur der Erde und ihren Bewohnern gilt, erkennen. Die Verse des Horaz
waren vier Jahre vor Gründung-, acht vor Einweihung- der Ära Pacis gesungen
worden.1) Roms Herrlichkeit in stolzen, feierlichen Worten preisend, mussten
sie in Rom allbekannt sein.2) Denken wir nur, was zerstückt und aufgelöst auf
uns gekommen ist, in ursprünglichem Zusammenhang lebendigen Werdens und
Entstehens, so können wir kaum bezweifeln, dass der Künstler, der das Heilig-
thum des Augustusfriedens mit diesem Friese zu schmücken hatte, sich der Be-
ziehungen zwischen seinem Werke und den Liedern des Dichters bewusst gewesen
ist, dass er durch sie Anregungen empfing, die der Dichter seinerseits aus Ge-
staltungen der Kunst gewinnen mochte.
Denn diese Darstellung der Tellus ist, wie wir bald besser erkennen werden,
zu augenscheinlich für die eigenthümlichen Bedingungen dieses Frieses componiert,
als dass wir sie älteren Werken lediglich nachgebildet denken könnten.3) Die
Erdgöttin selbst, mehr sitzend wie hier, oder mehr liegend wie an dem Panzer
des Augustus von Primaporta, wird eine ältere, eine griechische Erfindung sein.4)
Ebenso waren Nymphen oder andere Göttinnen, von Meerungethümen durch das
Wasser, oder von Schwänen durch die Luft getragen, damals nichts Neues; nicht
neu vielleicht auch die doch wohl gegensätzliche Zweiheit der Aurae velificautcs,
welche Plinius in der Curia Octaviae erwähnt, zwischen Werken, die aller Wahr-
scheinlichkeit nach älter waren als Augustus.5) Neu aber dürfen wir die Ver-
1) Vgl. oben S. 2 ff. des römischen reduciert ist und zweitens, dass es dem
2) Vgl. Horaz, Lieder IV, 6, wo die Verheiratete Triton, welchen es für die rechte Aura eingesetzt,
noch sich rühmt, als Mädchen beim Säcularfest das und den es aus einem andern römischen Werke, dem
den Göttern gefallige Lied, vom Sänger Horaz einge- Münchener Nereidenfries (s. Furtwänglers Intermezzi
übt, mitgesungen zu haben ego dis amicum, saeculo S. 36, b), hergenommen hat, das bauschende Kopf-
fcslas referente luces reddidi Carmen docilis 1110- tuch gelassen hat, beispiellos und absurd. Dies ist
dorum vatis Horati. Steht sein Name doch, wie mir auch jetzt ein Beweis seiner Abhängkeit von
Hülsen gut erinnert, in den Säcularacten: Carmen älterem Vorbild. Aber zwischen Satz und Cor-
composiiit 0. Horatius Flaccus. In einem anderen rectur habe ich einen Gipsabguss des karthagischen
Liede, IV 3, dankt er der Muse, dass auf ihn die Reliefs untersuchen können und muss es danach
Vorübergehenden mit dem Finger wiesen als auf den für eine griechische Arbeit etwa des 2. Jahrh. v. Chr.
LyrikerRoms, totum muneris hoc tuist, quod monstror halten. Vgl. was darüber im Schlusscapitel zu sagen
digilo praeiereuntium, Romanae fniieen lyrae, quod sein wird.
Spiro et placeo tuumst. 4) Vgl. über ihr Bild auf der Akropolis von
3) Schreiber hat allerdings im Jahrbuch 1895 Athen Rom. Mitth. 1900 S. 165.
S. 90 versucht, das karthagische Relief für eine ge- 5) Vgl. Annali 1863 S. 383 und 389 und Ma-
treuere Wiedergabe eines solchen oder gar für das jonica in der Festschrift für O. Benndorf S. 300,
griechische Original selbst auszugeben. Mir schien wo die Wasserkrüge tragenden Akroterienmädchen
dagegen und für Abhängigkeit des karthagischen die Feuchte stärker zum Ausdruck bringen, gleich
vom römischen namentlich das zu sprechen, dass den löschenden Luftmädchen des Pythonkraters,
das karthagische Relief ziemlich genau auf die Hälfte Journ. of hell. stud. 189O T. VI.
Verwandtschaft jener Tellus, die durchaus eine befriedete ist, und der Pax,
die doch nur der Erde und ihren Bewohnern gilt, erkennen. Die Verse des Horaz
waren vier Jahre vor Gründung-, acht vor Einweihung- der Ära Pacis gesungen
worden.1) Roms Herrlichkeit in stolzen, feierlichen Worten preisend, mussten
sie in Rom allbekannt sein.2) Denken wir nur, was zerstückt und aufgelöst auf
uns gekommen ist, in ursprünglichem Zusammenhang lebendigen Werdens und
Entstehens, so können wir kaum bezweifeln, dass der Künstler, der das Heilig-
thum des Augustusfriedens mit diesem Friese zu schmücken hatte, sich der Be-
ziehungen zwischen seinem Werke und den Liedern des Dichters bewusst gewesen
ist, dass er durch sie Anregungen empfing, die der Dichter seinerseits aus Ge-
staltungen der Kunst gewinnen mochte.
Denn diese Darstellung der Tellus ist, wie wir bald besser erkennen werden,
zu augenscheinlich für die eigenthümlichen Bedingungen dieses Frieses componiert,
als dass wir sie älteren Werken lediglich nachgebildet denken könnten.3) Die
Erdgöttin selbst, mehr sitzend wie hier, oder mehr liegend wie an dem Panzer
des Augustus von Primaporta, wird eine ältere, eine griechische Erfindung sein.4)
Ebenso waren Nymphen oder andere Göttinnen, von Meerungethümen durch das
Wasser, oder von Schwänen durch die Luft getragen, damals nichts Neues; nicht
neu vielleicht auch die doch wohl gegensätzliche Zweiheit der Aurae velificautcs,
welche Plinius in der Curia Octaviae erwähnt, zwischen Werken, die aller Wahr-
scheinlichkeit nach älter waren als Augustus.5) Neu aber dürfen wir die Ver-
1) Vgl. oben S. 2 ff. des römischen reduciert ist und zweitens, dass es dem
2) Vgl. Horaz, Lieder IV, 6, wo die Verheiratete Triton, welchen es für die rechte Aura eingesetzt,
noch sich rühmt, als Mädchen beim Säcularfest das und den es aus einem andern römischen Werke, dem
den Göttern gefallige Lied, vom Sänger Horaz einge- Münchener Nereidenfries (s. Furtwänglers Intermezzi
übt, mitgesungen zu haben ego dis amicum, saeculo S. 36, b), hergenommen hat, das bauschende Kopf-
fcslas referente luces reddidi Carmen docilis 1110- tuch gelassen hat, beispiellos und absurd. Dies ist
dorum vatis Horati. Steht sein Name doch, wie mir auch jetzt ein Beweis seiner Abhängkeit von
Hülsen gut erinnert, in den Säcularacten: Carmen älterem Vorbild. Aber zwischen Satz und Cor-
composiiit 0. Horatius Flaccus. In einem anderen rectur habe ich einen Gipsabguss des karthagischen
Liede, IV 3, dankt er der Muse, dass auf ihn die Reliefs untersuchen können und muss es danach
Vorübergehenden mit dem Finger wiesen als auf den für eine griechische Arbeit etwa des 2. Jahrh. v. Chr.
LyrikerRoms, totum muneris hoc tuist, quod monstror halten. Vgl. was darüber im Schlusscapitel zu sagen
digilo praeiereuntium, Romanae fniieen lyrae, quod sein wird.
Spiro et placeo tuumst. 4) Vgl. über ihr Bild auf der Akropolis von
3) Schreiber hat allerdings im Jahrbuch 1895 Athen Rom. Mitth. 1900 S. 165.
S. 90 versucht, das karthagische Relief für eine ge- 5) Vgl. Annali 1863 S. 383 und 389 und Ma-
treuere Wiedergabe eines solchen oder gar für das jonica in der Festschrift für O. Benndorf S. 300,
griechische Original selbst auszugeben. Mir schien wo die Wasserkrüge tragenden Akroterienmädchen
dagegen und für Abhängigkeit des karthagischen die Feuchte stärker zum Ausdruck bringen, gleich
vom römischen namentlich das zu sprechen, dass den löschenden Luftmädchen des Pythonkraters,
das karthagische Relief ziemlich genau auf die Hälfte Journ. of hell. stud. 189O T. VI.