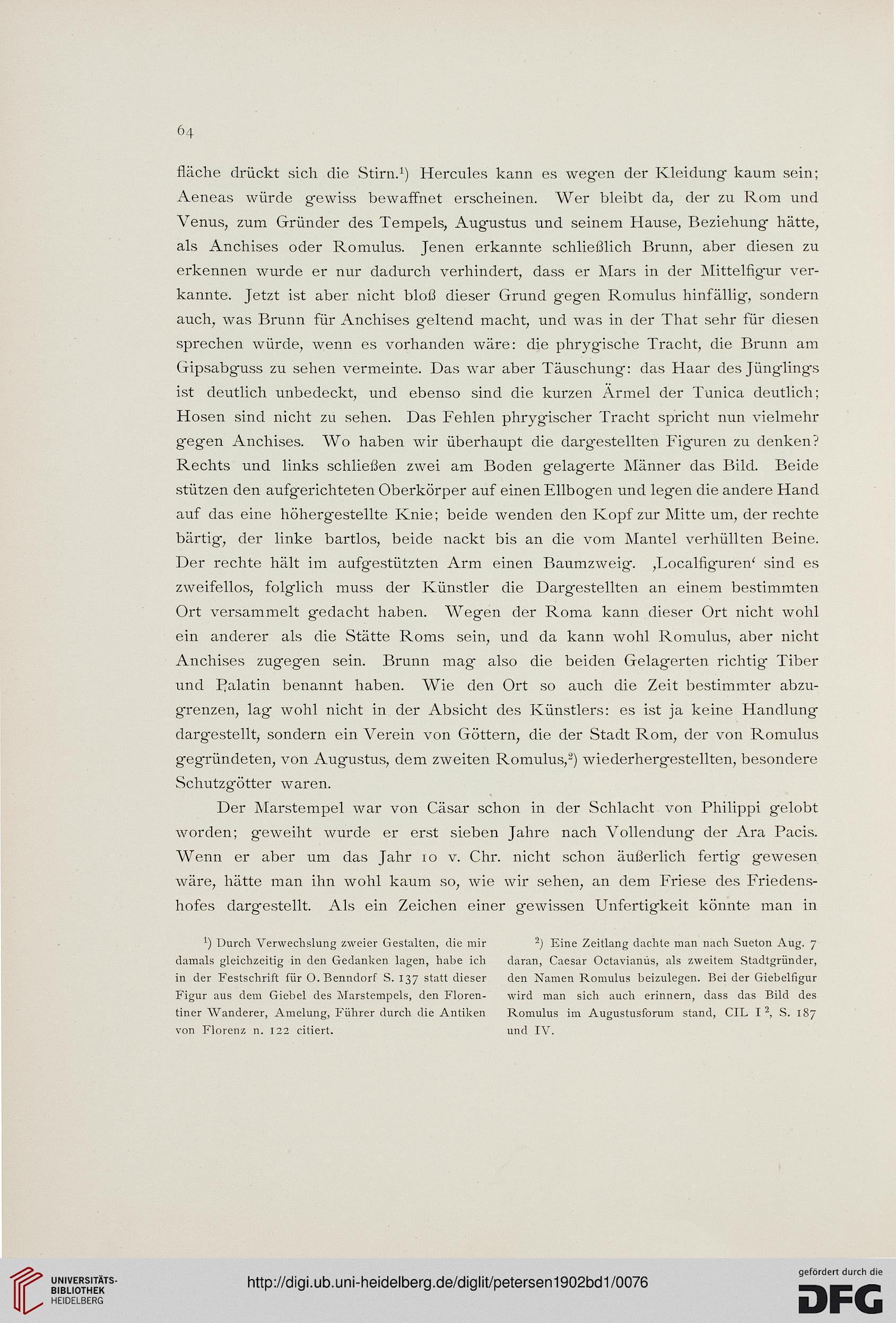64
fläche drückt sich die Stirn.1) Hercules kann es wegen der Kleidung- kaum sein;
Aeneas würde gewiss bewaffnet erscheinen. Wer bleibt da; der zu Rom und
Venus, zum Gründer des Tempels, Augustus und seinem Hause, Beziehung hätte,
als Anchises oder Romulus. Jenen erkannte schließlich Brunn, aber diesen zu
erkennen wurde er nur dadurch verhindert, dass er Mars in der Mittelfigur ver-
kannte. Jetzt ist aber nicht bloß dieser Grund gegen Romulus hinfällig, sondern
auch, was Brunn für Anchises geltend macht, und was in der That sehr für diesen
sprechen würde, wenn es vorhanden wäre: die phrygische Tracht, die Brunn am
Gipsabguss zu sehen vermeinte. Das war aber Täuschung: das Haar des Jünglings
ist deutlich unbedeckt, und ebenso sind die kurzen Ärmel der Tunica deutlich;
Hosen sind nicht zu sehen. Das Fehlen phrygischer Tracht spricht nun vielmehr
gegen Anchises. Wo haben wir überhaupt die dargestellten Figuren zu denken?
Rechts und links schließen zwei am Boden gelagerte Männer das Bild. Beide
stützen den aufgerichteten Oberkörper auf einen Ellbogen und legen die andere Hand
auf das eine höhergestellte Knie; beide wenden den Kopf zur Mitte um, der rechte
bärtig, der linke bartlos, beide nackt bis an die vom Mantel verhüllten Beine.
Der rechte hält im aufgestützten Arm einen Baumzweig. ,Localfiguren< sind es
zweifellos, folglich muss der Künstler die Dargestellten an einem bestimmten
Ort versammelt gedacht haben. Wegen der Roma kann dieser Ort nicht wohl
ein anderer als die Stätte Roms sein, und da kann wohl Romulus, aber nicht
Anchises zugegen sein. Brunn mag also die beiden Gelagerten richtig Tiber
und Palatin benannt haben. Wie den Ort so auch die Zeit bestimmter abzu-
grenzen, lag wohl nicht in der Absicht des Künstlers: es ist ja keine Handlung
dargestellt, sondern ein Verein von Göttern, die der Stadt Rom, der von Romulus
gegründeten, von Augustus, dem zweiten Romulus,3) wiederhergestellten, besondere
Schutzgötter waren.
Der Marstempel war von Cäsar schon in der Schlacht von Philippi gelobt
worden; geweiht wurde er erst sieben Jahre nach Vollendung der Ära Pacis.
Wenn er aber um das Jahr 10 v. Chr. nicht schon äußerlich fertig gewesen
wäre, hätte man ihn wohl kaum so, wie wir sehen, an dem Friese des Friedens-
hofes dargestellt. Als ein Zeichen einer gewissen Unfertigkeit könnte man in
1) Durch Verwechslung zweier Gestalten, die mir
damals gleichzeitig in den Gedanken lagen, habe ich
in der Festschrift für O.Benndorf S. 137 statt dieser
Figur aus dem Giebel des Marstempels, den Floren-
tiner Wanderer, Amelung, Führer durch die Antiken
von Florenz n. 122 citiert.
2) Eine Zeitlang dachte man nach Sueton Aug. 7
daran, Caesar Octavianüs, als zweitem Stadtgründer,
den Namen Romulus beizulegen. Bei der Giebelfigur
wird man sich auch erinnern, dass das Bild des
Romulus im Augustusforum stand, CIL I2, S. 187
und IV.
fläche drückt sich die Stirn.1) Hercules kann es wegen der Kleidung- kaum sein;
Aeneas würde gewiss bewaffnet erscheinen. Wer bleibt da; der zu Rom und
Venus, zum Gründer des Tempels, Augustus und seinem Hause, Beziehung hätte,
als Anchises oder Romulus. Jenen erkannte schließlich Brunn, aber diesen zu
erkennen wurde er nur dadurch verhindert, dass er Mars in der Mittelfigur ver-
kannte. Jetzt ist aber nicht bloß dieser Grund gegen Romulus hinfällig, sondern
auch, was Brunn für Anchises geltend macht, und was in der That sehr für diesen
sprechen würde, wenn es vorhanden wäre: die phrygische Tracht, die Brunn am
Gipsabguss zu sehen vermeinte. Das war aber Täuschung: das Haar des Jünglings
ist deutlich unbedeckt, und ebenso sind die kurzen Ärmel der Tunica deutlich;
Hosen sind nicht zu sehen. Das Fehlen phrygischer Tracht spricht nun vielmehr
gegen Anchises. Wo haben wir überhaupt die dargestellten Figuren zu denken?
Rechts und links schließen zwei am Boden gelagerte Männer das Bild. Beide
stützen den aufgerichteten Oberkörper auf einen Ellbogen und legen die andere Hand
auf das eine höhergestellte Knie; beide wenden den Kopf zur Mitte um, der rechte
bärtig, der linke bartlos, beide nackt bis an die vom Mantel verhüllten Beine.
Der rechte hält im aufgestützten Arm einen Baumzweig. ,Localfiguren< sind es
zweifellos, folglich muss der Künstler die Dargestellten an einem bestimmten
Ort versammelt gedacht haben. Wegen der Roma kann dieser Ort nicht wohl
ein anderer als die Stätte Roms sein, und da kann wohl Romulus, aber nicht
Anchises zugegen sein. Brunn mag also die beiden Gelagerten richtig Tiber
und Palatin benannt haben. Wie den Ort so auch die Zeit bestimmter abzu-
grenzen, lag wohl nicht in der Absicht des Künstlers: es ist ja keine Handlung
dargestellt, sondern ein Verein von Göttern, die der Stadt Rom, der von Romulus
gegründeten, von Augustus, dem zweiten Romulus,3) wiederhergestellten, besondere
Schutzgötter waren.
Der Marstempel war von Cäsar schon in der Schlacht von Philippi gelobt
worden; geweiht wurde er erst sieben Jahre nach Vollendung der Ära Pacis.
Wenn er aber um das Jahr 10 v. Chr. nicht schon äußerlich fertig gewesen
wäre, hätte man ihn wohl kaum so, wie wir sehen, an dem Friese des Friedens-
hofes dargestellt. Als ein Zeichen einer gewissen Unfertigkeit könnte man in
1) Durch Verwechslung zweier Gestalten, die mir
damals gleichzeitig in den Gedanken lagen, habe ich
in der Festschrift für O.Benndorf S. 137 statt dieser
Figur aus dem Giebel des Marstempels, den Floren-
tiner Wanderer, Amelung, Führer durch die Antiken
von Florenz n. 122 citiert.
2) Eine Zeitlang dachte man nach Sueton Aug. 7
daran, Caesar Octavianüs, als zweitem Stadtgründer,
den Namen Romulus beizulegen. Bei der Giebelfigur
wird man sich auch erinnern, dass das Bild des
Romulus im Augustusforum stand, CIL I2, S. 187
und IV.