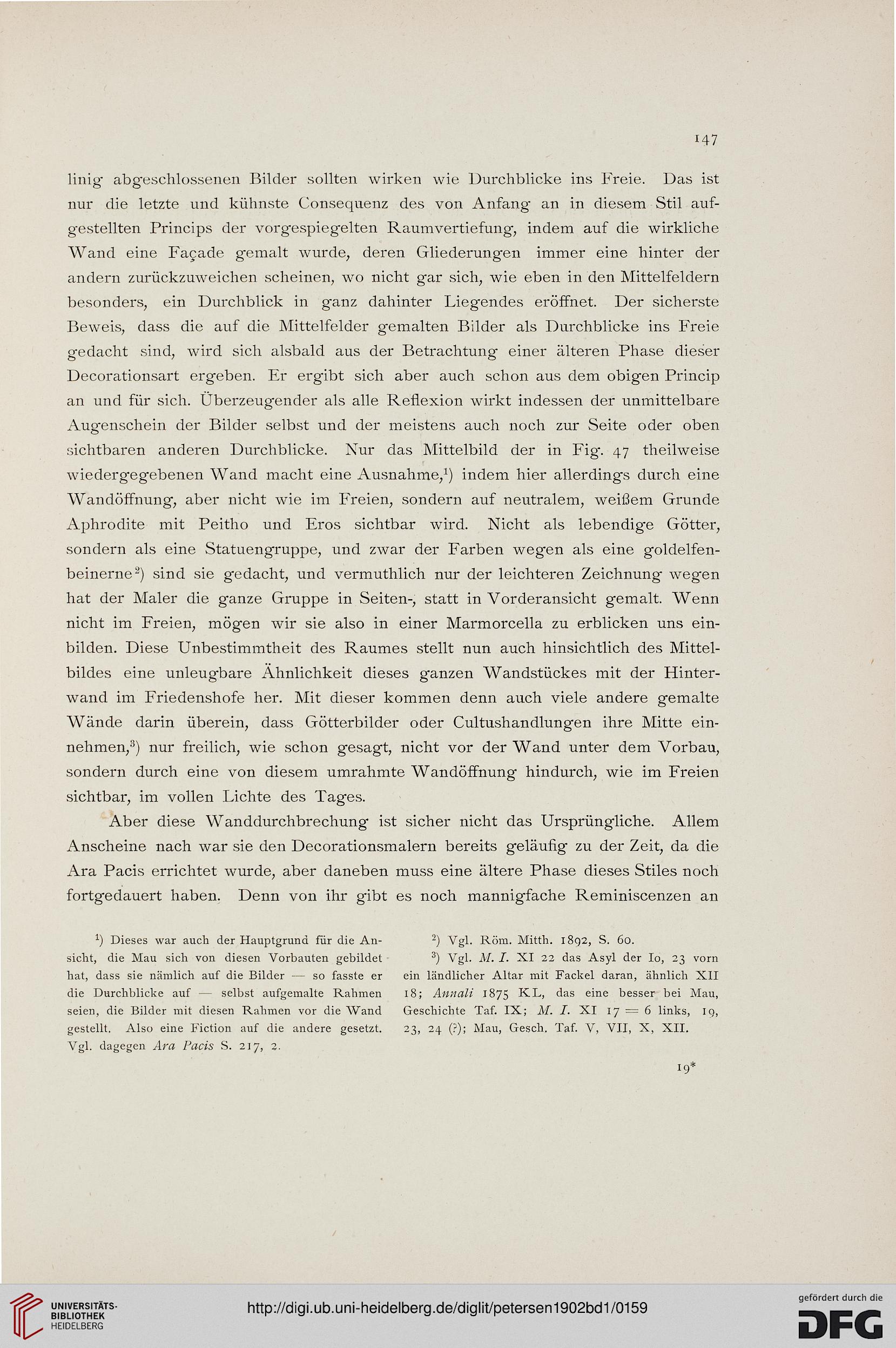147
linig- abgeschlossenen Bilder sollten wirken wie Durchblicke ins Freie. Das ist
nur die letzte und kühnste Consequenz des von Anfang an in diesem Stil auf-
gestellten Princips der vorgespiegelten Raumvertiefung, indem auf die wirkliche
Wand eine Facade gemalt wurde, deren Gliederungen immer eine hinter der
andern zurückzuweichen scheinen, wo nicht gar sich, wie eben in den Mittelfeldern
besonders, ein Durchblick in ganz dahinter Liegendes eröffnet. Der sicherste
Beweis, dass die auf die Mittelfelder gemalten Bilder als Durchblicke ins Freie
gedacht sind, wird sich alsbald aus der Betrachtung einer älteren Phase dieser
Decorationsart ergeben. Er ergibt sich aber auch schon aus dem obigen Princip
an und für sich. Uberzeugender als alle Reflexion wirkt indessen der unmittelbare
Augenschein der Bilder selbst und der meistens auch noch zur Seite oder oben
sichtbaren anderen Durchblicke. Nur das Mittelbild der in Fig. 47 theilweise
wiedergegebenen Wand macht eine Ausnahme,1) indem hier allerdings durch eine
Wandöffnung, aber nicht wie im Freien, sondern auf neutralem, weißem Grunde
Aphrodite mit Peitho und Eros sichtbar wird. Nicht als lebendige Götter,
sondern als eine Statuengruppe, und zwar der Farben wegen als eine goldelfen-
beinerne-) sind sie gedacht, und vermuthlich nur der leichteren Zeichnung wegen
hat der Maler die ganze Gruppe in Seiten-, statt in Vorderansicht gemalt. Wenn
nicht im Freien, mögen wir sie also in einer Marmorcella zu erblicken uns ein-
bilden. Diese Unbestimmtheit des Raumes stellt nun auch hinsichtlich des Mittel-
bildes eine unleugbare Ähnlichkeit dieses ganzen Wandstückes mit der Hinter-
wand im Friedenshofe her. Mit dieser kommen denn auch viele andere gemalte
Wände darin überein, dass Götterbilder oder Cultushandlungen ihre Mitte ein-
nehmen,3) nur freilich, wie schon gesagt, nicht vor der Wand unter dem Vorbau,
sondern durch eine von diesem umrahmte Wandöffnung hindurch, wie im Freien
sichtbar, im vollen Lichte des Tages.
Aber diese Wanddurchbrechung ist sicher nicht das Ursprüngliche. Allem
Anscheine nach war sie den Decorationsmalern bereits geläufig zu der Zeit, da die
Ära Pacis errichtet wurde, aber daneben muss eine ältere Phase dieses Stiles noch
fortgedauert haben. Denn von ihr gibt es noch mannigfache Reminiscenzen an
*) Dieses war auch der Hauptgrund für die An-
sicht, die Mau sich von diesen Vorbauten gebildet
hat, dass sie nämlich auf die Bilder — so fasste er
die Durchblicke auf — selbst aufgemalte Rahmen
seien, die Bilder mit diesen Rahmen vor die Wand
gestellt. Also eine Fiction auf die andere gesetzt.
Vgl. dagegen Ära Pacis S. 217, 2.
2) Vgl. Rom. Mitth. 1892, S. 60.
3) Vgl. M. I. XI 22 das Asyl der Io, 23 vorn
ein ländlicher Altar mit Fackel daran, ähnlich XII
18; Annali 1875 KL, das eine besser bei Mau,
Geschichte Taf. IX; AI. I. XI 17 = 6 links, 19,
23, 24 (?); Mau, Gesch. Taf. V, VII, X, XII.
19*
linig- abgeschlossenen Bilder sollten wirken wie Durchblicke ins Freie. Das ist
nur die letzte und kühnste Consequenz des von Anfang an in diesem Stil auf-
gestellten Princips der vorgespiegelten Raumvertiefung, indem auf die wirkliche
Wand eine Facade gemalt wurde, deren Gliederungen immer eine hinter der
andern zurückzuweichen scheinen, wo nicht gar sich, wie eben in den Mittelfeldern
besonders, ein Durchblick in ganz dahinter Liegendes eröffnet. Der sicherste
Beweis, dass die auf die Mittelfelder gemalten Bilder als Durchblicke ins Freie
gedacht sind, wird sich alsbald aus der Betrachtung einer älteren Phase dieser
Decorationsart ergeben. Er ergibt sich aber auch schon aus dem obigen Princip
an und für sich. Uberzeugender als alle Reflexion wirkt indessen der unmittelbare
Augenschein der Bilder selbst und der meistens auch noch zur Seite oder oben
sichtbaren anderen Durchblicke. Nur das Mittelbild der in Fig. 47 theilweise
wiedergegebenen Wand macht eine Ausnahme,1) indem hier allerdings durch eine
Wandöffnung, aber nicht wie im Freien, sondern auf neutralem, weißem Grunde
Aphrodite mit Peitho und Eros sichtbar wird. Nicht als lebendige Götter,
sondern als eine Statuengruppe, und zwar der Farben wegen als eine goldelfen-
beinerne-) sind sie gedacht, und vermuthlich nur der leichteren Zeichnung wegen
hat der Maler die ganze Gruppe in Seiten-, statt in Vorderansicht gemalt. Wenn
nicht im Freien, mögen wir sie also in einer Marmorcella zu erblicken uns ein-
bilden. Diese Unbestimmtheit des Raumes stellt nun auch hinsichtlich des Mittel-
bildes eine unleugbare Ähnlichkeit dieses ganzen Wandstückes mit der Hinter-
wand im Friedenshofe her. Mit dieser kommen denn auch viele andere gemalte
Wände darin überein, dass Götterbilder oder Cultushandlungen ihre Mitte ein-
nehmen,3) nur freilich, wie schon gesagt, nicht vor der Wand unter dem Vorbau,
sondern durch eine von diesem umrahmte Wandöffnung hindurch, wie im Freien
sichtbar, im vollen Lichte des Tages.
Aber diese Wanddurchbrechung ist sicher nicht das Ursprüngliche. Allem
Anscheine nach war sie den Decorationsmalern bereits geläufig zu der Zeit, da die
Ära Pacis errichtet wurde, aber daneben muss eine ältere Phase dieses Stiles noch
fortgedauert haben. Denn von ihr gibt es noch mannigfache Reminiscenzen an
*) Dieses war auch der Hauptgrund für die An-
sicht, die Mau sich von diesen Vorbauten gebildet
hat, dass sie nämlich auf die Bilder — so fasste er
die Durchblicke auf — selbst aufgemalte Rahmen
seien, die Bilder mit diesen Rahmen vor die Wand
gestellt. Also eine Fiction auf die andere gesetzt.
Vgl. dagegen Ära Pacis S. 217, 2.
2) Vgl. Rom. Mitth. 1892, S. 60.
3) Vgl. M. I. XI 22 das Asyl der Io, 23 vorn
ein ländlicher Altar mit Fackel daran, ähnlich XII
18; Annali 1875 KL, das eine besser bei Mau,
Geschichte Taf. IX; AI. I. XI 17 = 6 links, 19,
23, 24 (?); Mau, Gesch. Taf. V, VII, X, XII.
19*