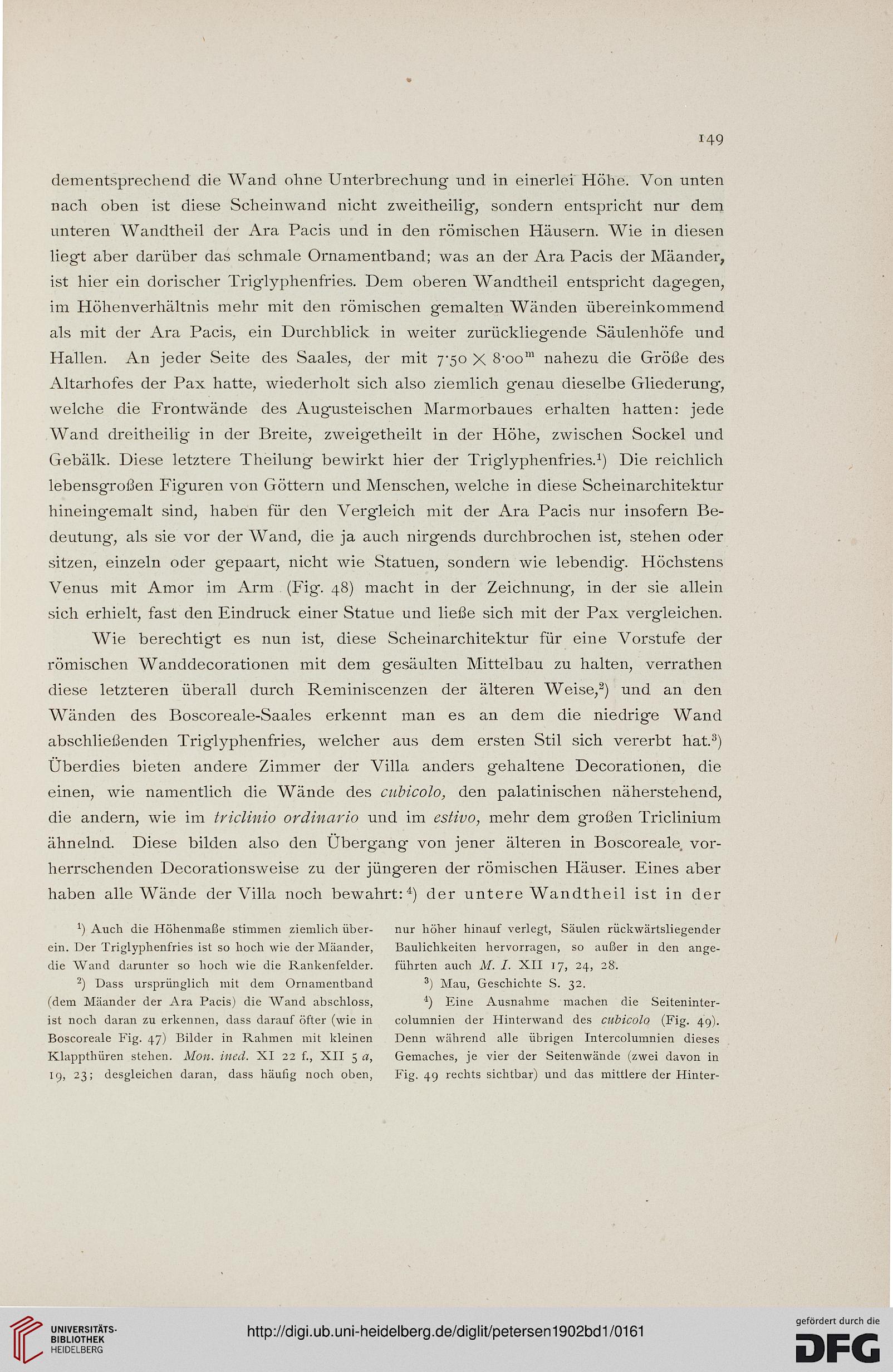149
dementsprechend die Wand ohne Unterbrechung und in einerlei Höhe. Von unten
nach oben ist diese Scheinwand nicht zweitheilig-, sondern entspricht nur dem
unteren Wandtheil der Ära Pacis und in den römischen Häusern. Wie in diesen
liegt aber darüber das schmale Ornamentband; was an der Ära Pacis der Mäander,
ist hier ein dorischer Triglyphenfries. Dem oberen Wandtheil entspricht dagegen,
im Höhenverhältnis mehr mit den römischen gemalten Wänden übereinkommend
als mit der Ära Pacis, ein Durchblick in weiter zurückliegende Säulenhöfe und
Hallen. An jeder Seite des Saales, der mit 7-50 X 8-oom nahezu die Größe des
Altarhofes der Pax hatte, wiederholt sich also ziemlich genau dieselbe Gliederung,
welche die Frontwände des Augusteischen Marmorbaues erhalten hatten: jede
Wand dreitheilig in der Breite, zweigetheilt in der Höhe, zwischen Sockel und
Gebälk. Diese letztere Theilung bewirkt hier der Triglyphenfries.1) Die reichlich
lebensgroßen Figuren von Göttern und Menschen, welche in diese Scheinarchitektur
hineingemalt sind, haben für den Vergleich mit der Ära Pacis nur insofern Be-
deutung, als sie vor der Wand, die ja auch nirgends durchbrochen ist, stehen oder
sitzen, einzeln oder gepaart, nicht wie Statuen, sondern wie lebendig. Höchstens
Venus mit Amor im Arm (Fig. 48) macht in der Zeichnung, in der sie allein
sich erhielt, fast den Eindruck einer Statue und ließe sich mit der Pax vergleichen.
Wie berechtigt es nun ist, diese Scheinarchitektur für eine Vorstufe der
römischen Wanddecorationen mit dem gesäulten Mittelbau zu halten, verrathen
diese letzteren überall durch Reminiscenzen der älteren Weise,2) und an den
Wänden des Boscoreale-Saales erkennt man es an dem die niedrige Wand
abschließenden Triglyphenfries, welcher aus dem ersten Stil sich vererbt hat.3)
Überdies bieten andere Zimmer der Villa anders gehaltene Decorationen, die
einen, wie namentlich die Wände des cubicolo, den palatinischen näherstehend,
die andern, wie im tviclinio ordinario und im estivo, mehr dem großen Triclinium
ähnelnd. Diese bilden also den Übergang von jener älteren in Boscoreale, vor-
herrschenden Decorationsweise zu der jüngeren der römischen Häuser. Eines aber
haben alle Wände der Villa noch bewahrt:4) der untere Wandtheil ist in der
x) Auch die Höhenmaße stimmen ziemlich über-
ein. Der Triglyphenfries ist so hoch wie der Mäander,
die Wand darunter so hoch wie die Rankenfelder.
2) Dass ursprünglich mit dem Ornamentband
(dem Mäander der Ära Pacis) die Wand abschloss,
ist noch daran zu erkennen, dass darauf öfter (wie in
Boscoreale Fig. 47) Bilder in Rahmen mit kleinen
Klappthüren stehen. Mon. ined. XI 22 f., XII 5 a,
ig, 23; desgleichen daran, dass häufig noch oben,
nur höher hinauf verlegt, Säulen rückwärtsliegender
Baulichkeiten hervorragen, so außer in den ange-
führten auch M. I. XII 17, 24, 28.
3) Mau, Geschichte S. 32.
4) Eine Ausnahme machen die Seiteninter-
columnien der Hinterwand des cubicolo (Fig. 49).
Denn während alle übrigen Intercolumnien dieses
Gemaches, je vier der Seitenwände (zwei davon in
Fig. 49 rechts sichtbar) und das mittlere der Hinter-
dementsprechend die Wand ohne Unterbrechung und in einerlei Höhe. Von unten
nach oben ist diese Scheinwand nicht zweitheilig-, sondern entspricht nur dem
unteren Wandtheil der Ära Pacis und in den römischen Häusern. Wie in diesen
liegt aber darüber das schmale Ornamentband; was an der Ära Pacis der Mäander,
ist hier ein dorischer Triglyphenfries. Dem oberen Wandtheil entspricht dagegen,
im Höhenverhältnis mehr mit den römischen gemalten Wänden übereinkommend
als mit der Ära Pacis, ein Durchblick in weiter zurückliegende Säulenhöfe und
Hallen. An jeder Seite des Saales, der mit 7-50 X 8-oom nahezu die Größe des
Altarhofes der Pax hatte, wiederholt sich also ziemlich genau dieselbe Gliederung,
welche die Frontwände des Augusteischen Marmorbaues erhalten hatten: jede
Wand dreitheilig in der Breite, zweigetheilt in der Höhe, zwischen Sockel und
Gebälk. Diese letztere Theilung bewirkt hier der Triglyphenfries.1) Die reichlich
lebensgroßen Figuren von Göttern und Menschen, welche in diese Scheinarchitektur
hineingemalt sind, haben für den Vergleich mit der Ära Pacis nur insofern Be-
deutung, als sie vor der Wand, die ja auch nirgends durchbrochen ist, stehen oder
sitzen, einzeln oder gepaart, nicht wie Statuen, sondern wie lebendig. Höchstens
Venus mit Amor im Arm (Fig. 48) macht in der Zeichnung, in der sie allein
sich erhielt, fast den Eindruck einer Statue und ließe sich mit der Pax vergleichen.
Wie berechtigt es nun ist, diese Scheinarchitektur für eine Vorstufe der
römischen Wanddecorationen mit dem gesäulten Mittelbau zu halten, verrathen
diese letzteren überall durch Reminiscenzen der älteren Weise,2) und an den
Wänden des Boscoreale-Saales erkennt man es an dem die niedrige Wand
abschließenden Triglyphenfries, welcher aus dem ersten Stil sich vererbt hat.3)
Überdies bieten andere Zimmer der Villa anders gehaltene Decorationen, die
einen, wie namentlich die Wände des cubicolo, den palatinischen näherstehend,
die andern, wie im tviclinio ordinario und im estivo, mehr dem großen Triclinium
ähnelnd. Diese bilden also den Übergang von jener älteren in Boscoreale, vor-
herrschenden Decorationsweise zu der jüngeren der römischen Häuser. Eines aber
haben alle Wände der Villa noch bewahrt:4) der untere Wandtheil ist in der
x) Auch die Höhenmaße stimmen ziemlich über-
ein. Der Triglyphenfries ist so hoch wie der Mäander,
die Wand darunter so hoch wie die Rankenfelder.
2) Dass ursprünglich mit dem Ornamentband
(dem Mäander der Ära Pacis) die Wand abschloss,
ist noch daran zu erkennen, dass darauf öfter (wie in
Boscoreale Fig. 47) Bilder in Rahmen mit kleinen
Klappthüren stehen. Mon. ined. XI 22 f., XII 5 a,
ig, 23; desgleichen daran, dass häufig noch oben,
nur höher hinauf verlegt, Säulen rückwärtsliegender
Baulichkeiten hervorragen, so außer in den ange-
führten auch M. I. XII 17, 24, 28.
3) Mau, Geschichte S. 32.
4) Eine Ausnahme machen die Seiteninter-
columnien der Hinterwand des cubicolo (Fig. 49).
Denn während alle übrigen Intercolumnien dieses
Gemaches, je vier der Seitenwände (zwei davon in
Fig. 49 rechts sichtbar) und das mittlere der Hinter-