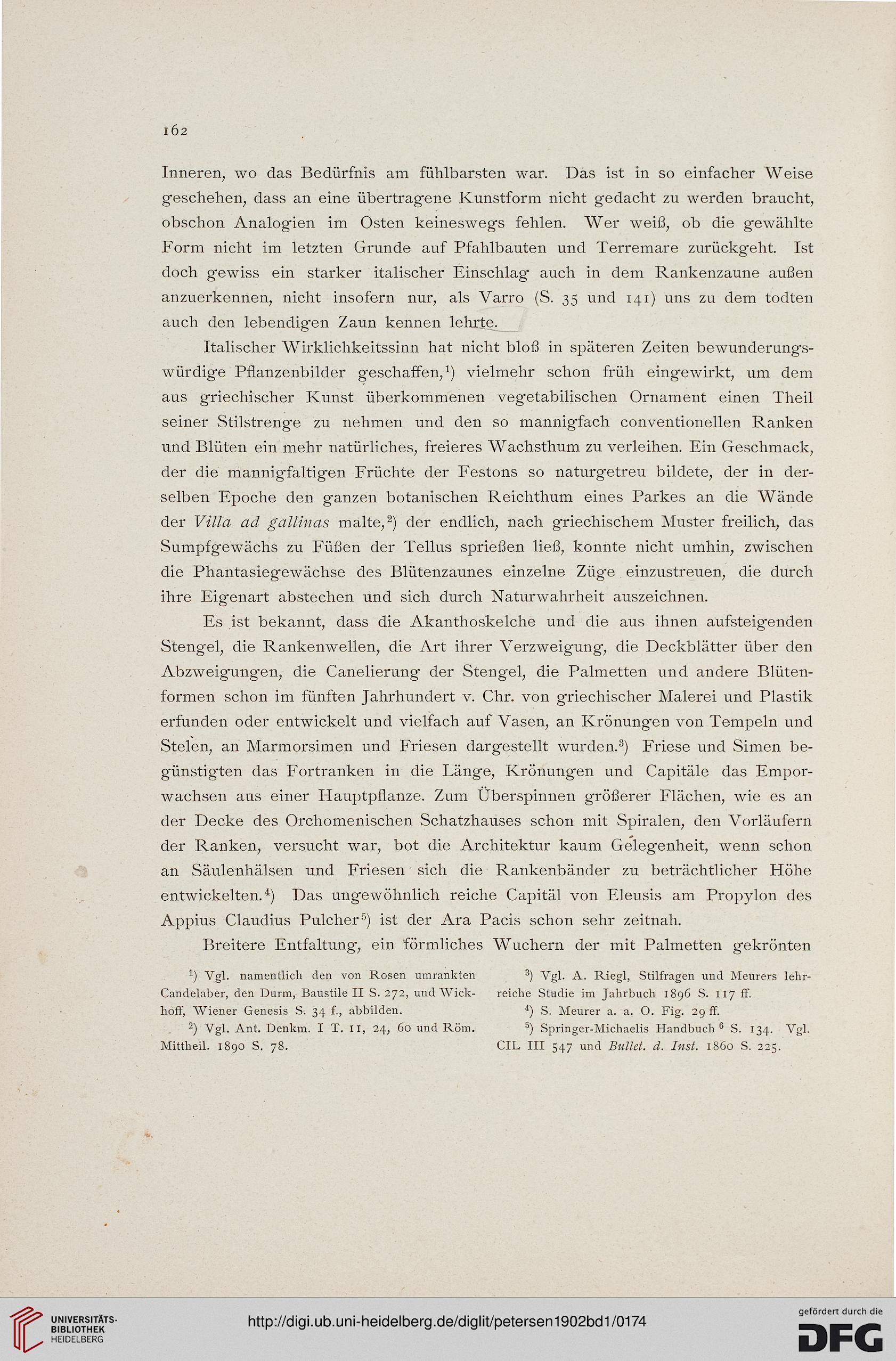IÖ2
Inneren, wo das Bedürfnis am fühlbarsten war. Das ist in so einfacher Weise
geschehen, dass an eine übertragene Kunstform nicht gedacht zu werden braucht,
obschon Analogien im Osten keineswegs fehlen. Wer weiß, ob die gewählte
Form nicht im letzten Grunde auf Pfahlbauten und Terremare zurückgeht. Ist
doch gewiss ein starker italischer Einschlag auch in dem Rankenzaune außen
anzuerkennen, nicht insofern nur, als Varro (S. 35 und 141) uns zu dem todten
auch den lebendigen Zaun kennen lehrte.
Italischer Wirklichkeitssinn hat nicht bloß in späteren Zeiten bewunderungs-
würdige Pfianzenbilder geschaffen,1) vielmehr schon früh eingewirkt, um dem
aus griechischer Kunst überkommenen vegetabilischen Ornament einen Theil
seiner Stilstrenge zu nehmen und den so mannigfach conventionellen Ranken
und Blüten ein mehr natürliches, freieres Wachsthum zu verleihen. Ein Geschmack,
der die mannigfaltigen Früchte der Festons so naturgetreu bildete, der in der-
selben Epoche den ganzen botanischen Reichthum eines Parkes an die Wände
der Villa ad gallinas malte,2) der endlich, nach griechischem Muster freilich, das
Sumpfgewächs zu Füßen der Tellus sprießen ließ, konnte nicht umhin, zwischen
die Phantasiegewächse des Blütenzaunes einzelne Züge einzustreuen, die durch
ihre Eigenart abstechen und sich durch Naturwahrheit auszeichnen.
Es ist bekannt, dass die Akanthoskelche und die aus ihnen aufsteigenden
Stengel, die Rankenwellen, die Art ihrer Verzweigung, die Deckblätter über den
Abzweigungen, die Canelierung der Stengel, die Palmetten und andere Blüten-
formen schon im fünften Jahrhundert v. Chr. von griechischer Malerei und Plastik
erfunden oder entwickelt und vielfach auf Vasen, an Krönungen von Tempeln und
Stelen, an Marmorsimen und Friesen dargestellt wurden.3) Friese und Simen be-
günstigten das Fortranken in die Länge, Krönungen und Capitäle das Empor-
wachsen aus einer Hauptpflanze. Zum Uberspinnen größerer Flächen, wie es an
der Decke des Orchomenischen Schatzhauses schon mit Spiralen, den Vorläufern
der Ranken, versucht war, bot die Architektur kaum Gelegenheit, wenn schon
an Säulenhälsen und Friesen sich die Rankenbänder zu beträchtlicher Höhe
entwickelten.4) Das ungewöhnlich reiche Capitäl von Eleusis am Propylon des
Appius Claudius Pulcher5) ist der Ära Pacis schon sehr zeitnah.
Breitere Entfaltung, ein förmliches Wuchern der mit Palmetten gekrönten
*) Vgl. namentlich den von Rosen umrankten 3) Vgl. A. Riegl, Stilfragen und Meurers lehr-
Candelaber, den Durm, Baustile II S. 272, und Wiek- reiche Studie im Jahrbuch 1896 S. 117 ff.
hoff, Wiener Genesis S. 34 f., abbilden. 4) S. Meurer a. a. O. Fig. 29 ff.
2) Vgl. Ant. Denkm. I T. II, 24, 60 und Rom. 5) Springer-Michaelis Handbuch 6 S. 134. Vgl.
Mittheil. 1890 S. 78. CIL III 547 und Bullet, d. Inst. 1860 S. 225.
Inneren, wo das Bedürfnis am fühlbarsten war. Das ist in so einfacher Weise
geschehen, dass an eine übertragene Kunstform nicht gedacht zu werden braucht,
obschon Analogien im Osten keineswegs fehlen. Wer weiß, ob die gewählte
Form nicht im letzten Grunde auf Pfahlbauten und Terremare zurückgeht. Ist
doch gewiss ein starker italischer Einschlag auch in dem Rankenzaune außen
anzuerkennen, nicht insofern nur, als Varro (S. 35 und 141) uns zu dem todten
auch den lebendigen Zaun kennen lehrte.
Italischer Wirklichkeitssinn hat nicht bloß in späteren Zeiten bewunderungs-
würdige Pfianzenbilder geschaffen,1) vielmehr schon früh eingewirkt, um dem
aus griechischer Kunst überkommenen vegetabilischen Ornament einen Theil
seiner Stilstrenge zu nehmen und den so mannigfach conventionellen Ranken
und Blüten ein mehr natürliches, freieres Wachsthum zu verleihen. Ein Geschmack,
der die mannigfaltigen Früchte der Festons so naturgetreu bildete, der in der-
selben Epoche den ganzen botanischen Reichthum eines Parkes an die Wände
der Villa ad gallinas malte,2) der endlich, nach griechischem Muster freilich, das
Sumpfgewächs zu Füßen der Tellus sprießen ließ, konnte nicht umhin, zwischen
die Phantasiegewächse des Blütenzaunes einzelne Züge einzustreuen, die durch
ihre Eigenart abstechen und sich durch Naturwahrheit auszeichnen.
Es ist bekannt, dass die Akanthoskelche und die aus ihnen aufsteigenden
Stengel, die Rankenwellen, die Art ihrer Verzweigung, die Deckblätter über den
Abzweigungen, die Canelierung der Stengel, die Palmetten und andere Blüten-
formen schon im fünften Jahrhundert v. Chr. von griechischer Malerei und Plastik
erfunden oder entwickelt und vielfach auf Vasen, an Krönungen von Tempeln und
Stelen, an Marmorsimen und Friesen dargestellt wurden.3) Friese und Simen be-
günstigten das Fortranken in die Länge, Krönungen und Capitäle das Empor-
wachsen aus einer Hauptpflanze. Zum Uberspinnen größerer Flächen, wie es an
der Decke des Orchomenischen Schatzhauses schon mit Spiralen, den Vorläufern
der Ranken, versucht war, bot die Architektur kaum Gelegenheit, wenn schon
an Säulenhälsen und Friesen sich die Rankenbänder zu beträchtlicher Höhe
entwickelten.4) Das ungewöhnlich reiche Capitäl von Eleusis am Propylon des
Appius Claudius Pulcher5) ist der Ära Pacis schon sehr zeitnah.
Breitere Entfaltung, ein förmliches Wuchern der mit Palmetten gekrönten
*) Vgl. namentlich den von Rosen umrankten 3) Vgl. A. Riegl, Stilfragen und Meurers lehr-
Candelaber, den Durm, Baustile II S. 272, und Wiek- reiche Studie im Jahrbuch 1896 S. 117 ff.
hoff, Wiener Genesis S. 34 f., abbilden. 4) S. Meurer a. a. O. Fig. 29 ff.
2) Vgl. Ant. Denkm. I T. II, 24, 60 und Rom. 5) Springer-Michaelis Handbuch 6 S. 134. Vgl.
Mittheil. 1890 S. 78. CIL III 547 und Bullet, d. Inst. 1860 S. 225.