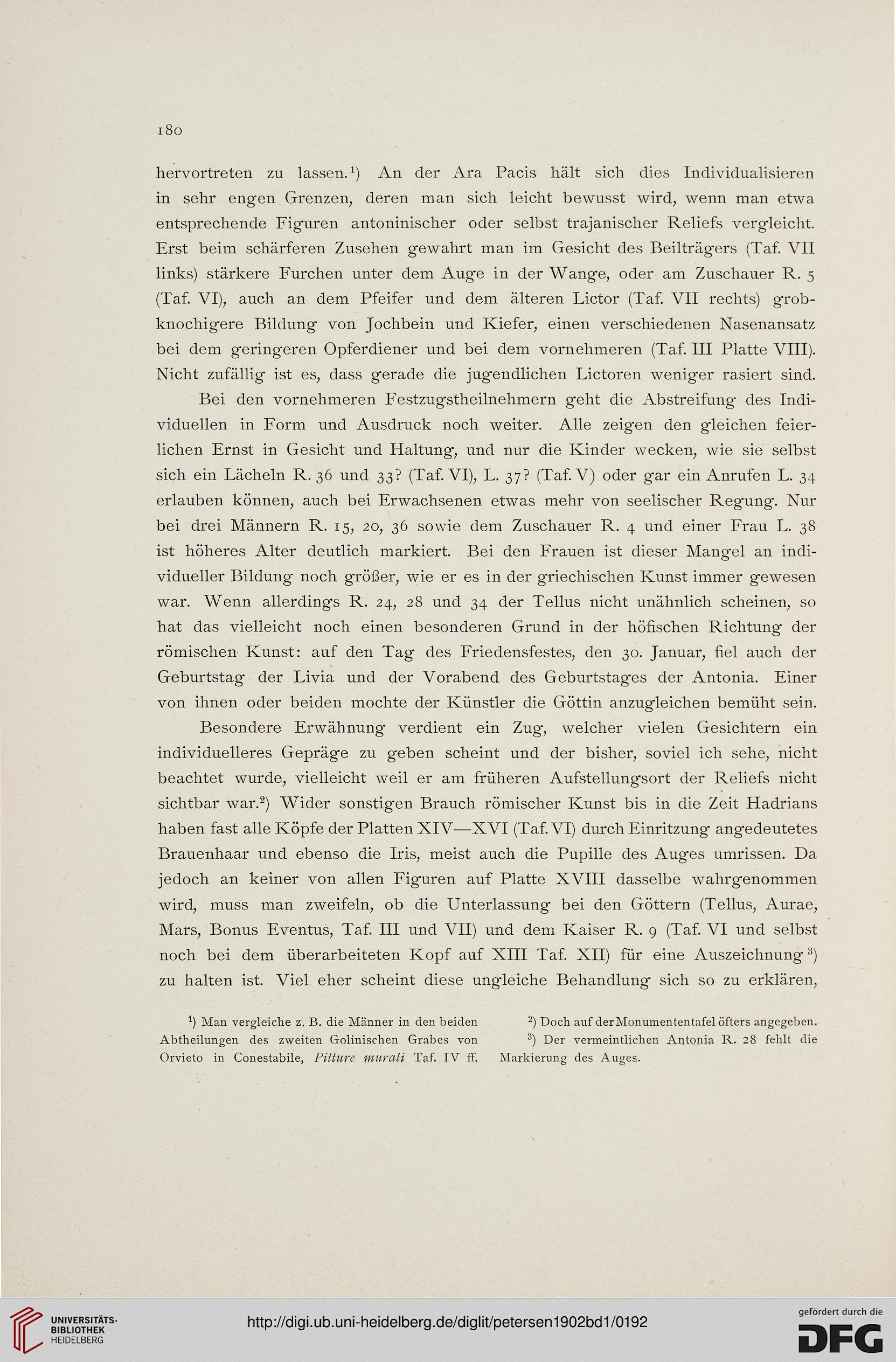i8o
hervortreten zu lassen.1) An der Ära Pacis hält sich dies Individualisieren
in sehr engen Grenzen, deren man sich leicht bewusst wird, wenn man etwa
entsprechende Figuren antoninischer oder selbst trajanischer Reliefs vergleicht.
Erst beim schärferen Zusehen gewahrt man im Gesicht des Beilträgers (Taf. VII
links) stärkere Furchen unter dem Auge in der Wange, oder am Zuschauer R. 5
(Taf. VI), auch an dem Pfeifer und dem älteren Lictor (Taf. VII rechts) grob-
knochigere Bildung von Jochbein und Kiefer, einen verschiedenen Nasenansatz
bei dem geringeren Opferdiener und bei dem vornehmeren (Taf. III Platte VIII).
Nicht zufällig ist es, dass gerade die jugendlichen Lictoren weniger rasiert sind.
Bei den vornehmeren Festzugstheilnehmern geht die Abstreifung- des Indi-
viduellen in Form und Ausdruck noch weiter. Alle zeigen den gleichen feier-
lichen Ernst in Gesicht und Haltung, und nur die Kinder wecken, wie sie selbst
sich ein Lächeln R. 36 und 33? (Taf. VI), L. 37? (Taf. V) oder gar ein Anrufen L. 34
erlauben können, auch bei Erwachsenen etwas mehr von seelischer Regung. Nur
bei drei Männern R. 15, 20, 36 sowie dem Zuschauer R. 4 und einer Frau L. 38
ist höheres Alter deutlich markiert. Bei den Frauen ist dieser Mangel an indi-
vidueller Bildung noch größer, wie er es in der griechischen Kunst immer gewesen
war. Wenn allerdings R. 24, 28 und 34 der Tellus nicht unähnlich scheinen, so
hat das vielleicht noch einen besonderen Grund in der höfischen Richtung der
römischen Kunst: auf den Tag des Friedensfestes, den 30. Januar, fiel auch der
Geburtstag der Livia und der Vorabend des Geburtstages der Antonia. Einer
von ihnen oder beiden mochte der Künstler die Göttin anzugleichen bemüht sein.
Besondere Erwähnung verdient ein Zug, welcher vielen Gesichtern ein
individuelleres Gepräge zu geben scheint und der bisher, soviel ich sehe, nicht
beachtet wurde, vielleicht weil er am früheren Aufstellungsort der Reliefs nicht
sichtbar war.2) Wider sonstigen Brauch römischer Kunst bis in die Zeit Hadrians
haben fast alle Köpfe der Platten XIV—XVI (Taf. VI) durch Einritzung angedeutetes
Brauenhaar und ebenso die Iris, meist auch die Pupille des Auges umrissen. Da
jedoch an keiner von allen Figuren auf Platte XVIII dasselbe wahrgenommen
wird, muss man zweifeln, ob die Unterlassung bei den Göttern (Tellus, Aurae,
Mars, Bonus Eventus, Taf. III und VII) und dem Kaiser R. 9 (Taf. VI und selbst
noch bei dem überarbeiteten Kopf auf XIII Taf. XII) für eine Auszeichnung3)
zu halten ist. Viel eher scheint diese ungleiche Behandlung sich so zu erklären,
*) Man vergleiche z. B. die Männer in den beiden 2) Doch auf der Monumententafel öfters angegeben.
Abtheilungen des zweiten Golinischen Grabes von 3) Der vermeintlichen Antonia R. 28 fehlt die
Orvieto in Conestabile, Pitture murali Taf. IV ff. Markierung des Auges.
hervortreten zu lassen.1) An der Ära Pacis hält sich dies Individualisieren
in sehr engen Grenzen, deren man sich leicht bewusst wird, wenn man etwa
entsprechende Figuren antoninischer oder selbst trajanischer Reliefs vergleicht.
Erst beim schärferen Zusehen gewahrt man im Gesicht des Beilträgers (Taf. VII
links) stärkere Furchen unter dem Auge in der Wange, oder am Zuschauer R. 5
(Taf. VI), auch an dem Pfeifer und dem älteren Lictor (Taf. VII rechts) grob-
knochigere Bildung von Jochbein und Kiefer, einen verschiedenen Nasenansatz
bei dem geringeren Opferdiener und bei dem vornehmeren (Taf. III Platte VIII).
Nicht zufällig ist es, dass gerade die jugendlichen Lictoren weniger rasiert sind.
Bei den vornehmeren Festzugstheilnehmern geht die Abstreifung- des Indi-
viduellen in Form und Ausdruck noch weiter. Alle zeigen den gleichen feier-
lichen Ernst in Gesicht und Haltung, und nur die Kinder wecken, wie sie selbst
sich ein Lächeln R. 36 und 33? (Taf. VI), L. 37? (Taf. V) oder gar ein Anrufen L. 34
erlauben können, auch bei Erwachsenen etwas mehr von seelischer Regung. Nur
bei drei Männern R. 15, 20, 36 sowie dem Zuschauer R. 4 und einer Frau L. 38
ist höheres Alter deutlich markiert. Bei den Frauen ist dieser Mangel an indi-
vidueller Bildung noch größer, wie er es in der griechischen Kunst immer gewesen
war. Wenn allerdings R. 24, 28 und 34 der Tellus nicht unähnlich scheinen, so
hat das vielleicht noch einen besonderen Grund in der höfischen Richtung der
römischen Kunst: auf den Tag des Friedensfestes, den 30. Januar, fiel auch der
Geburtstag der Livia und der Vorabend des Geburtstages der Antonia. Einer
von ihnen oder beiden mochte der Künstler die Göttin anzugleichen bemüht sein.
Besondere Erwähnung verdient ein Zug, welcher vielen Gesichtern ein
individuelleres Gepräge zu geben scheint und der bisher, soviel ich sehe, nicht
beachtet wurde, vielleicht weil er am früheren Aufstellungsort der Reliefs nicht
sichtbar war.2) Wider sonstigen Brauch römischer Kunst bis in die Zeit Hadrians
haben fast alle Köpfe der Platten XIV—XVI (Taf. VI) durch Einritzung angedeutetes
Brauenhaar und ebenso die Iris, meist auch die Pupille des Auges umrissen. Da
jedoch an keiner von allen Figuren auf Platte XVIII dasselbe wahrgenommen
wird, muss man zweifeln, ob die Unterlassung bei den Göttern (Tellus, Aurae,
Mars, Bonus Eventus, Taf. III und VII) und dem Kaiser R. 9 (Taf. VI und selbst
noch bei dem überarbeiteten Kopf auf XIII Taf. XII) für eine Auszeichnung3)
zu halten ist. Viel eher scheint diese ungleiche Behandlung sich so zu erklären,
*) Man vergleiche z. B. die Männer in den beiden 2) Doch auf der Monumententafel öfters angegeben.
Abtheilungen des zweiten Golinischen Grabes von 3) Der vermeintlichen Antonia R. 28 fehlt die
Orvieto in Conestabile, Pitture murali Taf. IV ff. Markierung des Auges.