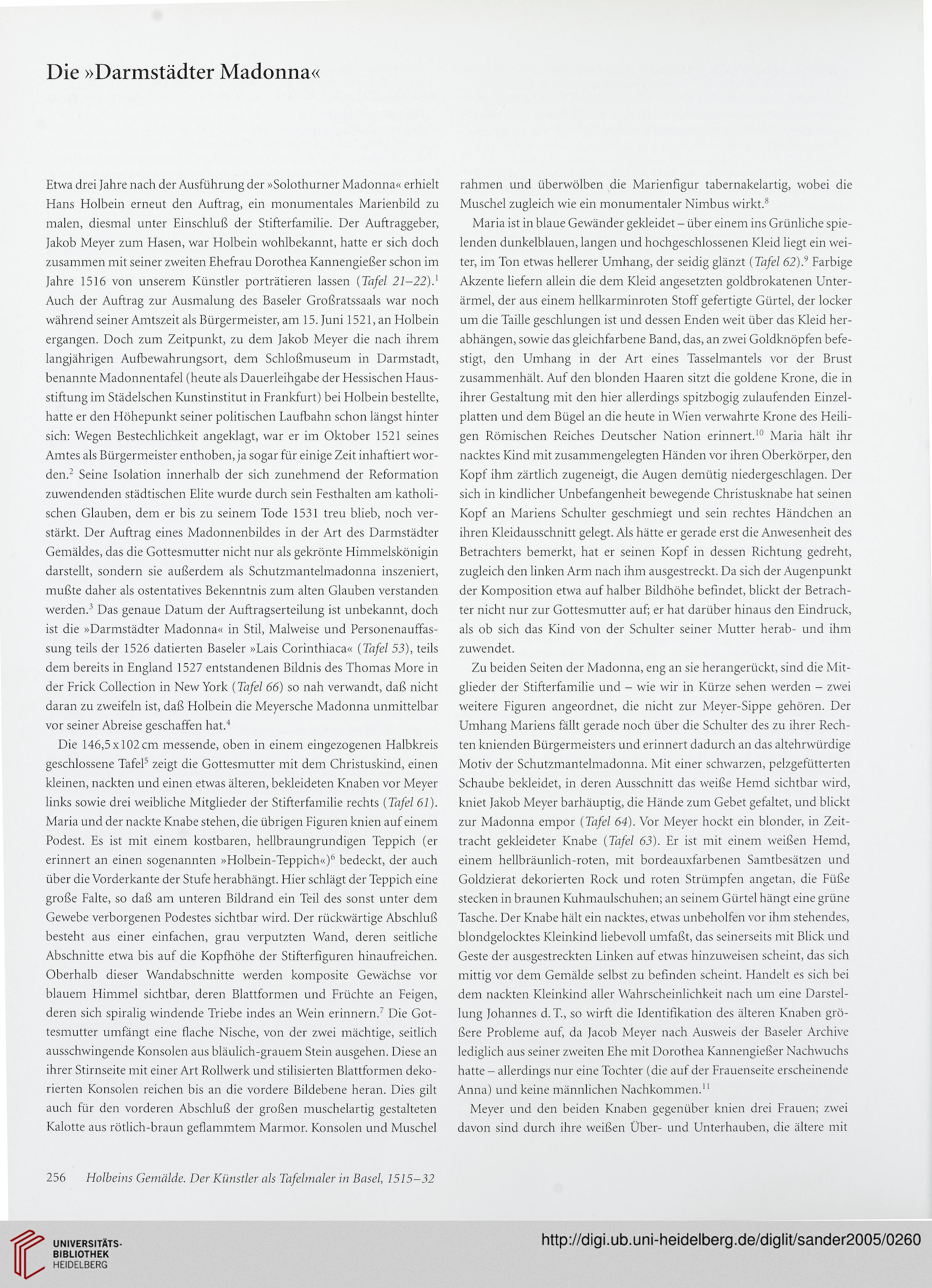Die »Darmstädter Madonna«
Etwa drei Jahre nach der Ausführung der »Solothurner Madonna« erhielt
Hans Holbein erneut den Auftrag, ein monumentales Marienbild zu
malen, diesmal unter Einschluß der Stifterfamilie. Der Auftraggeber,
Jakob Meyer zum Hasen, war Holbein wohlbekannt, hatte er sich doch
zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Dorothea Kannengießer schon im
Jahre 1516 von unserem Künstler porträtieren lassen (Tafel 21-22)}
Auch der Auftrag zur Ausmalung des Baseler Großratssaals war noch
während seiner Amtszeit als Bürgermeister, am 15. Juni 1521, an Holbein
ergangen. Doch zum Zeitpunkt, zu dem Jakob Meyer die nach ihrem
langjährigen Aufbewahrungsort, dem Schloßmuseum in Darmstadt,
benannte Madonnentafel (heute als Dauerleihgabe der Hessischen Haus-
stiftung im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt) bei Holbein bestellte,
hatte er den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn schon längst hinter
sich: Wegen Bestechlichkeit angeklagt, war er im Oktober 1521 seines
Amtes als Bürgermeister enthoben, ja sogar für einige Zeit inhaftiert wor-
den.2 Seine Isolation innerhalb der sich zunehmend der Reformation
zuwendenden städtischen Elite wurde durch sein Festhalten am katholi-
schen Glauben, dem er bis zu seinem Tode 1531 treu blieb, noch ver-
stärkt. Der Auftrag eines Madonnenbildes in der Art des Darmstädter
Gemäldes, das die Gottesmutter nicht nur als gekrönte Himmelskönigin
darstellt, sondern sie außerdem als Schutzmantelmadonna inszeniert,
mußte daher als ostentatives Bekenntnis zum alten Glauben verstanden
werden.3 Das genaue Datum der Auftragserteilung ist unbekannt, doch
ist die »Darmstädter Madonna« in Stil, Malweise und Personenauffas-
sung teils der 1526 datierten Baseler »Lais Corinthiaca« [Tafel 53), teils
dem bereits in England 1527 entstandenen Bildnis des Thomas More in
der Frick Collection in New York [Tafel 66) so nah verwandt, daß nicht
daran zu zweifeln ist, daß Holbein die Meyersche Madonna unmittelbar
vor seiner Abreise geschaffen hat.4
Die 146,5x102cm messende, oben in einem eingezogenen Halbkreis
geschlossene Tafel5 zeigt die Gottesmutter mit dem Christuskind, einen
kleinen, nackten und einen etwas älteren, bekleideten Knaben vor Meyer
links sowie drei weibliche Mitglieder der Stifterfamilie rechts (Tafel 61).
Maria und der nackte Knabe stehen, die übrigen Figuren knien auf einem
Podest. Es ist mit einem kostbaren, hellbraungrundigen Teppich (er
erinnert an einen sogenannten »Holbein-Teppich«)6 bedeckt, der auch
über die Vorderkante der Stufe herabhängt. Hier schlägt der Teppich eine
große Falte, so daß am unteren Bildrand ein Teil des sonst unter dem
Gewebe verborgenen Podestes sichtbar wird. Der rückwärtige Abschluß
besteht aus einer einfachen, grau verputzten Wand, deren seitliche
Abschnitte etwa bis auf die Kopfhöhe der Stifterfiguren hinaufreichen.
Oberhalb dieser Wandabschnitte werden komposite Gewächse vor
blauem Himmel sichtbar, deren Blattformen und Früchte an Feigen,
deren sich spiralig windende Triebe indes an Wein erinnern.' Die Got-
tesmutter umfängt eine flache Nische, von der zwei mächtige, seitlich
ausschwingende Konsolen aus bläulich-grauem Stein ausgehen. Diese an
ihrer Stirnseite mit einer Art Rollwerk und stilisierten Blattformen deko-
rierten Konsolen reichen bis an die vordere Bildebene heran. Dies eilt
D
auch für den vorderen Abschluß der großen muschelartig gestalteten
Kalotte aus rötlich-braun geflammtem Marmor. Konsolen und Muschel
rahmen und überwölben die Marienfigur tabernakelartig, wobei die
Muschel zugleich wie ein monumentaler Nimbus wirkt.s
Maria ist in blaue Gewänder gekleidet - über einem ins Grünliche spie-
lenden dunkelblauen, langen und hochgeschlossenen Kleid liegt ein wei-
ter, im Ton etwas hellerer Umhang, der seidig glänzt (Tafel 62).9 Farbige
Akzente liefern allein die dem Kleid angesetzten goldbrokatenen Unter-
ärmel, der aus einem hellkarminroten Stoff gefertigte Gürtel, der locker
um die Taille geschlungen ist und dessen Enden weit über das Kleid her-
abhängen, sowie das gleichfarbene Band, das, an zwei Goldknöpfen befe-
stigt, den Umhang in der Art eines Tasselmantels vor der Brust
zusammenhält. Auf den blonden Haaren sitzt die goldene Krone, die in
ihrer Gestaltung mit den hier allerdings spitzbogig zulaufenden Einzel-
platten und dem Bügel an die heute in Wien verwahrte Krone des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation erinnert.10 Maria hält ihr
nacktes Kind mit zusammengelegten Händen vor ihren Oberkörper, den
Kopf ihm zärtlich zugeneigt, die Augen demütig niedergeschlagen. Der
sich in kindlicher Unbefangenheit bewegende Christusknabe hat seinen
Kopf an Mariens Schulter geschmiegt und sein rechtes Händchen an
ihren Kleidausschnitt gelegt. Als hätte er gerade erst die Anwesenheit des
Betrachters bemerkt, hat er seinen Kopf in dessen Richtung gedreht,
zugleich den linken Arm nach ihm ausgestreckt. Da sich der Augenpunkt
der Komposition etwa auf halber Bildhöhe befindet, blickt der Betrach-
ter nicht nur zur Gottesmutter auf; er hat darüber hinaus den Eindruck,
als ob sich das Kind von der Schulter seiner Mutter herab- und ihm
zuwendet.
Zu beiden Seiten der Madonna, eng an sie herangerückt, sind die Mit-
glieder der Stifterfamilie und - wie wir in Kürze sehen werden - zwei
weitere Figuren angeordnet, die nicht zur Meyer-Sippe gehören. Der
Umhang Mariens fällt gerade noch über die Schulter des zu ihrer Rech-
ten knienden Bürgermeisters und erinnert dadurch an das altehrwürdige
Motiv der Schutzmantelmadonna. Mit einer schwarzen, pelzgefütterten
Schaube bekleidet, in deren Ausschnitt das weiße Hemd sichtbar wird,
kniet Jakob Meyer barhäuptig, die Hände zum Gebet gefaltet, und blickt
zur Madonna empor (Tafel 64). Vor Meyer hockt ein blonder, in Zeit-
tracht gekleideter Knabe (Tafel 63). Er ist mit einem weißen Hemd,
einem hellbräunlich-roten, mit bordeauxfarbenen Samtbesätzen und
Goldzierat dekorierten Rock und roten Strümpfen angetan, die Füße
stecken in braunen Kuhmaulschuhen; an seinem Gürtel hängt eine grüne
Tasche. Der Knabe hält ein nacktes, etwas unbeholfen vor ihm stehendes,
blondgelocktes Kleinkind liebevoll umfaßt, das seinerseits mit Blick und
Geste der ausgestreckten Linken auf etwas hinzuweisen scheint, das sich
mittig vor dem Gemälde selbst zu befinden scheint. Handelt es sich bei
dem nackten Kleinkind aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Darstel-
lung Johannes d. T, so wirft die Identifikation des älteren Knaben grö-
ßere Probleme auf, da Jacob Meyer nach Ausweis der Baseler Archive
lediglich aus seiner zweiten Ehe mit Dorothea Kannengießer Nachwuchs
hatte - allerdings nur eine Tochter (die auf der Frauenseite erscheinende
Anna) und keine männlichen Nachkommen."
Meyer und den beiden Knaben gegenüber knien drei Frauen; zwei
davon sind durch ihre weißen Über- und Unterhauben, die ältere mit
256 Holbeins Gemälde. Der Künstler als Tafelmaler in Basel, 1515-32
Etwa drei Jahre nach der Ausführung der »Solothurner Madonna« erhielt
Hans Holbein erneut den Auftrag, ein monumentales Marienbild zu
malen, diesmal unter Einschluß der Stifterfamilie. Der Auftraggeber,
Jakob Meyer zum Hasen, war Holbein wohlbekannt, hatte er sich doch
zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Dorothea Kannengießer schon im
Jahre 1516 von unserem Künstler porträtieren lassen (Tafel 21-22)}
Auch der Auftrag zur Ausmalung des Baseler Großratssaals war noch
während seiner Amtszeit als Bürgermeister, am 15. Juni 1521, an Holbein
ergangen. Doch zum Zeitpunkt, zu dem Jakob Meyer die nach ihrem
langjährigen Aufbewahrungsort, dem Schloßmuseum in Darmstadt,
benannte Madonnentafel (heute als Dauerleihgabe der Hessischen Haus-
stiftung im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt) bei Holbein bestellte,
hatte er den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn schon längst hinter
sich: Wegen Bestechlichkeit angeklagt, war er im Oktober 1521 seines
Amtes als Bürgermeister enthoben, ja sogar für einige Zeit inhaftiert wor-
den.2 Seine Isolation innerhalb der sich zunehmend der Reformation
zuwendenden städtischen Elite wurde durch sein Festhalten am katholi-
schen Glauben, dem er bis zu seinem Tode 1531 treu blieb, noch ver-
stärkt. Der Auftrag eines Madonnenbildes in der Art des Darmstädter
Gemäldes, das die Gottesmutter nicht nur als gekrönte Himmelskönigin
darstellt, sondern sie außerdem als Schutzmantelmadonna inszeniert,
mußte daher als ostentatives Bekenntnis zum alten Glauben verstanden
werden.3 Das genaue Datum der Auftragserteilung ist unbekannt, doch
ist die »Darmstädter Madonna« in Stil, Malweise und Personenauffas-
sung teils der 1526 datierten Baseler »Lais Corinthiaca« [Tafel 53), teils
dem bereits in England 1527 entstandenen Bildnis des Thomas More in
der Frick Collection in New York [Tafel 66) so nah verwandt, daß nicht
daran zu zweifeln ist, daß Holbein die Meyersche Madonna unmittelbar
vor seiner Abreise geschaffen hat.4
Die 146,5x102cm messende, oben in einem eingezogenen Halbkreis
geschlossene Tafel5 zeigt die Gottesmutter mit dem Christuskind, einen
kleinen, nackten und einen etwas älteren, bekleideten Knaben vor Meyer
links sowie drei weibliche Mitglieder der Stifterfamilie rechts (Tafel 61).
Maria und der nackte Knabe stehen, die übrigen Figuren knien auf einem
Podest. Es ist mit einem kostbaren, hellbraungrundigen Teppich (er
erinnert an einen sogenannten »Holbein-Teppich«)6 bedeckt, der auch
über die Vorderkante der Stufe herabhängt. Hier schlägt der Teppich eine
große Falte, so daß am unteren Bildrand ein Teil des sonst unter dem
Gewebe verborgenen Podestes sichtbar wird. Der rückwärtige Abschluß
besteht aus einer einfachen, grau verputzten Wand, deren seitliche
Abschnitte etwa bis auf die Kopfhöhe der Stifterfiguren hinaufreichen.
Oberhalb dieser Wandabschnitte werden komposite Gewächse vor
blauem Himmel sichtbar, deren Blattformen und Früchte an Feigen,
deren sich spiralig windende Triebe indes an Wein erinnern.' Die Got-
tesmutter umfängt eine flache Nische, von der zwei mächtige, seitlich
ausschwingende Konsolen aus bläulich-grauem Stein ausgehen. Diese an
ihrer Stirnseite mit einer Art Rollwerk und stilisierten Blattformen deko-
rierten Konsolen reichen bis an die vordere Bildebene heran. Dies eilt
D
auch für den vorderen Abschluß der großen muschelartig gestalteten
Kalotte aus rötlich-braun geflammtem Marmor. Konsolen und Muschel
rahmen und überwölben die Marienfigur tabernakelartig, wobei die
Muschel zugleich wie ein monumentaler Nimbus wirkt.s
Maria ist in blaue Gewänder gekleidet - über einem ins Grünliche spie-
lenden dunkelblauen, langen und hochgeschlossenen Kleid liegt ein wei-
ter, im Ton etwas hellerer Umhang, der seidig glänzt (Tafel 62).9 Farbige
Akzente liefern allein die dem Kleid angesetzten goldbrokatenen Unter-
ärmel, der aus einem hellkarminroten Stoff gefertigte Gürtel, der locker
um die Taille geschlungen ist und dessen Enden weit über das Kleid her-
abhängen, sowie das gleichfarbene Band, das, an zwei Goldknöpfen befe-
stigt, den Umhang in der Art eines Tasselmantels vor der Brust
zusammenhält. Auf den blonden Haaren sitzt die goldene Krone, die in
ihrer Gestaltung mit den hier allerdings spitzbogig zulaufenden Einzel-
platten und dem Bügel an die heute in Wien verwahrte Krone des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation erinnert.10 Maria hält ihr
nacktes Kind mit zusammengelegten Händen vor ihren Oberkörper, den
Kopf ihm zärtlich zugeneigt, die Augen demütig niedergeschlagen. Der
sich in kindlicher Unbefangenheit bewegende Christusknabe hat seinen
Kopf an Mariens Schulter geschmiegt und sein rechtes Händchen an
ihren Kleidausschnitt gelegt. Als hätte er gerade erst die Anwesenheit des
Betrachters bemerkt, hat er seinen Kopf in dessen Richtung gedreht,
zugleich den linken Arm nach ihm ausgestreckt. Da sich der Augenpunkt
der Komposition etwa auf halber Bildhöhe befindet, blickt der Betrach-
ter nicht nur zur Gottesmutter auf; er hat darüber hinaus den Eindruck,
als ob sich das Kind von der Schulter seiner Mutter herab- und ihm
zuwendet.
Zu beiden Seiten der Madonna, eng an sie herangerückt, sind die Mit-
glieder der Stifterfamilie und - wie wir in Kürze sehen werden - zwei
weitere Figuren angeordnet, die nicht zur Meyer-Sippe gehören. Der
Umhang Mariens fällt gerade noch über die Schulter des zu ihrer Rech-
ten knienden Bürgermeisters und erinnert dadurch an das altehrwürdige
Motiv der Schutzmantelmadonna. Mit einer schwarzen, pelzgefütterten
Schaube bekleidet, in deren Ausschnitt das weiße Hemd sichtbar wird,
kniet Jakob Meyer barhäuptig, die Hände zum Gebet gefaltet, und blickt
zur Madonna empor (Tafel 64). Vor Meyer hockt ein blonder, in Zeit-
tracht gekleideter Knabe (Tafel 63). Er ist mit einem weißen Hemd,
einem hellbräunlich-roten, mit bordeauxfarbenen Samtbesätzen und
Goldzierat dekorierten Rock und roten Strümpfen angetan, die Füße
stecken in braunen Kuhmaulschuhen; an seinem Gürtel hängt eine grüne
Tasche. Der Knabe hält ein nacktes, etwas unbeholfen vor ihm stehendes,
blondgelocktes Kleinkind liebevoll umfaßt, das seinerseits mit Blick und
Geste der ausgestreckten Linken auf etwas hinzuweisen scheint, das sich
mittig vor dem Gemälde selbst zu befinden scheint. Handelt es sich bei
dem nackten Kleinkind aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Darstel-
lung Johannes d. T, so wirft die Identifikation des älteren Knaben grö-
ßere Probleme auf, da Jacob Meyer nach Ausweis der Baseler Archive
lediglich aus seiner zweiten Ehe mit Dorothea Kannengießer Nachwuchs
hatte - allerdings nur eine Tochter (die auf der Frauenseite erscheinende
Anna) und keine männlichen Nachkommen."
Meyer und den beiden Knaben gegenüber knien drei Frauen; zwei
davon sind durch ihre weißen Über- und Unterhauben, die ältere mit
256 Holbeins Gemälde. Der Künstler als Tafelmaler in Basel, 1515-32