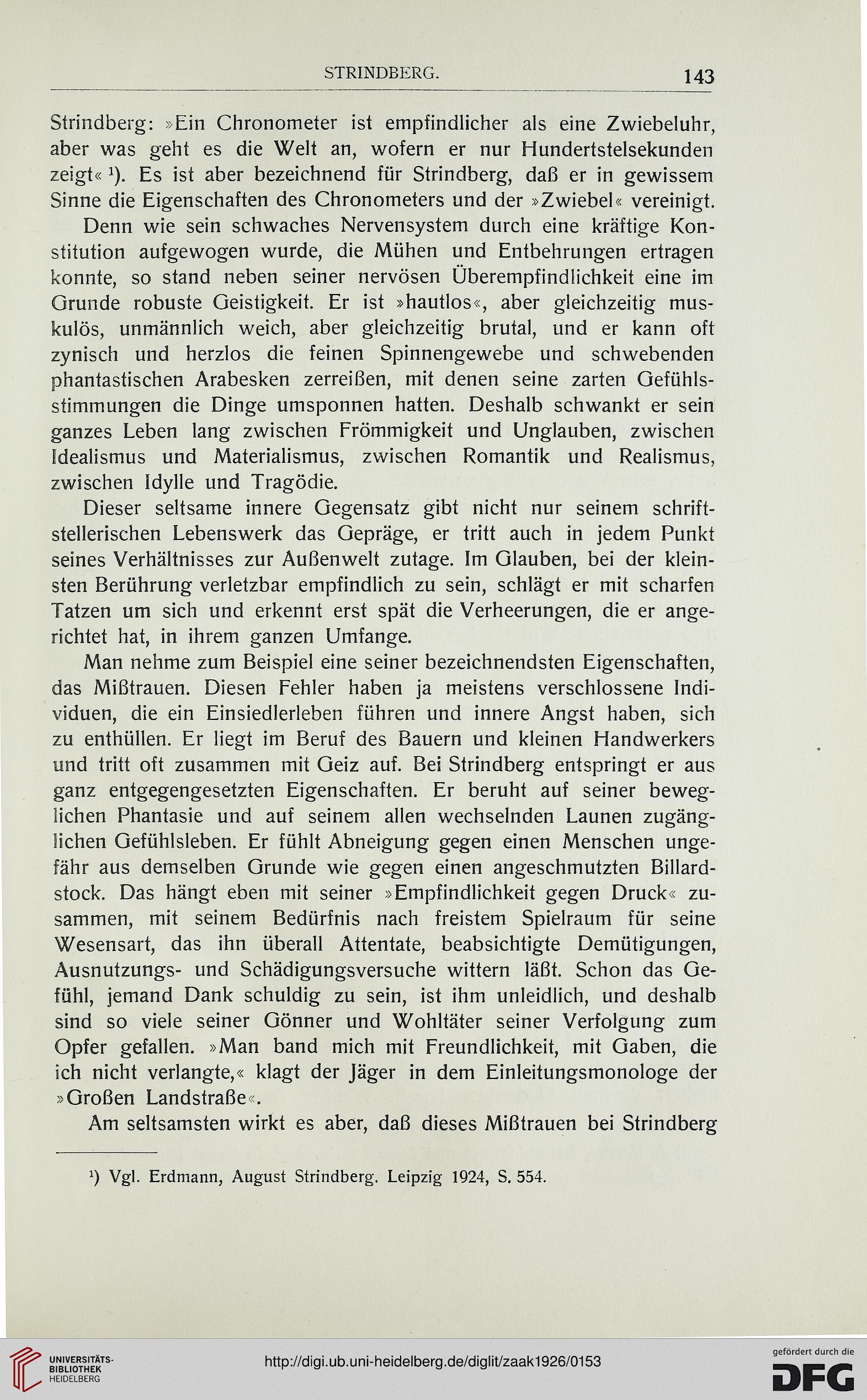STRINDBERG.
143
Strindberg: »Ein Chronometer ist empfindlicher als eine Zwiebeluhr,
aber was geht es die Welt an, wofern er nur Hundertstelsekunden
zeigt«J). Es ist aber bezeichnend für Strindberg, daß er in gewissem
Sinne die Eigenschaften des Chronometers und der »Zwiebel« vereinigt.
Denn wie sein schwaches Nervensystem durch eine kräftige Kon-
stitution aufgewogen wurde, die Mühen und Entbehrungen ertragen
konnte, so stand neben seiner nervösen Überempfindlichkeit eine im
Grunde robuste Geistigkeit. Er ist »hautlos«, aber gleichzeitig mus-
kulös, unmännlich weich, aber gleichzeitig brutal, und er kann oft
zynisch und herzlos die feinen Spinnengewebe und schwebenden
phantastischen Arabesken zerreißen, mit denen seine zarten Gefühls-
stimmungen die Dinge umsponnen hatten. Deshalb schwankt er sein
ganzes Leben lang zwischen Frömmigkeit und Unglauben, zwischen
Idealismus und Materialismus, zwischen Romantik und Realismus,
zwischen Idylle und Tragödie.
Dieser seltsame innere Gegensatz gibt nicht nur seinem schrift-
stellerischen Lebenswerk das Gepräge, er tritt auch in jedem Punkt
seines Verhältnisses zur Außenwelt zutage. Im Glauben, bei der klein-
sten Berührung verletzbar empfindlich zu sein, schlägt er mit scharfen
Tatzen um sich und erkennt erst spät die Verheerungen, die er ange-
richtet hat, in ihrem ganzen Umfange.
Man nehme zum Beispiel eine seiner bezeichnendsten Eigenschaften,
das Mißtrauen. Diesen Fehler haben ja meistens verschlossene Indi-
viduen, die ein Einsiedlerleben führen und innere Angst haben, sich
zu enthüllen. Er liegt im Beruf des Bauern und kleinen Handwerkers
und tritt oft zusammen mit Geiz auf. Bei Strindberg entspringt er aus
ganz entgegengesetzten Eigenschaften. Er beruht auf seiner beweg-
lichen Phantasie und auf seinem allen wechselnden Launen zugäng-
lichen Gefühlsleben. Er fühlt Abneigung gegen einen Menschen unge-
fähr aus demselben Grunde wie gegen einen angeschmutzten Billard-
stock. Das hängt eben mit seiner »Empfindlichkeit gegen Druck« zu-
sammen, mit seinem Bedürfnis nach freistem Spielraum für seine
Wesensart, das ihn überall Attentate, beabsichtigte Demütigungen,
Ausnutzungs- und Schädigungsversuche wittern läßt. Schon das Ge-
fühl, jemand Dank schuldig zu sein, ist ihm unleidlich, und deshalb
sind so viele seiner Gönner und Wohltäter seiner Verfolgung zum
Opfer gefallen. »Man band mich mit Freundlichkeit, mit Gaben, die
ich nicht verlangte,« klagt der Jäger in dem Einleitungsmonologe der
»Großen Landstraße«.
Am seltsamsten wirkt es aber, daß dieses Mißtrauen bei Strindberg
*) Vgl. Erdmann, August Strindberg. Leipzig 1924, S. 554.
143
Strindberg: »Ein Chronometer ist empfindlicher als eine Zwiebeluhr,
aber was geht es die Welt an, wofern er nur Hundertstelsekunden
zeigt«J). Es ist aber bezeichnend für Strindberg, daß er in gewissem
Sinne die Eigenschaften des Chronometers und der »Zwiebel« vereinigt.
Denn wie sein schwaches Nervensystem durch eine kräftige Kon-
stitution aufgewogen wurde, die Mühen und Entbehrungen ertragen
konnte, so stand neben seiner nervösen Überempfindlichkeit eine im
Grunde robuste Geistigkeit. Er ist »hautlos«, aber gleichzeitig mus-
kulös, unmännlich weich, aber gleichzeitig brutal, und er kann oft
zynisch und herzlos die feinen Spinnengewebe und schwebenden
phantastischen Arabesken zerreißen, mit denen seine zarten Gefühls-
stimmungen die Dinge umsponnen hatten. Deshalb schwankt er sein
ganzes Leben lang zwischen Frömmigkeit und Unglauben, zwischen
Idealismus und Materialismus, zwischen Romantik und Realismus,
zwischen Idylle und Tragödie.
Dieser seltsame innere Gegensatz gibt nicht nur seinem schrift-
stellerischen Lebenswerk das Gepräge, er tritt auch in jedem Punkt
seines Verhältnisses zur Außenwelt zutage. Im Glauben, bei der klein-
sten Berührung verletzbar empfindlich zu sein, schlägt er mit scharfen
Tatzen um sich und erkennt erst spät die Verheerungen, die er ange-
richtet hat, in ihrem ganzen Umfange.
Man nehme zum Beispiel eine seiner bezeichnendsten Eigenschaften,
das Mißtrauen. Diesen Fehler haben ja meistens verschlossene Indi-
viduen, die ein Einsiedlerleben führen und innere Angst haben, sich
zu enthüllen. Er liegt im Beruf des Bauern und kleinen Handwerkers
und tritt oft zusammen mit Geiz auf. Bei Strindberg entspringt er aus
ganz entgegengesetzten Eigenschaften. Er beruht auf seiner beweg-
lichen Phantasie und auf seinem allen wechselnden Launen zugäng-
lichen Gefühlsleben. Er fühlt Abneigung gegen einen Menschen unge-
fähr aus demselben Grunde wie gegen einen angeschmutzten Billard-
stock. Das hängt eben mit seiner »Empfindlichkeit gegen Druck« zu-
sammen, mit seinem Bedürfnis nach freistem Spielraum für seine
Wesensart, das ihn überall Attentate, beabsichtigte Demütigungen,
Ausnutzungs- und Schädigungsversuche wittern läßt. Schon das Ge-
fühl, jemand Dank schuldig zu sein, ist ihm unleidlich, und deshalb
sind so viele seiner Gönner und Wohltäter seiner Verfolgung zum
Opfer gefallen. »Man band mich mit Freundlichkeit, mit Gaben, die
ich nicht verlangte,« klagt der Jäger in dem Einleitungsmonologe der
»Großen Landstraße«.
Am seltsamsten wirkt es aber, daß dieses Mißtrauen bei Strindberg
*) Vgl. Erdmann, August Strindberg. Leipzig 1924, S. 554.