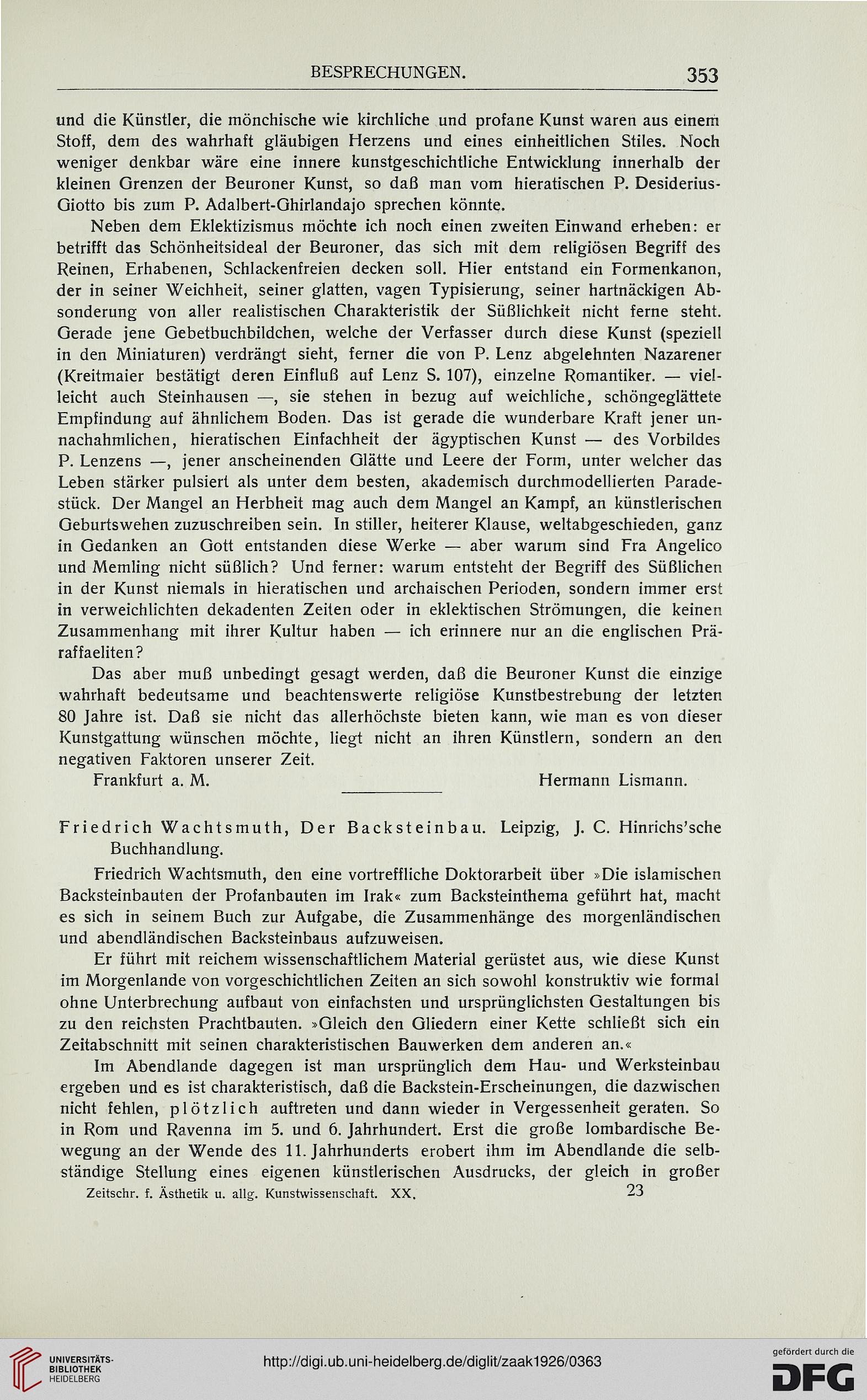BESPRECHUNGEN.
353
und die Künstler, die mönchische wie kirchliche und profane Kunst waren aus einem
Stoff, dem des wahrhaft gläubigen Herzens und eines einheitlichen Stiles. Noch
weniger denkbar wäre eine innere kunstgeschichtliche Entwicklung innerhalb der
kleinen Grenzen der Beuroner Kunst, so daß man vom hieratischen P. Desiderius-
Giotto bis zum P. Adalbert-Ghirlandajo sprechen könnte.
Neben dem Eklektizismus möchte ich noch einen zweiten Einwand erheben: er
betrifft das Schönheitsideal der Beuroner, das sich mit dem religiösen Begriff des
Reinen, Erhabenen, Schlackenfreien decken soll. Hier entstand ein Formenkanon,
der in seiner Weichheit, seiner glatten, vagen Typisierung, seiner hartnäckigen Ab-
sonderung von aller realistischen Charakteristik der Süßlichkeit nicht ferne steht.
Gerade jene Gebetbuchbildchen, welche der Verfasser durch diese Kunst (speziell
in den Miniaturen) verdrängt sieht, ferner die von P. Lenz abgelehnten Nazarener
(Kreitmaier bestätigt deren Einfluß auf Lenz S. 107), einzelne Romantiker. — viel-
leicht auch Steinhausen —, sie stehen in bezug auf weichliche, schöngeglättete
Empfindung auf ähnlichem Boden. Das ist gerade die wunderbare Kraft jener un-
nachahmlichen, hieratischen Einfachheit der ägyptischen Kunst — des Vorbildes
P. Lenzens —, jener anscheinenden Glätte und Leere der Form, unter welcher das
Leben stärker pulsiert als unter dem besten, akademisch durchmodellierten Parade-
stück. Der Mangel an Herbheit mag auch dem Mangel an Kampf, an künstlerischen
Geburtswehen zuzuschreiben sein. In stiller, heiterer Klause, weltabgeschieden, ganz
in Gedanken an Gott entstanden diese Werke — aber warum sind Fra Angelico
und Memling nicht süßlich? Und ferner: warum entsteht der Begriff des Süßlichen
in der Kunst niemals in hieratischen und archaischen Perioden, sondern immer erst
in verweichlichten dekadenten Zeiten oder in eklektischen Strömungen, die keinen
Zusammenhang mit ihrer Kultur haben — ich erinnere nur an die englischen Prä-
raffaeliten?
Das aber muß unbedingt gesagt werden, daß die Beuroner Kunst die einzige
wahrhaft bedeutsame und beachtenswerte religiöse Kunstbestrebung der letzten
80 Jahre ist. Daß sie nicht das allerhöchste bieten kann, wie man es von dieser
Kunstgattung wünschen möchte, liegt nicht an ihren Künstlern, sondern an den
negativen Faktoren unserer Zeit.
Frankfurt a. M. Hermann Lismann.
Friedrich Wachtsmuth, Der Backsteinbau. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche
Buchhandlung.
Friedrich Wachtsmuth, den eine vortreffliche Doktorarbeit über »Die islamischen
Backsteinbauten der Profanbauten im Irak« zum Backsteinthema geführt hat, macht
es sich in seinem Buch zur Aufgabe, die Zusammenhänge des morgenländischen
und abendländischen Backsteinbaus aufzuweisen.
Er führt mit reichem wissenschaftlichem Material gerüstet aus, wie diese Kunst
im Morgenlande von vorgeschichtlichen Zeiten an sich sowohl konstruktiv wie formal
ohne Unterbrechung aufbaut von einfachsten und ursprünglichsten Gestaltungen bis
zu den reichsten Prachtbauten. »Gleich den Gliedern einer Kette schließt sich ein
Zeitabschnitt mit seinen charakteristischen Bauwerken dem anderen an.«
Im Abendlande dagegen ist man ursprünglich dem Hau- und Werksteinbau
ergeben und es ist charakteristisch, daß die Backstein-Erscheinungen, die dazwischen
nicht fehlen, plötzlich auftreten und dann wieder in Vergessenheit geraten. So
in Rom und Ravenna im 5. und 6. Jahrhundert. Erst die große lombardische Be-
wegung an der Wende des 11. Jahrhunderts erobert ihm im Abendlande die selb-
ständige Stellung eines eigenen künstlerischen Ausdrucks, der gleich in großer
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XX. 23
353
und die Künstler, die mönchische wie kirchliche und profane Kunst waren aus einem
Stoff, dem des wahrhaft gläubigen Herzens und eines einheitlichen Stiles. Noch
weniger denkbar wäre eine innere kunstgeschichtliche Entwicklung innerhalb der
kleinen Grenzen der Beuroner Kunst, so daß man vom hieratischen P. Desiderius-
Giotto bis zum P. Adalbert-Ghirlandajo sprechen könnte.
Neben dem Eklektizismus möchte ich noch einen zweiten Einwand erheben: er
betrifft das Schönheitsideal der Beuroner, das sich mit dem religiösen Begriff des
Reinen, Erhabenen, Schlackenfreien decken soll. Hier entstand ein Formenkanon,
der in seiner Weichheit, seiner glatten, vagen Typisierung, seiner hartnäckigen Ab-
sonderung von aller realistischen Charakteristik der Süßlichkeit nicht ferne steht.
Gerade jene Gebetbuchbildchen, welche der Verfasser durch diese Kunst (speziell
in den Miniaturen) verdrängt sieht, ferner die von P. Lenz abgelehnten Nazarener
(Kreitmaier bestätigt deren Einfluß auf Lenz S. 107), einzelne Romantiker. — viel-
leicht auch Steinhausen —, sie stehen in bezug auf weichliche, schöngeglättete
Empfindung auf ähnlichem Boden. Das ist gerade die wunderbare Kraft jener un-
nachahmlichen, hieratischen Einfachheit der ägyptischen Kunst — des Vorbildes
P. Lenzens —, jener anscheinenden Glätte und Leere der Form, unter welcher das
Leben stärker pulsiert als unter dem besten, akademisch durchmodellierten Parade-
stück. Der Mangel an Herbheit mag auch dem Mangel an Kampf, an künstlerischen
Geburtswehen zuzuschreiben sein. In stiller, heiterer Klause, weltabgeschieden, ganz
in Gedanken an Gott entstanden diese Werke — aber warum sind Fra Angelico
und Memling nicht süßlich? Und ferner: warum entsteht der Begriff des Süßlichen
in der Kunst niemals in hieratischen und archaischen Perioden, sondern immer erst
in verweichlichten dekadenten Zeiten oder in eklektischen Strömungen, die keinen
Zusammenhang mit ihrer Kultur haben — ich erinnere nur an die englischen Prä-
raffaeliten?
Das aber muß unbedingt gesagt werden, daß die Beuroner Kunst die einzige
wahrhaft bedeutsame und beachtenswerte religiöse Kunstbestrebung der letzten
80 Jahre ist. Daß sie nicht das allerhöchste bieten kann, wie man es von dieser
Kunstgattung wünschen möchte, liegt nicht an ihren Künstlern, sondern an den
negativen Faktoren unserer Zeit.
Frankfurt a. M. Hermann Lismann.
Friedrich Wachtsmuth, Der Backsteinbau. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche
Buchhandlung.
Friedrich Wachtsmuth, den eine vortreffliche Doktorarbeit über »Die islamischen
Backsteinbauten der Profanbauten im Irak« zum Backsteinthema geführt hat, macht
es sich in seinem Buch zur Aufgabe, die Zusammenhänge des morgenländischen
und abendländischen Backsteinbaus aufzuweisen.
Er führt mit reichem wissenschaftlichem Material gerüstet aus, wie diese Kunst
im Morgenlande von vorgeschichtlichen Zeiten an sich sowohl konstruktiv wie formal
ohne Unterbrechung aufbaut von einfachsten und ursprünglichsten Gestaltungen bis
zu den reichsten Prachtbauten. »Gleich den Gliedern einer Kette schließt sich ein
Zeitabschnitt mit seinen charakteristischen Bauwerken dem anderen an.«
Im Abendlande dagegen ist man ursprünglich dem Hau- und Werksteinbau
ergeben und es ist charakteristisch, daß die Backstein-Erscheinungen, die dazwischen
nicht fehlen, plötzlich auftreten und dann wieder in Vergessenheit geraten. So
in Rom und Ravenna im 5. und 6. Jahrhundert. Erst die große lombardische Be-
wegung an der Wende des 11. Jahrhunderts erobert ihm im Abendlande die selb-
ständige Stellung eines eigenen künstlerischen Ausdrucks, der gleich in großer
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XX. 23